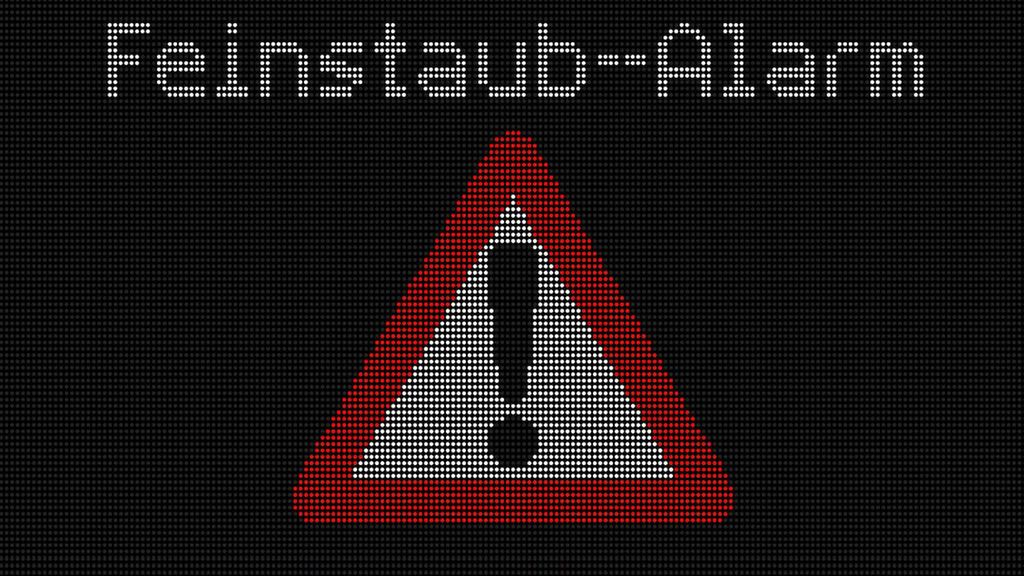
Luftverschmutzung kann zu Übergewicht und Diabetes führen
Wird länger feinstaubbelastete Luft eingeatmet, kann das über veränderte Stoffwechselvorgänge zu Fettansammlungen und zu viel Zucker im Blut führen. Das zeigten nun Experimente mit Mäusen.
Zürich. Sechs Monate lang atmeten sie fünf Tage pro Woche und jeweils sechs Stunden lang Luft ein, die mit Feinstaubpartikeln angereichert war: Labormäuse der Universität Zürich (UZH). Damit waren die Versuchstiere ähnlich belastet wie Bewohnerinnen und Bewohner von städtischen Gebieten. So wollten Forscher der UZH, die das Experiment durchführten, herausfinden, wie sich eine längere Belastung durch verschmutzte Luft auf den Stoffwechsel und die Regulierung des Blutzuckerspiegels auswirkt. Das Ergebnis: Hinweise, dass Luftverschmutzung nicht nur schädlich für die Lunge und das Herz ist, sondern auch das Risiko erhöht, übergewichtig zu werden und an Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken, «verdichteten sich», wie es in einer Aussendung der UZH heisst.
Wie es durch das Einatmen von feinstaubbelasteter Luft zu diesem erhöhten Risiko für Fettansammlungen und zu viel Zucker im Blut kommen kann, erklärt Studienleiter Francesco Paneni vom Zentrum für translationale und experimentelle Kardiologie der UZH und des Universitätsspitals Zürich (USZ). Durch das Einatmen der feinstaubbelasteten Luft habe sich am Maus-Modell schon nach fünf Monaten «die Funktion des braunen Fettgewebes stark verändert». Braunes Fettgewebe ist dazu da, Wärme zu erzeugen und Fett zu verbrennen. Paneni: «Die Veränderungen des braunen Fettgewebes gehen wiederum auf eine Störung der Aktivität bestimmter Gene zurück und unter anderem mit einer erhöhten Fettansammlung einher.» Ausserdem zeigten die Mäuse, die Feinstaub eingeatmet hatten, anders als die Mäuse in der Kontrollgruppe, die sich in gefilterter Luft befanden, Anzeichen einer beeinträchtigten Empfindlichkeit für Insulin. Und das erhöht das Risiko für eine Erkrankung an Diabetes mellitus Typ 2.
Zudem identifizierten die Forscher als Schlüsselakteure in dem Veränderungsprozess zwei Enzyme. Wurden die Enzyme unterdrückt, verbesserten sich die Funktion des Fettgewebes und der Stoffwechsel. «Die Ergebnisse der Studie weisen so auf neue Ansatzpunkte für die Prävention und die Behandlung hin», so Paneni. (sst)
Quelle: Universität Zürich (UZH) und Universitätsspital Zürich (USZ)
Das könnte Sie auch interessieren:
So schneiden die Schweizer Medizinunis im globalen Ranking ab
In den renommierten THE World University Rankings behauptet sich die ETH Zürich als beste Schweizer Hochschule im Bereich Medizin. Auch Bern und Basel schaffen es unter die Top 100.
Gesundheitsdienstleister dürfen ohne Zusatzkosten interkantonal arbeiten
Ohne für eine weitere Berufsausübungsbewilligung bezahlen zu müssen, dürfen Gesundheitsdienstleister in mehreren Kantonen arbeiten. Das bestätigten nun zwei Urteile des Bundesgerichts ...
Handyverbot für längeren Schlaf und bessere Noten
Eltern sollten ihren Kindern verbieten, abends noch das Smartphone zu benützen. Einer Schweizer Studie zufolge verlängert das den Schlaf und verbessert die Schulnoten.

.jpg)
