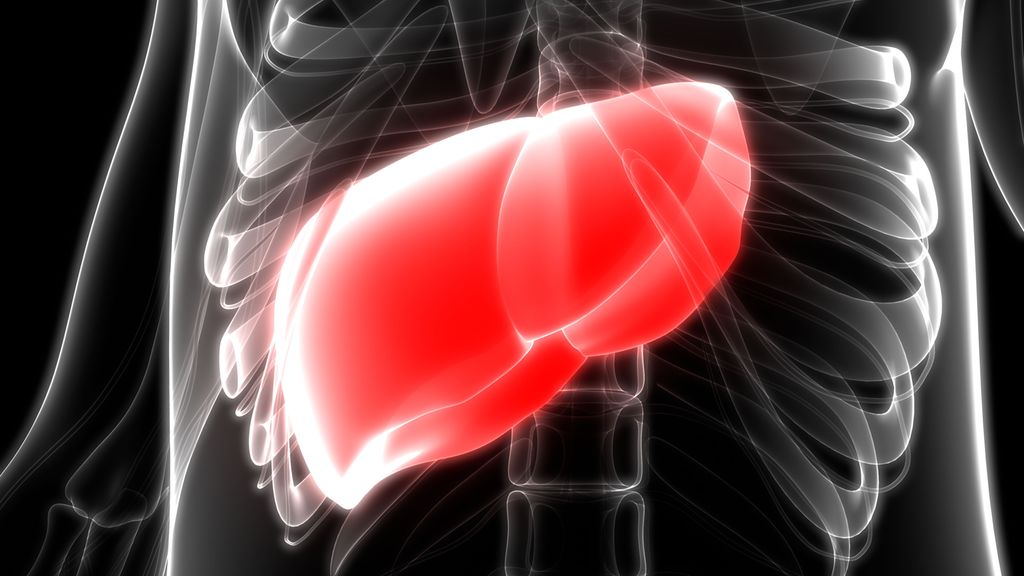
©
Getty Images/iStockphoto
Highlights aus der Hepatologie an der DDW 2017
Leading Opinions
Autor:
Oberarzt Dr. med. Joachim C. Mertens
Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie<br> Universitätsspital Zürich<br> E-Mail: joachim.mertens@usz.ch
30
Min. Lesezeit
01.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Aus dem Gebiet der Hepatologie waren an der diesjährigen DDW zahlreiche bemerkenswerte Abstracts zu finden. Im Folgenden sollen fünf Studien kurz vorgestellt werden. Neben den Neuerungen durch die Einführung der hochwirksamen direkten antiviralen Substanzen (DAA) sollen die eindrückliche Epidemiologie des hepatozellulären Karzinoms (HCC) und das Outcome von Patienten, die wegen eines HCC für eine Lebertransplantation gelistet werden, kurz dargestellt werden. Daneben werden anhand zweier weiterer Abstracts die Bedeutung der nicht alkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) bei schlanken Patienten sowie der Einfluss von Koffein bei NAFLD vorgestellt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Prognose von HCV-Patienten mit interferonfreier Behandlung</h2> <p>In einer japanischen Studie wurden 207 Patienten für ein medianes Follow-up von 17,2 Monaten nach DAA-Therapie erfasst.<sup>1</sup> Die Erfolgsrate der Therapie war mit 95 % erwartungsgemäss gut. Die Autoren berichten eine Verbesserung der Leberwerte, bei allerdings ausbleibender Verbesserung der Thrombozytenzahl und der PTT. Wie schon in früheren Untersuchungen findet sich auch in dieser Studie eine HCC-Rezidiv-Rate von etwa 6 % . Die Autoren schliessen daraus, dass eine engmaschige Verlaufskontrolle der erfolgreich behandelten Patienten indiziert ist.<br /> Die Frage, ob die HCC-Inzidenz nach erfolgreicher DAA-Therapie tatsächlich erhöht ist, bleibt aber derzeit noch kontrovers. Hierzu sind weitere prospektive Studien notwendig.</p> <h2>HCC ist das häufigste Malignom in der «baby-boomer generation»</h2> <p>Die Autoren dieser Studie aus den USA haben auf der Grundlage der nationalen Datenbank Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) die Inzidenz primärer maligner Tumoren in der «baby- boomer generation», also bei den Geburtsjahrgängen 1945–1965, untersucht.<sup>2</sup> Entsprechend der dokumentierten ICD-Klassifikation wurden für die Jahre 2003 bis 2012 jeweils die fünf häufigsten primären Tumoren in dieser Altersgruppe ermittelt. Die primären Malignome mit der höchsten Inzidenz waren in dieser Untersuchung Uteruskarzinom (48,6 % ), HCC (48,3 % ), Prostatakarzinom (35 % ), multiples Myelom (31 % ) und Pankreaskarzinom (28 % ). Bemerkenswert ist, dass für das Berichtsjahr 2012 die Inzidenz des HCC erstmals diejenige der Uteruskarzinome übertroffen hat und das HCC damit der häufigste maligne Tumor in der «baby- boomer generation» ist. 58,4 % aller HCC wurden in dieser Altersgruppe diagnostiziert.</p> <h2>Starke Zunahme der Zahl an HCCPatienten, die für Transplantation gelistet werden</h2> <p>Auf Basis der Daten des US-amerikanischen Scientific Registry of Transplant Recipients untersuchten de Avila et al. das Outcome von HCC-Patienten, die zwischen 2001 und 2014 in kurativer Absicht für eine Lebertransplantation gelistet worden waren.<sup>3</sup> Im genannten Zeitraum waren insgesamt 20 883 Patienten mit HCC für eine Transplantation gelistet worden. Das mittlere Alter lag bei 58 Jahren. Nach einer mittleren Wartezeit von 114 Tagen erhielten 69 % der gelisteten Patienten ein Transplantat. Die Autoren beschreiben einen drastischen Anstieg der Listungen von HCC-Patienten zwischen 2001 und 2002, der am ehesten mit der Einführung der MELD-Zusatzpunkte («Model for End-stage Liver Disease») bei HCC im Jahr 2002 zu erklären ist. Insgesamt nahm die Zahl der wegen HCC gelisteten Patienten zwischen 2001 und 2014 um mehr als das 6-Fache von 395 auf 2533 zu. Parallel dazu sank die Rate der transplantierten HCC-Patienten von 80 % auf 65 % ab, wobei die absolute Anzahl an Transplantationen deutlich zunahm. Die Abnahme der Rate an transplantierten HCC-Patienten kann damit erklärt werden, dass infolge von Verschlechterung der Grunderkrankung oder Tod häufiger Patienten von der Liste entfernt werden mussten. Besonders bemerkenswert ist die Zunahme der NASH-bedingten HCC von 2 % (2001) auf 11 % (2014). Die Hepatitis C blieb über den gesamten Zeitraum die häufigste Grunderkrankung, während die Hepatitis-B-bedingten HCC deutlich von 14 % auf 5 % abnahmen. Zusammenfassend lässt sich eine eindrückliche Zunahme der Listungen mit der Indikation HCC beobachten, wobei sich gleichzeitig ein Wandel der zugrunde liegenden Lebererkrankungen zeigt.</p> <h2>Schlanke NAFLD-Patienten haben schlechteres Outcome als übergewichtige</h2> <p>In dieser prospektiven Untersuchung aus den USA wurden Patienten erfasst, die bei sonografisch oder histologisch gesicherter nicht alkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) einen BMI von <25kg/m<sup>2</sup> aufwiesen.<sup>4</sup> Insgesamt wurden in einer Kohorte von 1100 NAFLD-Patienten 68 «schlanke» NAFLD-Patienten identifiziert. Der klinische Verlauf dieser Patienten wurde mit demjenigen der übergewichtigen NAFLD-Patienten verglichen. Der mittlere BMI der schlanken Patienten lag bei 22kg/m<sup>2</sup>, bei den übergewichtigen betrug der BMI im Mittel 35kg/m<sup>2</sup>. Schlanke NAFLD-Patienten hatten häufiger eine Zirrhose (78 % vs. 66 % ; p=0,051) und häufiger eine dekompensierte Lebererkrankung (62 % vs. 51 % ). Die Gesamtmortalität lag bei 12 % , wobei die Mortalität der schlanken Patienten mit 26 % signifikant höher war als die der übergewichtigen Patienten (11 % ). Das Mortalitätsrisiko war bei schlanken NAFLD-Patienten fast dreimal so hoch wie bei den übergewichtigen. Die Autoren diskutieren die Frage, ob der NAFLD bei schlanken Patienten andere Mechanismen zugrunde liegen, die das schlechtere Outcome bei diesen Patienten erklären könnten.</p> <h2>Zusammenhang zwischen Koffein-/ Kaffeekonsum und NAFLD</h2> <p>Seit Jahren wird eine mögliche protektive Wirkung von Kaffee auf die Leber diskutiert. In einer Studie aus den USA haben die Autoren den Zusammenhang zwischen Koffein- und Kaffeekonsum und dem Auftreten einer NAFLD untersucht.<sup>5</sup> Die zugrunde liegenden Daten stammen aus der «Third National Health and Nutrition Examination Survey», die in den Jahren 1984 bis 1994 durchgeführt wurde. NAFLD wurde als das sonografische Vorliegen einer Lebersteatose in Abwesenheit anderer Lebererkrankungen definiert. Die Steatose wurde in «normal», «mild», «moderat » oder «schwer» eingeteilt. Zudem wurde die Leberfibrose anhand des NAFLD Fibrosis Score (NFS) als niedrig, intermediär oder hoch beurteilt. Der tägliche Koffeinkonsum wurde den Daten zur Nahrungsaufnahme entnommen und die Koffeinmenge des Kaffees mit 136mg pro Tasse berechnet. Anschliessend wurde auf einen möglichen statistischen Zusammenhang zwischen dem Gesamtkoffein-/Gesamtkaffeekonsum und dem NAFLD-Grad untersucht.<br /> 10 668 Patienten waren in die Analyse eingeschlossen worden. Bei 3922 Patienten (34 % ) lag eine NAFLD vor. Die Menge an konsumiertem Koffein aus Kaffee zeigte eine inverse Korrelation mit dem Schweregrad der NAFLD; eine höhere Menge war tendenziell mit einem niedrigeren NFS assoziiert. Der Gesamtkoffeinkonsum korrelierte hingegen nicht mit dem NAFLD-Grad.<br /> Nur die mit Kaffee konsumierte Koffeinmenge, nicht aber der Gesamtkoffeinkonsum ist in Form einer inversen Korrelation mit einer niedrigeren NAFLD-Prävalenz assoziiert und korreliert umgekehrt mit dem Schweregrad der NAFLD. Dies könnte gemäss den Autoren z.T. dadurch bedingt sein, dass die Gesamtkoffeinmenge auch Koffein beinhaltet, das mit gesüssten Softdrinks konsumiert wird. Denkbar sei auch, dass andere Inhaltsstoffe des Kaffees eine protektive Wirkung auf die Leber haben</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Yasuhiro Tsuda Y et al.: The prognosis of HCV patients with treatment history of interferon-free therapy. Gastroenterology 2017; 152(Suppl 1): S905 <strong>2</strong> Chiranjeevi Gadiparthi C et al.: Hepatocellular carcinoma is now the leading primary cancer with highest proportion of total incidence within birth cohort 1945-1965. Gastroenterology 2017; 152(Suppl 1): S300 <strong>3</strong> de Avila L et al.: Outcomes of wait-listed liver transplant (Lt) candidates with hepatocellular carcinoma (HCC) in the United States from 2001 to 2014. Gastroenterology 2017; 152(Suppl 1): S1175 <strong>4</strong> Mansour W et al.: Lean patients with nonalcoholic fatty liver disease have worse survival rates, higher frequency of cirrhosis, and decompensation compared to non-lean patients. Gastroenterology 2017; 152(Suppl 1): S1201 <strong>5</strong> Kim H et al.: The association of caffeine and coffee consumption with severity of non-alcoholic fatty liver disease: a population- based study. Gastroenterology 2017; 152(Suppl 1): S1205</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
HBV-Reaktivierung unter Immunsuppression
Durch aktuelle Migrationsdynamiken befindet sich auch in Österreich die Prävalenz der Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) im Steigen. Besonders bei Patient:innen unter ...
Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA
Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...
Neues aus der Welt der Hepatologie
Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...


