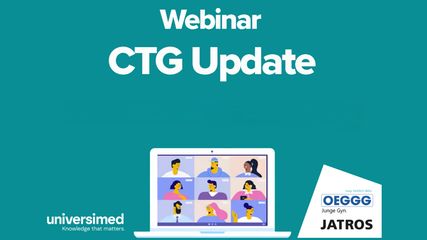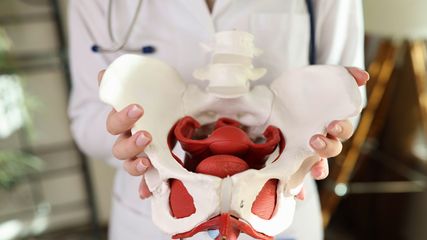©
Getty Images
Vom Grenzgebiet zum Schwerpunkt
Leading Opinions
Autor:
Prof. Dr. med. Volker Viereck
Co-Chefarzt Frauenklinik<br> Chefarzt Urogynäkologie<br> Kantonsspital Frauenfeld<br> Blasen- und Beckenbodenzentrum<br> E-Mail: volker.viereck@stgag.ch
30
Min. Lesezeit
22.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die «Urogynäkologie», ursprünglich ein Grenzgebiet zwischen Gynäkologie und Urologie, umfasste früher einige wenige Operationstechniken, wie die vaginale Hysterektomie mit vorderer/hinterer Scheidenraffung und Richter-Fixation. Dazu kamen meist offene Inkontinenzoperationen, wie die Kolposuspension. Bei Prolapsoperationen wurden, wenn überhaupt, selbst zugeschnittene vaginale Netze verwendet. Netztypen und Netzmaterialien sowie die Fixationstechniken waren damals sehr limitiert.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Heute bildet die Urogynäkologie, neben Geburtshilfe, Onkologie und Reproduktionsmedizin, eine eigenständige Disziplin der Frauenheilkunde. In der Schweiz wird der Schwerpunkttitel «Urogynäkologie » seit Januar 2016 erstmals angeboten und kann in zertifizierten Weiterbildungsstätten erlangt werden. Das erklärte Ziel ist die Nachwuchsförderung, d.h. die strukturierte, reglementierte Weiterbildung von Fachkräften auf dem Gebiet der Harninkontinenz sowie der Beckenbodenpathologien und deren Folgeerkrankungen. Diagnostische, konservative und operative Kompetenzen werden so gefördert, Hospitationen, Austausch und klinisch-wissenschaftliche Forschung gehören auch dazu. Damit wird die Schweiz den neuen hohen Anforderungen an das Fach gerecht und ist dem Trend in Ländern weltweit gefolgt, wo sich die Urogynäkologie bereits als vierte Säule der Frauenheilkunde etabliert hat.</p> <h2>Revolution in den 1990ern</h2> <p>Welche Faktoren führten zu dieser Entwicklung vom Grenzgebiet zum Fokus des Interesses? Die Revolution begann in den 1990er-Jahren mit der Einführung der spannungsfreien Vaginalschlingen, der TVT-Bänder. Bis heute ist diese einfache, klar definierte, erfolgreiche und komplikationsarme Operationsmethode die Standardtherapie (Goldstandard) bei Belastungsinkontinenz. Allgemein werden heute Harninkontinenz, Deszensusbeschwerden und sexuelle Funktionsstörungen nicht mehr einfach so akzeptiert. Die Patientinnen wünschen nicht nur objektive, sondern auch subjektive funktionelle Verbesserungen und eine gute Lebensqualität bis ins hohe Alter. Dadurch erlangen auch konservative, nicht operative Massnahmen wie Pessare oder Physiotherapie einschliesslich der Ganzkörpervibrationstherapie einen ganz neuen Stellenwert.<br /> Verschiedene technische Errungenschaften unterstützen den Urogynäkologen, diese hohen Ansprüche zu erfüllen. Dazu gehört, ganz wichtig in der modernen Diagnostik, die Bildgebung mittels Ultraschall, die sogenannte Pelvic-Floor- Sonografie. Dargestellt werden können sämtliche Organe, einschliesslich deren Dynamik, aber auch Bänder und Netze. Dank der Pelvic-Floor-Sonografie kann die Operation präoperativ besser geplant und postoperativ überprüft werden, und Ursachen von Komplikationen können diagnostiziert werden. In den letzten Jahren wurde die vaginale Chirurgie durch endoskopische Techniken ergänzt. So können heute komplexe Beckenbodenpathologien mittels konventioneller oder roboterunterstützter Laparoskopie erfolgreich behandelt werden. Der Eingriff mit dem Da-Vinci-Roboter ermöglicht eine dreidimensionale Darstellung mit zehnfacher Vergrösserung, eine präzise Instrumentenführung und somit eine gefäss- und nervenschonende Operationstechnik. Durch eine rückenschonende Haltung profitiert selbst der Operateur. Die laparoskopischen Techniken werden kontinuierlich verbessert, z.B. durch die Einführung der dreidimensionalen Optik auch in der konventionellen Laparoskopie. Anstelle der selbst zugeschnittenen Netze werden heute vorgefertigte Mesh- Kits verwendet. Diese erlauben optimierte und standardisierte Operationen. Immer populärer werden neben den Bänderoperationen auch minimalst invasive Therapien der Belastungsinkontinenz, wie die Umspritzung der Harnröhre mit «bulking agents» oder, im Rahmen von Studien, die Stimulation der Bindegewebsneubildung mit Laserstrahlen im «smooth mode». Neue innovative Therapien bei der Behandlung des chronischen Schmerzsyndroms, der interstitiellen Zystitis oder der Reizblase kamen in den letzten Jahren dank eines besseren Verständnisses der «chronic pelvic pain syndromes » hinzu.</p> <h2>2011 – ein Jahr der Zäsur</h2> <p>Eine jähe Zäsur in der Entwicklung der Urogynäkologie war 2011 die Warnung der US Food and Drug Administration (FDA) vor Komplikationen mit Netzen bei der Behandlung des Genitaldeszensus. In der Folge nahmen die Patientenklagen zu, einige amerikanische Hersteller sistierten die Produktion und in Schottland wurden die vaginalen Netze offiziell von Politikern verboten. Heute gibt es einige europäische und amerikanische Firmen, die neue Netztechnologien anbieten. Dennoch ist eine Diskussion darüber auch in Europa im Gang.<br /> Seit 2011 hat sich auf dem Gebiet der Netzchirurgie aber einiges getan. Netze von damals sind nicht gleich Netze von heute. Mesh-Kits aus neuen, leichten Materialien und neue Fixierungstechniken mit zentralem Zugang und weniger Blindpassagen erschliessen andere Räume im kleinen Becken. Ganz wichtig für das Gelingen dieser Eingriffe sind eine fundierte Ausbildung, das Training und die entsprechende Erfahrung des Operateurs. Netzoperationen sollten nur in Zentren mit hohen Fallzahlen durchgeführt werden und die neuen Techniken und Materialien sollten zwingend durch wissenschaftliche Studien abgesichert sein.</p> <h2>Was erwartet uns in Zukunft?</h2> <p>Mit der höheren Lebenserwartung der Patientinnen werden Deszensusbeschwerden und Harninkontinenzprobleme weiter stark zunehmen. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Urogynäkologen wird weiter steigen. Mehr an Bedeutung werden auch interdisziplinäre Zentren gewinnen, wo fachübergreifend mit Urologen, Koloproktologen und Neurologen zusammengearbeitet wird. Die zeitlich deutlich kürzere vaginale Chirurgie sollte bei Kontraindikationen der Laparoskopie, wie kardiopulmonalen Risiken, Blutgerinnungsstörungen, Adipositas per magna, schweren Adhäsionen im Unterbauch nach Voroperationen oder bei gewissen Rezidivtypen, nach wie vor offeriert werden können. Das breite Spektrum an etablierten Angeboten sollte bewahrt werden und Innovationen sollten in Angriff genommen werden, um die grosse Vielfalt und Komplexität der urogynäkologischen Störungen auch künftig kritisch, gezielt und individuell behandeln zu können. Einen Rückschritt in die Zeit vor 20 Jahren können wir uns nicht leisten.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Webinar „CTG-Update“
Webinar „CTG-Update“ mit Dr. Elisabeth D’Costa: Aktuelle Leitlinien, praxisnahe Tipps und neue Standards kompakt zusammengefasst. Jetzt ansehen und Wissen auffrischen!
Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie
Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...