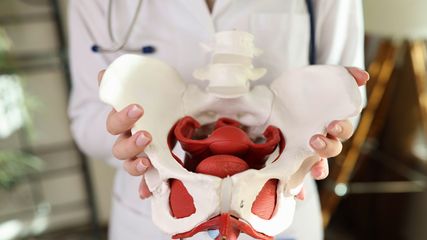©
Getty Images
Sexualmedizin in der gynäkologischen Sprechstunde
Leading Opinions
Autor:
Dr. Mariele Keller
Praxis für Beckenbodenerkrankungen und Urogynäkologie<br/> Zürich<br/> E-Mail: mariele.keller@hin.ch
30
Min. Lesezeit
28.02.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die gynäkologische Sprechstunde ist ein idealer Ort, um sexualmedizinische Fragen zum Thema zu machen. Die Bandbreite der Themen ist gross und reicht von Wissensdefiziten bis zu komplexen Partnerschaftskonflikten, von Normvarianten bis zu schweren körperlichen und psychischen Krankheitsbildern. Im Grunde stehen die meisten Lebensthemen in irgendeinem direkten oder indirekten Zusammenhang zur Sexualität des Menschen. Das Bedürfnis der betroffenen Frauen, über diese Themen zu reden, ist gross, die Befangenheit auf Arzt- und Patientinnenseite jedoch ebenfalls. Wie können wir als GynäkologInnen Brückenbauer werden?</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Der Bedarf an sexualmedizinischer Beratung und Behandlung von Frauen nimmt zu.</li> <li>Gynäkologen stellen die naheliegenden ersten Ansprechpartner im medizinischen Umfeld dar.</li> <li>Die Palette der sexualmedizinischen Themen ist breit und bunt und reicht von Normvarianten bis zu schweren körperlichen und psychischen Krankheitsbildern, von Wissensdefiziten bis zu komplexen Partnerschaftskonflikten.</li> <li>Eine ärztliche Basisberatung kann ein Drittel bis ein Viertel der sexuellen Probleme lösen.</li> </ul> </div> <p>Der Wunsch nach Geschlechtsverkehr und die vielen Facetten von Nöten, die um diesen Wunsch entstehen, bilden das Kernthema der Sexualmedizin. Dieser Wunsch bleibt bis ins Alter von 70 Jahren bei der überwiegenden Mehrheit von Frauen und Männern bestehen, um danach langsam abzufallen: 99 % der Männer zwischen 65 und 70 Jahren wünschen sich Geschlechtsverkehr, bei den Frauen dieses Alters sind es 82,5 % , bei den 60- bis 64-Jährigen noch 92 % der Frauen. Aber auch bei den Personen, die älter als 75 Jahre sind, wünschen sich noch 61 % der Männer und fast die Hälfte der Frauen (47 % ) Geschlechtsverkehr.<sup>1</sup> Dass dies für manch einen Mann und manch eine Frau Wunschdenken bleibt, ist selbstredend.<br />Was steht dem grundsätzlichen Wunsch nach Geschlechtsverkehr, im weiteren Sinne dem Wunsch nach einer gelebten Sexualität also entgegen? Bei den Frauen machen den grössten Teil der Sexualstörungen sogenannte Appetenzstörungen aus: Unter verminderter Libido leiden ca. 10 % der Frauen, während Funktionsstörungen wie Erregungs- und Orgasmusstörungen 5 % , Sexualschmerzen und Dyspareunie 7–8 % und Vaginismus weniger als 5 % der Frauen betreffen.<sup>2, 3<br /></sup>In den Gesprächen mit den Betroffenen stellt sich häufig heraus, dass das beklagte Leitsymptom, z.B. Dyspareunie, nur die Spitze eines Eisbergs darstellt und meist auch beim Partner ein Problem vorliegt. Komorbiditäten sind an der Tagesordnung. Aber Frauen sind es gewohnt, als Symptomträger die Verantwortung für ein Problem zu übernehmen. Bei der partnerschaftlichen Evaluation des Sexualproblems ist es also wichtig, neben der persönlichen körperlichen und seelischen Dimension auch die des Partners zu erfassen und zudem das Umfeld des Paares zu ermitteln: Kinder im Haushalt, fehlende Rückzugsmöglichkeiten, berufliche Stresssituationen, fehlende Distanz zu Eltern oder Schwiegereltern, Freundeskreis etc. Im Weiteren spielt auch das kulturell-religiöse Umfeld des Paares eine mitunter entscheidende Rolle beim Thema Sexualprobleme. In diesem Kontext hat sich daher das umfassende bio-psychosoziale- Modell bewährt (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Gyn_1901_Weblinks_a2-abb1.jpg" alt="" width="471" height="422" /></p> <h2>Inputs für das Gespräch zum Thema Lustlosigkeit</h2> <p>Für das weitere Gespräch mit den Klienten, z.B. zum Thema «Lustlosigkeit», das natürlich in erster Linie von der individuellen Problemstellung bestimmt wird, möchte ich versuchen, an dieser Stelle einige Inputs zu geben:<br />• Die Dauer einer Partnerschaft ist eine der wichtigsten Determinanten beim Thema Häufigkeit von Sex in der Partnerschaft. So hat z.B. eine 60-jährige Frau, die gerade frisch verliebt ist, durchschnittlich häufiger Sex als eine 40-jährige, die seit 15 Jahren in einer festen Beziehung ist. Bei den Männern verhält sich das genauso.<sub><sup>4</sup><br /></sub>• Eine Bewertung des Orgasmus, bei der der vaginale Orgasmus als «reifer Orgasmus » angesehen wird, ist einengend. Tatsache ist, dass nur 4 % der Frauen einen rein vaginalen Orgasmus erleben, 30 % kommen ausschliesslich über Klitorisstimulation zum Orgasmus und 52 % benutzen gleichzeitig beide Stimulationswege.<sup>5<br /></sup>• Der Klitoriskörper ist mehr als die kleine «Perle» unter der Klitorisvorhaut. Seine lateralen Schwellkörper umschliessen die vordere Vaginalwand im distalen Drittel zu einem grossen Teil, der sogenannte G-Punkt liegt ebenfalls in diesem Bereich.<br />• Auch bestehen verbreitet einseitige Vorstellungen darüber, was wünschenswerter Sex beinhaltet. Die medialen Vorbilder suggerieren eine starke Ausrichtung auf Körpermerkmale wie Brüste, Penisgrösse, Attraktivität, Lust, Verlangen, Orgasmus. Demgegenüber sind zu entdecken und Spass zu haben, sexuelle Kommunikation, das Einswerden, eine erotische Intimität und Authentizität zu erleben stark unterrepräsentiert.<sup>6<br /></sup>Ein weiterer Dauerbrenner in der gynäkologischen Sprechstunde sind Infektionen und Schmerzen, die bei chronischen oder chronisch rezidivierenden Verläufen zu einer zunehmenden Belastung in der partnerschaftlichen Sexualität führen. In diesem Zusammenhang ist die Reaktionsweise des Partners von grosser Bedeutung:<sup>7</sup> So führen sowohl negativ-ablehnende Reaktonen als auch sehr besorgte Reaktionen des Partners zu verstärkter Schmerzwahrnehmung. Eine entlastende Reaktionsweise hingegen hilft der Betroffenen, Bewältigungsstrategien gegen den Schmerz zu entwickeln, was auch die sexuelle Zufriedenheit erhöht.<br /> Auch Inkontinenz löst starke Schamgefühle aus und führt damit zum Rückzug aus der Körperlichkeit. Karzinomerkrankungen führen bei Frauen und Männern oft zu Körperbildstörungen und/ oder Funktionseinschränkungen.</p> <h2>Therapeutischer Verlauf</h2> <p>Im therapeutischen Verlauf ist die Ungeduld auf Arzt- und Patientenseite einer der grössten Störfaktoren bzw. die grösste Lernherausforderung. Patienten kommen mit ihrem Problem oft auf den letzten Drücker, es besteht ein hoher Leidensdruck, dringender Kinderwunsch, die biologische Uhr tickt, die Partnerschaft droht auseinanderzubrechen. Sie wünschen sich den ultimativen Tipp oder eine Wunderpille. Das schafft Druck für beide Seiten. Aber auch die Ärzte, gewohnt an ein möglichst effizientes Ping-Pong-Setting: Frage – Antwort, Problem – Lösung, Symptom – Diagnose oder am besten gleich: Symptom – Therapie, tun sich schwer, sich auf die breitere Themenstellung und die kleinen Schritte einzulassen.</p> <h2>«Just ask»</h2> <p>Gynäkologen sind mit 47 % die wichtigsten medizinischen Ansprechpartner für betroffene Frauen, gefolgt von Allgemeinmedizinern mit knapp 39 % . Wesentlich seltener werden diese Themen bei Psychiatern angesprochen (7 % ), an Urologen wenden sich nur 0,5 % der Betroffenen. Diese Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass ärztliche Hilfe überhaupt nur von einem Drittel der Frauen mit Sexualstörungen in Anspruch genommen wird, über 40 % suchen auf informellem Weg bei Freunden oder Partnern nach Informationen und Hilfe. 8,5 % bevorzugen anonyme Kanäle wie Internet, Radio, TV oder Printmedien. Und gut 14 % der betroffenen Frauen suchen gar keine Hilfe.<sup>8</sup> In der Regel (58 % ) werden sexualmedizinische Fragen bei Routinekontrollen angesprochen, ein Drittel kommt im Rahmen von anderen medizinischen Abklärungen zur Sprache. Selten (ca. 6 % ) werden eigene Termine für ein sexualmedizinisches Problem vereinbart.<sup>8</sup> Warum sprechen die Patientinnen ihre sexuellen Probleme so selten an? Interessanterweise halten es 76 % der betroffenen Frauen für unwahrscheinlich, dass der Arzt oder die Ärztin ihnen helfen können. Aber auch Scham, mit dem Problem nicht ernst genommen zu werden (71 % ) oder den Arzt/die Ärztin mit einem Thema zu konfrontieren, bei dem sie sich unwohl fühlen könnten (60 % ), hat letztlich eine Sprachlosigkeit auf Patientenseite zur Folge.<sup>9</sup> Auch Ärzte tun sich oft schwer, sexualmedizinische Themen anzusprechen, sei es wegen spezifischer Wissensdefizite (54 % ), unreflektierter eigener Haltung zum Thema Sexualität oder wegen des typischen Zeit- und Problemlösungsdruckes im Praxisbetrieb (46 % ).<sup>10</sup> Während des Gespräches ist es bedeutsam zu unterscheiden, dass Ärzte zu 50–60 % über Diagnose und Behandlung reden, während Patientinnen zu 50–60 % über ihr Krankheitserleben, die emotionalen Auswirkungen ihres Krankseins reden.<sup>10</sup> Durch diesen unterschiedlichen Fokus laufen sie Gefahr, dass die Beschwerden als «psychisch bedingt» abgestempelt werden.<br />Dabei wären 91 % der Patientinnen froh, wenn sie aktiv auf ihre sexuelle Gesundheit angesprochen würden, schon alleine, um Präventionstipps zu erhalten. 15 % wären zwar etwas verlegen, von diesen wären aber 76 % trotzdem froh, wenn Ärzte nachfragen würden.<sup>11</sup></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Eine ärztliche Basisberatung kann ein Drittel bis ein Viertel der sexuellen Probleme der Patientinnen oder Patienten lösen.<sup>12, 13</sup> Edukativ Kenntnisse über den Körper und sein Funktionieren zu vermitteln, könnte ein naheliegendes Ziel z.B. im Rahmen der Jahreskontrollen darstellen und wäre für manche/n GynäkologIn realisierbar. Nicht umsonst sind GynäkologInnen als Lebensbegleiter der Frau naheliegende AnsprechpartnerInnen, auch für sexualmedizinische Fragestellungen. Entscheidend sind das Interesse, die Bereitschaft und die Kompetenz, sexuelle Themen überhaupt anzusprechen.</p> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Bucher T et al.: Sexualität in der zweiten Lebenshälfte. Psychosozial-Verlag, 2001<strong> 2</strong> Fugl-Meyer KS et al.: Standard operating procedures for female genital sexual pain. J Sex Med 2013; 10: 83-93 <strong>3</strong> Harlow BL et al.: Prevalence of symptoms consistent with a diagnosis of vulvodynia: population-based estimates from 2 geographic regions. J Sex Med 2014; 210(1): 40 <strong>4</strong> Schmidt G, Matthiesen S, Dekker A, Starke K: Spätmoderne Beziehungswelten. Report über Partnerschaft und Sexualität in drei Generationen. Springer: 2006 <strong>5</strong> Lehmann A et al.: Sexuologie 2003; 10: 128-122 <strong>6</strong> Eck A: Von der Paradoxie des Wollenwollens zum sex worth wanting. Therapeutische Alternativen zur Lustpille für die Frau. Familiendynamik 2017; 42(3): 182-91 <strong>7</strong> Rosen NO et al.: Woman & partner-perceived partner responses predict pain & sexual satisfaction in provoked vestibulodynia (PVD) couples. J Sex Med 2010; 7(11): 3715-24 <strong>8</strong> Shifren JL et al.: Help-seeking behavior of women with self-reported distressing sexual problems. J Women’s Health 2009; 18: 461-8 <strong>9</strong> Marwick C: Survey says patients expect little physician help on sex. JAMA 1999; 281(23): 2173-4 <strong>10</strong> Rosen R et al.: Sexual communication skills in residency training: the Robert Wood Johnson model. J Sex Med 2006; 3(1): 37-46 <strong>11</strong> Meystre-Agustoni G et al. Talking about sexuality with the physician: are patients receiving what they wish? Swiss Med Wkly 2011; 141: w13178. doi: 10.4414/ smw.2011.13178. eCollection 2011 <strong>12</strong> Beier K, Loewit K: Sexualmedizin. Urban & Fischer: München 2005 <strong>13</strong> Bitzer J: Die sexuelle Dysfunktion der Frau. Uni-Med Verlag, Bremen 2008</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Verbesserung der Ästhetik ohne onkologische Kompromisse
In der Brustchirurgie existiert eine Vielzahl an unterschiedlich komplexen onkoplastischen Operationstechniken mit verschiedenen Klassifikationen. Die kritische Selektion der Patient: ...
Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie
Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...