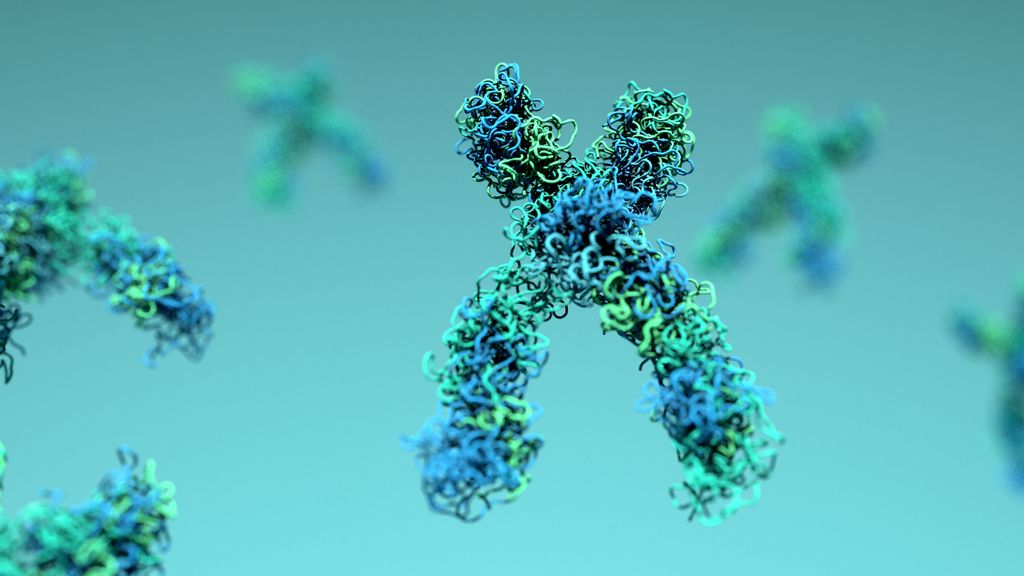
Kinderwunsch bei Frauen mit Turner-Syndrom: Möglichkeiten und Limitationen
Autoren:
DDr. Iris Holzer
Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Johannes Ott, PhD
Klinische Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Medizinische Universität Wien
Korrespondierende Autorin:
DDr. Iris Holzer
E-Mail: iris.holzer@meduniwien.ac.at
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Für Frauen mit Turner-Syndrom ist eine frühe Familienplanung wichtig, um die verfügbaren Optionen ausschöpfen zu können. Auch wenn eine Spontankonzeption möglich ist, bedarf es meist der Reproduktionsmedizin, um den Kinderwunsch zu erfüllen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über Familienplanung, Schwangerschaft und Geburt bei Frauen mit Turner-Syndrom.
Mit einer Inzidenz von etwa 1:2500 gilt das Turner-Syndrom oder auch Monosomie X mit einem 45,X-Karyotyp als die häufigste Form der weiblichen Gonadendysgenesien.1 Ungefähr 99% aller Konzeptionen mit einem 45,X-Chromosomensatz führen allerdings zu einem Spontanabort und stellen somit eine der Hauptursachen von Spontanaborten dar. Bei ungefähr 50% der lebendgeborenen Turner-Mädchen liegt ein reiner 45,X-Karyotyp vor, in den anderen Fällen besteht ein Mosaik-Karyotyp, wie 45,X/46,XX oder 45,X/47,XXX.
Zu den typischen Symptomen zählen Kleinwuchs, Ausbleiben der Thelarche, ein Schildthorax, Pterygium colli, primäre Amenorrhö, Ovarialinsuffizienz, angeborene Herz- und Gefäßmissbildungen, Nierenfehlbildungen, endokrine Störungen wie eine Glukosetoleranz- oder Schilddrüsenfunktionsstörung oder Osteoporose. Der Hormonstatus ist meist durch das Vorliegen eines hypergonadotropen Hypogonadismus gekennzeichnet.2
Familienplanung
Kinderwunsch bei Turner-Syndrom ist ein Thema, das gewiss nicht zur täglichen Routine in der gynäkologischen Praxis gehört. Doch wenn man mit betroffenen Mädchen oder jungen Frauen diese sensible Thematik bespricht, ist eine exakte Beratung über die verschiedenen Möglichkeiten und Chancen, aber auch über die Grenzen von großer Bedeutung für die weitere Lebensplanung der jungen Frauen. Eine Überweisung an eine Spezialambulanz ist hier auf jeden Fall unumgänglich. Am besten soll dies bereits mit Beginn des reproduktiven Alters, etwa im 16. Lebensjahr, erfolgen. Diesem einfühlsamen Gespräch über die Möglichkeiten der Familienplanung sollen sowohl ausreichend Zeit als auch die passenden Rahmenbedingungen, möglichst ohne Störfaktoren, gegeben werden.
Spontanschwangerschaft
Selbst die Möglichkeit einer spontanen Schwangerschaft ist in dem Kollektiv von jungen Frauen mit Turner-Syndrom gegeben, wenn auch die Inzidenz in der Literatur mit 4,8–7,6% als nicht sehr hoch beschrieben wird.3 Die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Schwangerschaft sinkt allerdings rasch mit zunehmendem Alter, was wiederum die Bedeutung der möglichst frühen Aufklärung über die Familienplanung betont. Spontane Schwangerschaften bei Turner-Frauen kommen fast ausschließlich bei Vorliegen eines Mosaik-Karyotyps vor. Zu weiteren begünstigenden Faktoren zählen ein spätes Alter bei Erstdiagnose und eine spontane Menarche ohne Hormonersatztherapie.4 Daher muss bei jungen Frauen mit Regelblutung auch an eine sichere Verhütungsmethode gedacht werden.
Sollte tatsächlich eine Schwangerschaft eingetreten sein, ist diese in vielen Fällen nicht ganz unkompliziert. Es wird einerseits eine hohe Fehlgeburtenrate von 30,8–45,1% und andererseits eine hohe Rate an fetalen Malformationen von 34% beschrieben. Von den fetalen Malformationen sind hier besonders die Trisomie 21 mit 4% und interessanterweise bei weiblichen Feten neuerlich ein Turner-Syndrom mit 15% zu nennen.
Künstliche Befruchtung
Des Weiteren ist eine künstliche Befruchtung mit autologen Eizellen im Sinne einer Oozytenkryokonservierung nach kontrollierter ovarieller Hyperstimulation eine Möglichkeit für Frauen mit einem 45,X0-Mosaikkaryotyp und bei noch bestehender Ovarialfunktion. Die Oozytenentnahme zur Kryokonservierung sollte jedoch nicht vor dem 12. Lebensjahr durchgeführt werden und erst nach exakter Aufklärung der adoleszenten Patientin erfolgen. Die Implantationsrate, die klinische Schwangerschaftsrate und die „take-home baby rate“ lagen laut einer türkischen Publikation über 22 Patientinnen mit einem Mosaik-Turnersyndrom bei 3,7%, 8,6% und 5,7%5 pro IVF-Zyklus.
Eine weitere Möglichkeit für Frauen mit Turner-Syndrom und Kinderwunsch ist eine Eizellspende, welche für die betroffenen Frauen eindeutig die besten Chancen hinsichtlich einer Schwangerschaft aufweist. Doch auch hier sind neben der expliziten Aufklärung bei Planung der Schwangerschaft besondere Vorsichtsmaßnahmen und vor allem ein suffizientes Screening geboten. Denn bei Frauen mit Turner-Syndrom besteht in der Schwangerschaft das Risiko einer Aortendissektion oder -ruptur. Trotz eines Screenings und einer engmaschigen Überwachung an einem Perinatalzentrum kann es zu tödlichen maternalen Komplikationen kommen und die Mortalität wurde auf 2,1% geschätzt.6,7
Der entscheidende Faktor, ob eine Schwangerschaft mit Eizellspende aktiv geplant werden darf, ist in diesem Fall der „ascending aortic size index“ (ASI).3 Im Rahmen der Durchuntersuchung vor einer geplanten Schwangerschaft sollten eine transthorakale Echokardiografie und eine kardiale MRT durchgeführt werden. Von einer Schwangerschaft sollte bei einem ASI >2,5cm/m2 oder einem ASI von 2,0–2,5cm/m2 mit zusätzlichen Risikofaktoren bezüglich Aortendissektion (bikuspide Aortenklappe, Elongation der Aorta transversa, arterielle Hypertension, frühere Aortaoperationen) abgeraten werden. Auch allen Patientinnen mit St.p. Aortendissektion sollte klar von einer Schwangerschaft abgeraten werden.
Schwangerenbetreuung
Wenn tatsächlich eine Schwangerschaft eingetreten ist, soll unbedingt eine interdisziplinäre Betreuung durch Experten der fetomaternalen Medizin und der Kardiologie erfolgen, weshalb die Schwangerenbetreuung und die Entbindung idealerweise an einem Tertiärversorgungszentrum geplant werden sollen.
Transthorakale Echokardiografien rund um die Schwangerschaftswoche 20+0 sind obligat. Bei Frauen mit Aortendilatation (ASI≥2,0cm/m2) oder mit zusätzlichen Risikofaktoren sollen regelmäßige fetomaternale Kontrollen inklusive Blutdruckmessungen und alle vier bis acht Wochen eine transthorakale Echokardiografie erfolgen. Auch innerhalb der ersten sechs Wochen post partum soll eine transthorakale Echokardiografie durchgeführt werden.
Der Geburtsmodus soll individuell festgelegt werden, wobei bei einem unauffälligen ASI und beim Fehlen weiterer Risikofaktoren im Prinzip auch eine Vaginalgeburt angestrebt werden kann.
Aufgrund der oben genannten Limitationen, was die Chancen und die gesundheitlichen Risiken der Optionen betrifft, sollte frühzeitig stets auch die Möglichkeit der Adoption als risikofreie Alternative angesprochen werden. Wenn die junge Frau bereits mit Einsetzen der reproduktiven Phase über alle Möglichkeiten der Familienplanung aufgeklärt wird, hat sie die besten Chancen auf eine individuell zufriedenstellende Lösung.
Die Inhalte dieses Artikels waren Thema eines Vortrags bei der 54. Fortbildungstagung für Gynäkologie & Geburtshilfe, 6.–11. Februar 2022, Obergurgl/hybrid.
Literatur:
1 Nielsen J, Wohlert M: Chromosome abnormalities found among 34,910 newborn children: results from a 13-year incidence study in Arhus, Denmark. Hum Genet 1991; 87(1): 81-3 2 Gravholt CH et al.: Turner syndrome: mechanisms and management. Nat Rev Endocrinol 2019; 15(10): 601-14 3 Gravholt CH et al.: Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. Eur J Endocrinol 2017; 177(3): G1-70 4 Bernard V et al.: Spontaneous fertility and pregnancy outcomes amongst 480 women with Turner syndrome. Hum Reprod 2016; 31(4): 782-8 5 Doger E et al.: Reproductive and obstetric outcomes in mosaic Turner’s syndrome: a cross-sectional study and review of the literature. Reprod Biol Endocrinol 2015; 13: 59 6 Hagman A et al.: Obstetric and neonatal outcome after oocyte donation in 106 women with Turner syndrome: a Nordic cohort study. Hum Reprod 2013; 28(6): 1598-609 7 Karnis MF: Fertility, pregnancy, and medical management of Turner syndrome in the reproductive years. Fertil Steril 2012; 98(4): 787-91
Das könnte Sie auch interessieren:
Was sollte der Urogynäkologe wissen?
Nykturie ist definiert als zumindest einmaliges nächtliches Urinieren, das den Schlaf unterbricht. Viele Experten werten Nykturie erst dann als klinisch signifikant, wenn es zumindest ...
Hormonfreie Therapiemöglichkeiten
Die Menopause ist ein erwartetes Ereignis im Leben jeder Frau. Symptome in der Perimenopause können leicht, mittelgradig oder stark ausgeprägt sein. In Abhängigkeit von der Art und der ...
Zyklusstörungen bei Leistungssportlerinnen
Während die Menstruation bis vor wenigen Jahren im Sport ein absolutes Tabuthema war, sind es nun Ansätze für zyklusbasiertes Training oder Vorzeigesportlerinnen wie etwa die ...


