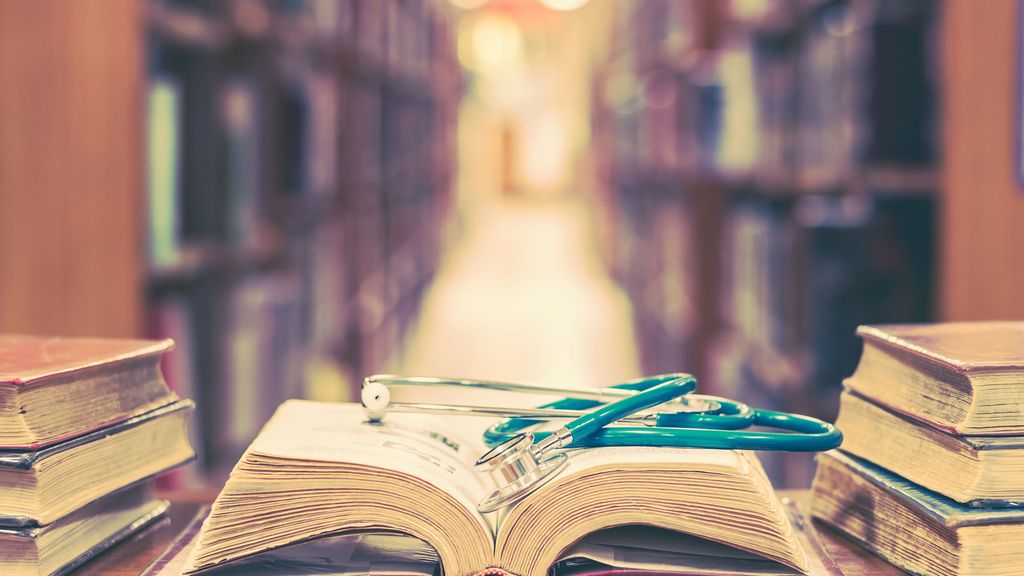
©
Getty Images/iStockphoto
Wie in einer Allgemeinpraxis kalkuliert werden muss
DAM
Autor:
Dr.<sup>in</sup> Martina Hasenhündl
Leiterin der Medizinischen<br> Fortbildungsakademie NÖ<br> E-Mail: martina.hasenhuendl@arztnoe.at
30
Min. Lesezeit
19.04.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In Ausgabe 1+2/2018 habe ich Ihnen vorgerechnet, dass ein Vollzeit-Hausarzt etwa 180 Euro pro Stunde umsetzen muss, um einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 250 000 Euro zu erzielen. Vollzeit bedeutet, dass in 42 Arbeitswochen jeweils 45 Stunden gearbeitet werden, davon etwas mehr als 30 Stunden medizinisch, bei einer offiziellen Ordinationsöffnungszeit von 20 Wochenstunden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Oft wird beispielsweise von Journalisten behauptet, dass es sich bei diesem Wert um das Einkommen handeln würde. Bis aus diesem Betrag ein „Einkommen“ wird, sind jedoch noch einige Zahlungen zu tätigen. Der Hausarzt ist derzeit nämlich noch ein freiberuflicher Arzt, der ein Honorar für seine Tätigkeit bekommt und sämtliche betrieblichen Investitionen und andere Aufwendungen davon bestreiten muss.<br /> Der Hausarzt ist Unternehmer und verwendet sein privates Geld dafür, dem öffentlichen Sozialsystem Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und in dieser Infrastruktur seine Leistung anzubieten. Und das ist teuer. Nicht selten werden mehrere Hunderttausend Euro dafür eingesetzt, die medizinisch notwendige Infrastruktur plus Ordinationseinrichtung anzuschaffen. Beim Betrieb fallen vor allem die Kosten für das Personal ins Gewicht: Man kann hier bis zu 20 % des Umsatzes inklusive aller Lohnnebenkosten und der Sonderzahlungen rechnen.<br /> In Summe verbleiben so rund 50 % des Umsatzes als Bruttoeinkommen vor Steuer in den Händen des Ordinationsbetreibers, bei 250 000 Euro Jahresumsatz sind das im Schnitt rund 125 000 Euro. Bis das Finanzamt zuschlägt und grob gerundet 50 000 Euro davon haben möchte. Somit verbleiben 75 000 Euro Nettoeinkommen für den durchschnittlichen Hausarzt. Wenn man das durch 14 teilt, dann ergibt sich ein Wert von etwa 5300 Euro pro Monat im ersten Vergleich mit einem Angestellten. Doch lässt sich ein Einkommen aus freiberuflicher Tätigkeit wirklich mit einem Einkommen von einem angestellten Arzt vergleichen? Man hat keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch, man hat keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankenstand. Und man ist für den Betrieb mit allen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen selbst verantwortlich. Diesen Unterschied kann man mit einem „Unternehmeraufschlag“ rechtfertigen. Also einen Prozentsatz, den man einem Unternehmer mehr bezahlen muss als einem Angestellten, bei grundsätzlich gleichem Arbeitsauftrag.</p> <h2>Unternehmeraufschlag gerechtfertigt</h2> <p>Dass dieser Unternehmeraufschlag existiert, zeigt uns die Praxis der Ordinationsvertretungen. Die Stundensätze laut Markt sind höher als die Stundensätze samt Lohnnebenkosten, die im Angestelltenverhältnis bezahlt werden. Die wesentlichen Gründe dafür wurden schon genannt. Was noch fehlt, ist die plausible Höhe dieses Unternehmeraufschlags. Ich bin der Ansicht, dass für den Betrieb einer freiberuflichen Hausarztpraxis mit der Verantwortung für mehrere Mitarbeiter und einem Investitionsvolumen im sechsstelligen Bereich durchaus 40 % als angemessen zu betrachten sind.<br /><br /> So betrachtet ergibt sich ein vergleichbares Nettoeinkommen von 3800 Euro pro Monat für die komplette Abwicklung der Basisgesundheitsversorgung von 2000 Menschen inklusive medizinischer Betreuung, Organisation und Verwaltung samt Investition mit der kompletten finanziellen Verantwortung für den Betrieb samt Mitarbeiter. Nun kann darüber diskutiert werden, ob das ein angemessenes Einkommen darstellt, mit dem man junge Menschen zur Arbeit als Hausärztin/Hausarzt motivieren kann.<br /> Ist diese finanzielle Struktur samt bestehender Leistungs- und Honorarkataloge überhaupt geeignet, um den Herausforderungen im System vor allem in Bezug auf die Primärversorgung zu begegnen? Mehr dazu in der kommenden Ausgabe.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Zusammenarbeit von Ärzten mit nichtärztlichen Gesundheitsberufen
Inwieweit trifft Ärzte eine Überwachungspflicht, wenn sie Tätigkeiten an Angehörige nichtärztlicher Gesundheitsberufe delegieren?
Kostenlose HPV-Impfung bis 21
Ab Februar 2023 ist die HPV-Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom vollendeten 9. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos.
Die stille Kündigung – Quiet Quitting
Das Phänomen Quiet Quitting, das das Verhalten von Mitarbeiter:innen beschreibt, die ihr Engagement in der Arbeit auf ein Minimum reduzieren, betrifft auch den Gesundheitsbereich. Wegen ...

