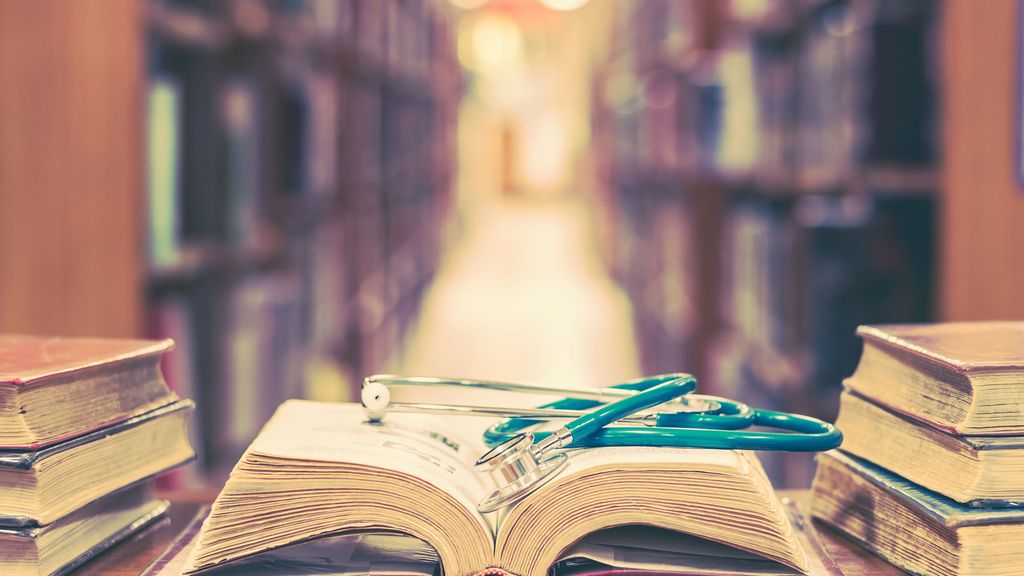
©
Getty Images/iStockphoto
Von Erfahrungen und gegenseitigem Lernen
DAM
30
Min. Lesezeit
27.04.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In seinem Buch „Lust aufs Alter“, erschienen im Falter-Verlag, publizierte Univ.-Prof. Dr. Peter Scheer seine unkonventionellen Gedanken über das Älterwerden. Im Interview nahm er Stellung zur nahenden Pensionierungswelle in der österreichischen Ärzteschaft.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><em><strong>Sehr geehrter Herr Prof. Scheer, wir haben etwas gemeinsam: das Geburtsjahr und daher auch den Zeitpunkt des Erreichens des Pensionsalters. Wenn wir uns Gedanken über die Pensionierung machen, so wissen wir, wovon wir sprechen. Sie haben 2016 unter dem Titel „Lust aufs Alter“ unkonventionelle Gedanken über das Älterwerden publiziert. Das hat in mir den Wunsch geweckt, Ihre Gedanken zur viel zitierten Pensionierungswelle in der österreichischen Ärzteschaft zu erfragen. Der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger meldet, dass 2020 ein Drittel der österreichischen Allgemeinmediziner 65 Jahre alt sein wird, 2030 werden es drei Viertel sein.<br /> P. Scheer:</strong></em> Diesbezüglich ist nicht allein die Anzahl der Pensionierungen entscheidend, sondern was die einzelnen Menschen und die Gesellschaft daraus machen. In der österreichischen Gesellschaft gibt es die furchtbare Formulierung des „wohlverdienten Ruhestands“. Diese impliziert, dass wir Ärzte, die ein wunderbares Leben im Dienste der Menschen gehabt haben und dafür in aller Regel durchaus angemessen entlohnt wurden, nun in ein Leben ohne Arbeit, in ein Gefängnis des Nichtstuns gesperrt werden, an dessen Ende der Tod steht. <br />Das ist die eigentliche Ungeheuerlichkeit. Diese Inflexibilität, die es bis vor Kurzem gab. Dass Menschen, die arbeiten wollten und konnten, zur Untätigkeit verurteilt wurden. Es darf schon so sein – wie ich in meinem Vorwort zu dem Buch „Lust aufs Alter“ schreibe –, dass man eine zweite Jugend erlebt; nur ohne Zukunft. Da aber das ganze Leben im biblischen Sinn ein „Hauch“ ist, so ist das Alter eben auch ein Hauch. Ein kurzer Moment, in dem wir Gutes für uns und andere tun. So wie ich derzeit das große Glück habe, eine Weltreise mit meiner lieben Frau zu machen, auf einem Schiff, das „Costa Luminosa“ heißt und mir schon viele helle Augenblicke beschert hat.<br />Doch eines gilt es zu bedenken: Seit der Einführung der verpflichtenden Fortbildung und der Möglichkeit, als Wahl- oder Wohnsitzarzt den Menschen weiter seine Dienste anzubieten, kann jede und jeder das machen.</p> <p><em><strong>Österreich hat so viele ausgebildete Mediziner wie noch nie, dennoch fehlt bereits jetzt schmerzlich der Nachwuchs für Hausarztstellen. <br /> P. Scheer:</strong></em> Das Wort „Hausarzt“ sollte kritisch hinterfragt werden. Denn das, was wir damit assoziieren, und das, was es ist, sind zweierlei. Es gibt nicht mehr den umfassend zuständigen und immer verfügbaren Hausarzt. Er oder sie wird von Überweisungen, Computern und durch eine weitgehende Spezialisierung verdrängt. Das Vorhaben der Politik, hierauf mit der Einrichtung von Gesundheitszentren (Neusprech, nach George Orwell, für die Versorgung Kranker) zu reagieren, scheint eine Lösung für eine flächendeckende Versorgung anzubieten.<br /> Das Leben hat sich geändert. Der Kranke informiert sich online, die Mobilität vieler Menschen ist hoch. Diese Entwicklungen zu berücksichtigen und den demografischen Wandel einzubeziehen sehe ich als Aufgabe der Politik. Sich an dieser Stelle einzubringen mag auch eine Aufgabe erfahrener Ärzte und ärztlicher Funktionäre sein.<br /><br /> <em><strong>Ich möchte diesen „Status präsens“ als Basis unserer Erörterung nehmen. Die Schuldfrage soll ausnahmsweise nicht gestellt werden. Vielmehr die Frage: Wo ist die sprichwörtliche Chance in diesem Dilemma? <br /> P. Scheer:</strong></em> Dieses Interview entsteht online. Es mag Möglichkeiten geben, wie das etwa in Ländern mit großer Flächenausdehnung und sehr entlegenen Gegenden der Fall ist oder wie es das Schweizer Modell des „Medgate“ zeigt, dass wir technologische Neuerungen sinnvoll einsetzen. Gerade auch Senioren sind internetsüchtig. Auf meiner Weltreise sehe ich, dass die Verbindung zum Netz praktisch für alle wichtig ist. Nützen wir diese Entwicklungen, machen wir es den Bayern nach, die im Bereich Telemedizin sehr weit vorne sind.</p> <p><em><strong>Die Vergeudung von Ressourcen wird in diesem Zusammenhang auch oft diskutiert. Bis gestern noch um 120 Patientenanliegen täglich bemüht gewesen, heute von der Bildfläche verschwunden. Ein über Jahrzehnte erworbener Erfahrungsschatz geht damit verloren. Österreich ist das einzige unter den vergleichbaren Ländern, in dem eine „Lehrpraxiskultur“ inexistent ist. Diese Form der einander belehrenden und miteinander lernenden Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung spielt im alpenländischen Curriculum, trotz gegenteiliger Beteuerungen der Verantwortlichen und sendungsbewussten, konsequent unermüdlichen Engagements einiger weniger, keine Rolle. Nehme ich – als Alter – mich zu wichtig, wenn ich das bemängle? Kann man Erfahrung weitergeben oder fällt das unter Bevormundung? <br /> P. Scheer:</strong></em> Univ.-Prof. Dr. Ingomar D. Mutz sagt: „Erfahrung ist das Gegenteil von Lesen.“ Erfahrung kann in die Irre führen. Deswegen haben wir die wissenschaftliche Medizin. Nehmen Sie das Beispiel des Herzinfarkts: Man hat jahrzehntelang Menschen nach Infarkt sechs Wochen ins Bett gesteckt. Die Folge war, dass viele an Thrombosen starben. Erst als dies prospektiv untersucht wurde, lernten wir, dass wir mit unserer Erfahrung Schaden anrichteten. Die Wissenschaft ist voll von solchen Ergebnissen.<br /> So gut Erfahrung einerseits ist, so wichtig erscheint mir andererseits das Voneinander-Lernen. Schaffen wir Modelle, wo ältere Ärzte gemeinsam mit jungen Kollegen Fallkonferenzen in Arztpraxen abhalten, und machen wir Ältere das kostenlos, erwarten wir keinen Dank, sondern gemeinsame Freude. Machen wir auf diese Weise psychosoziale Medizin im besten Sinn des Wortes!</p> <p><em><strong>Der drohende Versorgungsnotstand in der Primärmedizin beflügelt die Reformer. Einer der längstdienenden und auch einflussreichsten Vertreter dieser Reformer hat folgendes Credo: „Das Paradigma von der besonderen Intimität zwischen Arzt und Patient ist im Zeitalter von E-Health zu hinterfragen.“ Ich habe diese Ansage als Bedrohung und direkten Angriff auf mein Berufsverständnis empfunden. Was assoziieren Sie mit dieser Aussage? <br /> P. Scheer:</strong></em> Vielleicht beschreibt dieser „Sager“ eine Realität. Schon das zu oft zitierte „Vertrauensverhältnis“ zwischen Arzt und Patient habe ich immer anstrengend gefunden. Es ist eine Beziehung zwischen einem Dienstleister und einem, der krank ist. Romantische Beziehungen, wie sie Arthur Schnitzler darstellt, sind selten. Daher ist es keine Kränkung, wenn der Patient mehr weiß oder nachgelesen hat. Oft kann man vom Patienten etwas lernen, besonders bei seltenen Krankheiten. In dieser Situation flexibel auf die neuen Ansprüche zu reagieren ist fein und für die älteren Kollegen eine gute Übung gegen die sich von selbst einstellende Starre des Alters.</p> <p><em><strong>Jetzt muss ich aber doch nachfragen. Die „alle“ um Sie herum, für die die Verbindung zum Netz wichtig ist, sind Teilnehmer an einer Schiffsreise um die Welt. Der Sektionschef, der glaubt, mit „E-Health“ erübrige sich ein Vertrauensverhältnis, führt seine über 80-jährige Mutter ins Treffen, die sich angeblich auf ELGA freut. Wenn wir aktuellen Erhebungen glauben, um das Mutz-Zitat aufzugreifen, zum Beispiel jenen der Statistik-Austria, benützt ein Drittel der Senioren elektronische Medien, zwei Drittel tun dies nicht. Das ist eine Zweidrittelmehrheit, die hier wie eine Minderheit behandelt wird. Der Pionier der Sozial- und Meinungsforschung, inzwischen selbst neunzig Jahre alt, Prof. Ernst Gehmacher, zählt die persönliche Hausarztmedizin zum Sozialkapital älter werdender Menschen. Ich zitiere noch zwei bedeutende Männer Ihrer Zunft. Sigmund Freud mit seinem Ausspruch „Heilung durch Liebe“, und Michael Balint, der von der „Droge Arzt“ gesprochen hat. <br /> Nach 36 Jahren Arbeit als Landarzt habe ich den Eindruck, dass diese Reformbestrebungen gerade jene zurücklassen, die der mitmenschlichen Aufmerksamkeit besonders bedürfen. Die Vorstellung, dass ein Problem, in diesem Fall "Offliner“, durch Benennen verschwindet, kann doch nicht zutreffen. Was meinen Sie dazu? <br />P. Scheer:</strong></em> Da haben Sie wohl recht. Natürlich sind die „Offliner“ die Mehrheit. Mir geht es vor allem darum, dass die Politik und das Gesundheitsministerium Lösungen anzubieten versuchen, um der wachsenden Probleme Herr zu werden. Das sind die Gesundheitszentren und die wohnortnahen Versorgungsmodelle. Diese sollen so unbürokratisch wie möglich und so ausführlich wie nötig den Menschen Hilfe anbieten. Das Modell, das im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau seit fast 20 Jahren angeboten wird (mit Sozialarbeit, Hausbesuchen, Lehrpraxis, kompetenten Mitarbeitern in psychosozialen Fragen) könnte längst österreichweit umgesetzt werden. Dass es bisher ein Einzelfall ist, ist die „Schuld“ vieler Beteiligter.<br /> Es besteht kein Zweifel: Der Arzt des Vertrauens soll greifbar sein. Das wird verhindert durch Partikularinteressen; Ökonomie im Gesundheitswesen, die sich immer als „Sparen“ ausgibt und das ebenso wenig ist wie das Vorgehen der EU gegenüber Griechenland; und allem, was der Volkswirtschaftler Mathias Binswanger in seinem Buch „Sinnlose Wettbewerbe“ beschreibt. Da geht es darum, dass Ökonomie und Markt die falschen Ideen für das Gesundheitswesen sind. Stattdessen ist die Leitdifferenz „gesund/krank“ – nicht „Geld/Schulden“. Wenn das begriffen ist, wird die Leistung des Hausarztes entsprechend gewürdigt und sicher angeboten werden können.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Präpartale Stillberatung für ein erfolgreiches Stillen
Im Jahr 1992 wurde von der WHO gemeinsam mit UNICEF die «Baby Friendly Hospital Initiative» (BFHI) begründet. Das Anliegen war, die Grundbedingungen für das Stillen weltweit zu ...
Zusammenarbeit von Ärzten mit nichtärztlichen Gesundheitsberufen
Inwieweit trifft Ärzte eine Überwachungspflicht, wenn sie Tätigkeiten an Angehörige nichtärztlicher Gesundheitsberufe delegieren?
Die stille Kündigung – Quiet Quitting
Das Phänomen Quiet Quitting, das das Verhalten von Mitarbeiter:innen beschreibt, die ihr Engagement in der Arbeit auf ein Minimum reduzieren, betrifft auch den Gesundheitsbereich. Wegen ...


