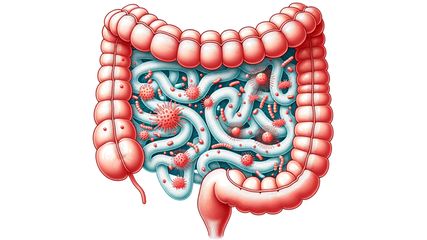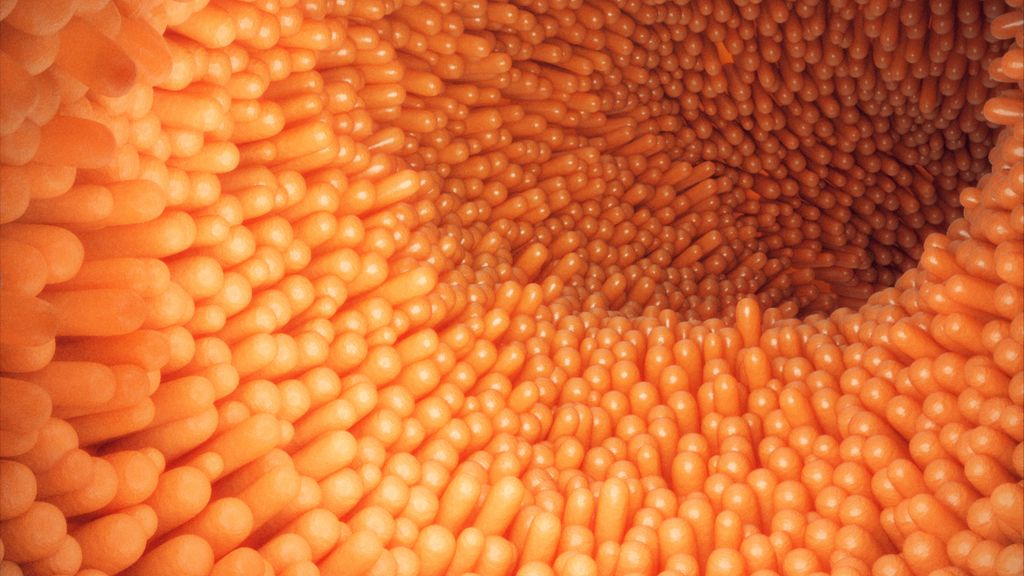
©
Getty Images/iStockphoto
Neue Hinweise zur Pathogenese von Morbus Crohn
<p class="article-intro">Eine aktuelle Studie der Universität Hohenheim und ihrer Kooperationspartner off enbart Zusammenhänge in der Entstehung von Autoimmunerkrankungen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Ausschlag, Fieber, Gelenkschmerzen, Entzündungen im Darm – das familiäre kälteinduzierte autoinflammatorische Syndrom (FCAS) ist zwar äusserst selten, doch für die Betroffenen sehr belastend. Die Patienten weisen eine Genmutation auf, wodurch die Funktion eines Proteins namens NLRP12 gestört ist, das normalerweise Entzündungsprozessen entgegenwirkt. So viel war bereits bekannt. Nun haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim in Kooperation mit französischen Kollegen und der Universität Tübingen nachgewiesen, dass an dem Vorgang ein weiteres Protein, das sogenannte NOD2, beteiligt ist – eine Erkenntnis, welche die Forschung zu entzündlichen Darmerkrankungen ein wesentliches Stück vorantreibt.</p> <h2>Gleichgewicht zwischen Toleranz und Abwehr gestört</h2> <p>NOD2 spielt im Immunsystem eine wichtige Rolle: Das Protein erkennt einerseits Fremdstoffe wie eingedrungene Bakterien oder Viren und reguliert andererseits die Darmbakterien. «In unserer Arbeit konnten wir feststellen, dass NOD2 durch das Protein NLRP12 beeinflusst wird», erklärt Prof. Dr. Thomas Kufer, Immunologe an der Universität Hohenheim. Diese Erkenntnis sei neu: «Im gesunden Organismus wird NOD2 von NLRP12 abgebaut. Das fördert die Toleranz gegenüber Mikroorganismen, sodass die nützlichen Darmbakterien nicht angegriffen werden. Dies können bestimmte Krankheitserreger jedoch auch ausnutzen – die Gefahr einer Infektion mit pathogenen Darmbakterien steigt.»<br /> Wenn bei einer Mutation, wie im Falle der seltenen Erbkrankheit FCAS, NLRP12 seine Funktion verliert, dann spricht der Organismus stärker auf NOD2-Antworten an. Die Folge: Der Toleranzmechanismus funktioniert schlechter. «Es entstehen Immunzellen, die verstärkt Entzündungen hervorrufen können.» Ein Effekt, der bei entzündlichen Darmerkrankungen eine grosse Rolle spielt.</p> <h2>Baustein zum Verständnis entzündlicher Darmerkrankungen</h2> <p>Um diesen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, hat das Team um Prof. Kufer in vitro gearbeitet. Die Forscher setzten menschliche Zellkulturen aus der HEK-293T-Zelllinie ein, in denen sie die Funktion der untersuchten Proteine analysierten. Hauptkoordinator der Studie war Dr. Mathias Chamaillard vom INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) und dem Institut Pasteur in Lille. In seiner Arbeitsgruppe wurden Versuche mit gentechnisch veränderten Mäusen durchführt. Die Partner an der Sorbonne und in Orleans haben Patientenkohorten zur Verfügung gestellt und die Wissenschaftler der Universität Tübingen ihre Expertise bei bakteriellen Infektionen.<br /> «Die Erkenntnisse, die wir aus unserer Studie gewonnen haben, sind von medizinischer Relevanz. Auch zum Beispiel bei der entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn spielen sie eine wichtige Rolle», betont Kufer. «Wir hoffen, dass es zur Erklärung dieser Erkrankungen beiträgt, wenn wir die Funktionsweise der beteiligten Proteine besser verstehen. Nur so können wir neue Behandlungswege für diese Krankheiten finden.» (red)</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Universität Hohenheim
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>Normand S et al.: Proteasomal degradation of NOD2 by NLRP12 in monocytes promotes bacterial tolerance and colonization by enteropathogens. Nat Commun 2018; 9: 5338</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Einfluss der Dünndarmfehlbesiedelung bei Patient:innen mit CED
Abdominelle Beschwerden sind ein häufiges Problem, mit dem man in Klinik und Praxis konfrontiert wird. Die Differenzialdiagnosen hierzu können vielfältig sein. Eine bakterielle ...
Therapie des Morbus Crohn: bewährte Konzepte und neue Strategien
Welche Behandlungsziele haben Ärzt:innen, die Patient:innen mit Morbus Crohn (MC) behandeln, und haben die Betroffenen die gleichen Ziele? Lassen sich die Therapieziele erreichen, wenn ...
Therapie des Morbus Crohn: Biologikabehandlung optimieren
Prof. Dr. med. Iris Dotan, Rabin Medical Center, Petah Tikva, und Universität Tel Aviv (Israel), zeigte im Rahmen des 9. Postgraduate Course des IBDnet Möglichkeiten auf, wie die ...