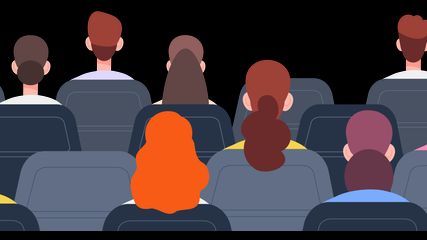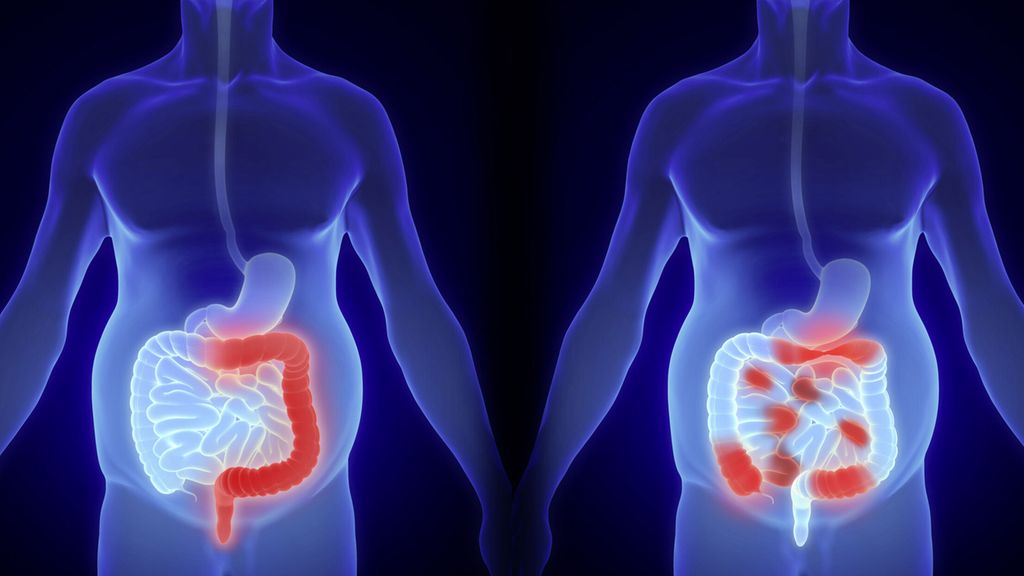
Neue Antikörperstudien zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
Bericht: Reno Barth
Medizinjournalist
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen nehmen jedes Jahr einen wichtigen Platz im Programm der UEG Week ein. Auch 2020 wurden zahlreiche Studien zu Wirksamkeit und Sicherheit verschiedener therapeutischer Antikörper in dieser Indikation präsentiert.
Adalimumab: SERENE-UC
Der Anti-TNF-Antikörper Adalimumab (ADA) ist in der Therapie der Colitis ulcerosa (CU) seit Jahren etabliert, wirksam und verträglich.1, 2 In der Studie SERENE-UC wurde die Wirksamkeit höherer Dosen von Adalimumab in dieser Indikation untersucht. Die mit fixen Dosierungen erreichten Ergebnisse wurden bereits präsentiert. Sie zeigen eine numerisch höhere Zahl von Respondern unter höheren Dosierungen, die Ergebnisse waren jedoch nicht signifikant.3, 4 In einem zusätzlichen Arm wurde die Wirksamkeit einer auf Monitoring der Wirkstoffspiegel basierenden Therapie untersucht. Die Ergebnisse dieses exploratorischen Arms wurden nun im Rahmen der virtuellen UEG Week 2020 präsentiert.
SERENE-UC war eine Phase-III-Studie, in die erwachsene Patienten mit moderater bis schwerer aktiver CU eingeschlossen wurden.5 Nach Ende der Induktionsphase wurden alle Patienten im Verhältnis 2:2:1 rerandomisiert und erhielten über 55 Wochen entweder ADA 40mg wöchentlich (40EW), ADA 40mg alle zwei Wochen (40EOW) oder das exploratorische «Therapeutic drug monitoring»(TDM)-Regime. Ausserdem wurde den Patienten im TDM-Arm in den Wochen acht und zehn jeweils ADA 40mg verabreicht. Danach konnte die Dosis anhand definierter Kriterien, nämlich eines Rectal Bleeding Subscores ≥1 und/oder einer ADA-Serumkonzentration <10μg/ml, eskaliert werden. Da es sich um eine exploratorische Strategie handelte, erfolgte die Auswertung deskriptiv.
Insgesamt 757 von 852 Patienten schlossen die Induktionsphase der Studie ab und wurden in Woche 8 erneut randomisiert, wobei 151 in den TDM-Arm kamen. In Woche 52 hatten im TDM-Arm 36,5% (n=27/74) der Responder aus Woche 8 eine klinische Remission erreicht, während 23,2% (35/151) der gesamten Gruppe und 10,4% (8/77) der Non-Responder in klinischer Remission waren. Diese Ergebnisse sind mit den bereits publizierten Resultaten von SERENE-UC vergleichbar. Dabei nahm die Zahl der Responder, bei denen die ADA-Dosis auf einmal wöchentlich erhöht wurde, über die Dauer der Studie zu. Letztlich wurde bei 83% die Dosis erhöht. Damit wurde mit allen eingesetzten Dosierungen zu Woche 52 ein ADA-Spiegel über 10μg/ml erreicht. Bei 46 der 71 Patienten (65%), bei denen die Dosis eskaliert wurde, war ein zu niedriger ADA-Spiegel im Serum der Treiber der Eskalation. Das Sicherheitsprofil im TDM-Arm war konsistent mit den Beobachtungen in den anderen beiden Armen der Studie. Die Rate an Infektionen unter Therapie lag bei 33,8%, die der schweren Infektionen bei 2%. Es traten keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale auf.
Der präsentierende Autor Jean-Frederic Colombel von der Icahn School of Medicine am Mount-Sinai-Krankenhaus in New York bezeichnet das Ergebnis als enttäuschend. Zwar sei die Gesamtexposition gegenüber dem Biologikum im TDM-Arm etwas geringer gewesen, doch wurde keinerlei Überlegenheit im Hinblick auf die Wirksamkeit beobachtet. Aufgrund der Randomisierung in Woche 8 sei es nicht möglich, zu untersuchen, ob Patienten mit bestimmten Charakteristika von einer Monitoringstrategie profitieren.
Vedolizumab: Wirkstoffspiegel korrelieren mit Wirkung
Daten zum Monitoring von Wirkstoffspiegeln wurden auch für den Integrin-Antagonisten Vedolizumab (VDZ) präsentiert.6 Die retrospektive Kohortenstudie ERELATE wurde in neun tertiären Zentren in sechs Ländern durchgeführt. Die Daten wurden gepoolt aus klinischen Kohorten von Patienten mit Morbus Crohn (MC) oder CU, die mit intravenösem Vedolizumab behandelt wurden. In den Wochen 14, 26 und 52 wurden klinische, endoskopische und biologische Remissionsdaten, basierend auf den in den Zentren üblichen Definitionen von Remission, gesammelt. Auf Basis eines pharmakokinetischen Modells7 wurden anhand von Dosierung, Körpergewicht und Albuminkonzentration die Serumspiegel von VDZ simuliert. Ziel der Studie war es, die VDZ-Spiegel mit den erreichten Remissions-Endpunkten zu korrelieren und Grenzwerte für eine gute Wirksamkeit zu definieren. Von einem Teil der Studienpopulation waren Messungen der VDZ-Serumspiegel verfügbar. Diese wurden zur Kontrolle und Verfeinerung des Modells herangezogen und zeigten eine gute und signifikante Korrelation mit den errechneten Spiegeln über die gesamte Dauer der Studie.
In die Studie wurden insgesamt 695 Patienten (304 CU, 391 MC) eingeschlossen. Für die CU lagen die klinischen Remissionsraten in den Wochen 14, 26 und 52 bei 55,2%, 52,3% und 39,8%, endoskopische Remissionen wurden zu 59,7%, 50,9% und 42,4%, tiefe Remissionen zu 41,7%, 30,6% und 23,7% erreicht. Ähnliche Werte wurden bei den MC-Patienten beobachtet. Wo keine endoskopischen Daten zur Verfügung standen, war tiefe Remission definiert durch die Kombination von klinischer Remission und niedrigem CRP. ERELATE zeigte eine signifikante Beziehung zwischen Exposition gegenüber VDZ und Ansprechen, die bei Colitis ulcerosa deutlicher ausgeprägt war als bei Morbus Crohn. VDZ-Konzentrationen von 30,8 und 33,8μg/ml in Woche 6 sowie 16,6 und 14,4μg/ml in Woche 14 waren assoziiert mit klinischer bzw. tiefer Remission in Woche 52.
«Die Daten bestätigen nun in einer grossen Kohorte die bereits in der Zulassungsstudie GEMINI gemachte Beobachtung, dass die Vedolizumab-Konzentration im Serum signifikant mit den klinischen Outcomes korreliert», so Studienautor Niels Vande Casteele von der University of California San Diego anlässlich der Präsentation der Daten. Adäquate Konzentrationen während der Induktionsphase dürften ein wichtiger Prädiktor für sowohl den kurz- als auch den langfristigen Therapieerfolg sein.
Medikamentöse Rezidivprophylaxe nach Chirurgie
Ungeachtet der Fortschritte in der medikamentösen Therapie sind bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen nach wie vor bei vielen Patienten chirurgische Interventionen indiziert. Rezidivierende Erkrankungen nach solchen Interventionen stellen ein erhebliches Problem dar. Daher wird bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko versucht, mit medikamentösen Massnahmen postoperative Rezidive zu verhindern. «Als besonders gefährdet gelten», so Jeanine Arkenbosch vom Erasmus Medical Center in Amsterdam, «Raucher, Patienten mit penetrierender Erkrankung und/oder nach Reresektion.» Arkenbosch präsentierte im Rahmen der digitalen UEG Week die Ergebnisse einer von der Dutch Initiative on Crohn and Colitis (ICC) durchgeführten, multizentrischen Kohortenstudie, mit dem Ziel, einen klinischen Managementalgorithmus auf Basis dieser Risikofaktoren auf seine Tauglichkeit zu untersuchen.8
In die Studie wurden insgesamt 120 Patienten mit Morbus Crohn in 14 Zentren eingeschlossen, die sich ileokolischen Resektionen unterziehen mussten. Der Algorithmus definiert Patienten mit mindestens einem der zuvor genannten Risikofaktoren als Hochrisikogruppe. Empfohlen wird, bei Hochrisikopatienten innerhalb von acht Wochen nach der Resektion eine Therapie mit Thiopurinen oder Anti-TNF-Biologika zu beginnen. Bei Patienten mit niedrigem Risiko (also bei fehlenden Risikofaktoren) wird der Beginn einer medikamentösen Therapie allenfalls anhand endoskopischer Befunde empfohlen. Eine Kontrollendoskopie wurde sechs Monate nach der Resektion durchgeführt. Patienten mit inkompletter Resektion makroskopischer Inflammationsherde waren aus der Studie ausgeschlossen. Endpunkt waren klinische oder endoskopische Rezidive.
In die Gruppe mit niedrigem Risiko fielen 51 (43,2%) der Patienten, in die Hochrisikogruppe 67 Patienten (56,8%). In der Niedrigrisikopopulation erhielten 69,8% (n=30) keine Prophylaxe, wobei die Empfehlungen des Algorithmus befolgt wurden. In der Hochrisikopopulation wurden die Empfehlungen des Algorithmus nur unzureichend befolgt, zumal lediglich 48,1% (n=26) nach sechs Monaten eine medikamentöse Rezidivprophylaxe erhielten und 51,9% damit untertherapiert waren. Diese Entscheidung wurde allerdings bei einem erheblichen Teil der Hochrisikopatienten aufgrund des Patientenwunsches getroffen. Zum Zeitpunkt der Auswertung hatten 98 Patienten die Kontrollvisite nach sechs Monaten erreicht. Dabei zeigten sich für Hochrisiko- (n=7) und Niedrigrisikopatienten (n=14) mit 13,7% resp. 20,9% (p=0,313) vergleichbare klinische Rezidivraten. Eine Koloskopie nach sechs Monaten wurde bei 83/98 Patienten (84,7%) durchgeführt und zeigte endoskopische Rezidive bei 21 (52,5%) Niedrigrisiko- und 28 (65,1%) Hochrisikopatienten. Dabei wurden in beiden Gruppen bei Patienten, die eine medikamentöse Rezidivprophylaxe erhielten, niedrigere Rezidivraten gefunden. So zeigten Patienten mit niedrigem Risiko, die gemäss dem Algorithmus keine Prophylaxe erhielten, eine endoskopische Rezidivrate von 53,3%, während die Rezidivrate unter Prophylaxe bei 38,5% lag. In der Hochrisikopopulation lag die Rezidivrate bei algorithmuskonformer Verschreibung einer Prophylaxe bei 38,5% im Vergleich zu 64% ohne Prophylaxe.
«Die Daten zeigen also», so Arkenbosch, «dass zumindest in den beteiligten Zentren die Hälfte der Patienten, die eine Prophylaxe erhalten sollten, keine Prophylaxe bekommt und dass dies mit höheren Rezidivraten verbunden ist.» Im Gegensatz dazu wird die Empfehlung der endoskopischen Kontrolle nach sechs Monaten weitgehend eingehalten.
Ustekinumab wirksam gegen extraintestinale Manifestationen
Die Wirksamkeit von Ustekinumab, einem humanen monoklonalen Antikörper gegen die Zytokine Interleukin 12 (IL-12) und Interleukin 23, in der Indikation MC wurde in den Studien UNITI-1/2 demonstriert.9 Ustekinumab erwies sich auch als wirksam in der Behandlung der Psoriasisarthritis. Bislang nicht in Studien untersucht wurden die Effekte des Antikörpers auf die extraintestinalen Manifestationen (EIM) bei MC. Nun liegt wenigstens eine Post-hoc-Analyse der UNITI-Studien zur Wirkung von Ustekinumab auf EIM bei Patienten mit moderater bis schwerer Erkrankung vor.10
In die Analyse wurden 914 Patienten für die Induktions- und 260 Patienten für die Erhaltungsphase aufgenommen. Erhoben wurden die Prävalenz und die Abheilung bestehender EIM sowie das Auftreten neuer EIM wie analer Manifestation, von Stomatitis aphthosa, Arthritis/Arthralgie, Erythema nodosum, Fieber, Iritis/Uveitis, primär sklerosierender Cholangitis und Pyoderma gangraenosum in den Wochen 6 und 52 im Vergleich zum Ausgangswert. EIM wurden mit dem Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) gemessen.
Die Auswertung zeigte, dass Ustekinumab in der Induktionstherapie zu einem hohen Ansprechen der EIM führte und dass diese Wirkung bis Woche 52 erhalten blieb. Bei Einschluss in die Studie wurden bei 66,4% der Patienten (625/941) insgesamt 821 EIM festgestellt. Bei 40,8% dieser EIM kam es in der Induktionsphase der UNITI-Studien zur Abheilung, im Gegensatz dazu traten bei 81 der 941 Patienten De-novo-Manifestationen von EIM auf. Insgesamt ging die Prävalenz von EIM während der Induktionsphase zurück. Die Effekte auf die verschiedenen EIM waren unterschiedlich und zum Teil (z.B. für Arthritis/Arthralgien) hochsignifikant. Bei anderen EIM wurde Signifikanz verfehlt, wobei in einigen Fällen die Zahlen zu gering für statistisch aussagekräftige Resultate waren. In der Maintenancephase waren die Therapieerfolge weitgehend stabil.
Gemischte Resultate für Etrolizumab
Ein Rückschlag wird aus dem Entwicklungsprogramm für den Integrin-α4β7- und -αEβ7-Inhibitor Etrolizumab gemeldet. Die duale Integrinhemmung soll einerseits die Migration von Immunzellen, andererseits aber auch deren inflammatorische Effekte auf die Darmschleimhaut begrenzen.
Der Antikörper wurde in einem Studienprogramm zu entzündlichen Darmerkrankungen mit acht randomisierten, kontrollierten und offenen Studien und mehr als 3100 Patienten untersucht. Die bisher berichteten Ergebnisse sind gemischt. Und das trifft auch auf die nun präsentierten Resultate der Phase-III-Studie HICKORY zu, die Etrolizumab in einer Population von mit Anti-TNF vorbehandelten Patienten in der Induktions- und Erhaltungstherapie der Colitis ulcerosa untersucht hat. Rund die Hälfte der Patienten waren primäre oder sekundäre Anti-TNF-Non-Responder. In der Induktionsphase wurden die Patienten entweder in einem offenen oder in einem placebokontrollierten Arm behandelt. Im offenen Arm wurde ein gutes Ansprechen beobachtet und publiziert.11 Responder der beiden Studienarme wurden in Woche 14 randomisiert und begannen eine Erhaltungstherapie mit Etrolizumab oder Placebo. Primärer Endpunkt der Induktionsphase war eine Remission in Woche 14. Primärer Endpunkt der Maintenance-Studie war die Remission in Woche 66 bei Patienten mit klinischem Ansprechen in Woche 14.
Der primäre Endpunkt der Induktionsstudie wurde erreicht. In Woche 14 hatten 18,5% der Etrolizumab- und 6,3% der Placebopatienten eine Remission erreicht (p=0,0033). Zu Woche 66 war kein Vorteil für Etrolizumab im Vergleich zu Placebo mehr nachweisbar, mit Remissionsraten von 24,1% vs. 20,2% (p=0,4956). Allerdings zeigte sich eine Überlegenheit von Etrolizumab hinsichtlich endoskopischer Verbesserung, endoskopischer Remission und histologischer Remission in Woche 66. Etrolizumab wurde gut vertragen, mit einer Nebenwirkungsrate auf Placeboniveau sowohl in der Induktions- als auch in der Erhaltungstherapie.12
Quelle:
United European Gastroenterology Week Virtual 2020: Sessions «IBD Clinical I & II» und «Late-breaking abstract: Clinical IBD highlights» vom 10. und 11. Oktober 2020
Literatur:
1 Reinisch W et al.: Gut 2011; 60: 780-7 2 Sandborn WJ et al.: Gastroenterology 2012; 142: 257-65 3 Panés J et al.: UEG Journal 2019; 7(Suppl 8): OP216 4 Colombel JF et al.: ECCO 2020; 14(Suppl 1): S001 5 Colombel JF et al.: UEGW 2020; Abstract P0480 6 Vande Casteele N et al.: UEGW 2020; Abstract P0503 7 Rosario M et al.: Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 188-202 8 Beelen EMJ et al.: UEGW 2020; Abstract P0627 9 Feagan BG et al.: N Engl J Med 2016; 375: 1946-60 10 Narula N et al.: UEGW 2020; Abstract P0621 11 Peyrin-Biroulet L et al.: United European Gastroenterol J 2017; 5: 1138-9 12 Peyrin-Biroulet L et al.: UEGW 2020; Abstract LB08
Das könnte Sie auch interessieren:
Das kardiovaskuläre Risiko von IBD-Patienten
Eine aktive IBD erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, während bestehende kardiovaskuläre Probleme die Wahl der Medikation erschweren. Das Ziel ist es, die richtige Balance ...
Aktuelle Studien aus Gastroenterologie und Hepatologie
Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie (SSG) und der Swiss Association for the Study of the Liver (SASL) vom 11. bis 12. September 2025 in Interlaken ...
Neues aus der Gastroenterologie
Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...