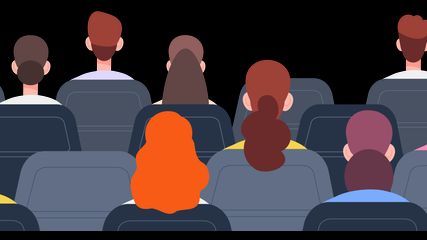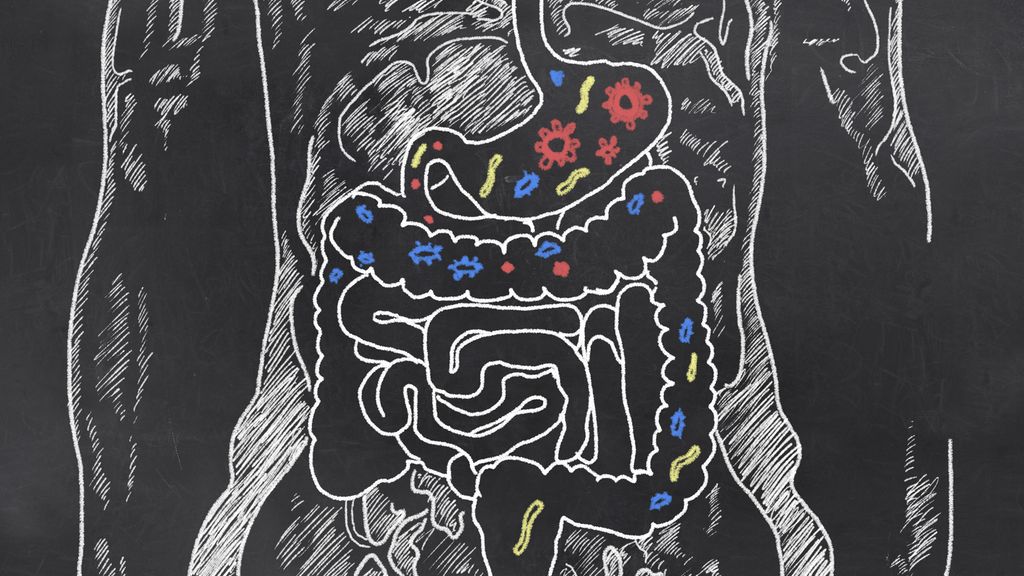
©
Getty Images/iStockphoto
Missbrauch und Darm
Urologik
Autor:
Prof. Dr. Max Wunderlich, FRCS
FA für Chirurgie</p> <p>E-Mail: galaxy.wumax@gmail.com
30
Min. Lesezeit
14.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Sogenannte funktionelle intestinale Beschwerden haben nicht selten einen psychischen Hintergrund, der mit einem sexuellen Missbrauch in der Vergangenheit assoziiert sein kann. Dies sollte in Diagnostik und Therapie mehr Berücksichtigung finden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Der sexuelle Missbrauch ist häufiger als geahnt und betrifft vor allem Frauen.</li> <li>Bei „funktionellen“ intestinalen Erkrankungen sollte stets auch an Missbrauch in der Vergangenheit gedacht werden.</li> <li>Diese Zusammenhänge gebieten äußerste Zurückhaltung in Bezug auf Operationen.</li> <li>Insbesondere die Enddarmobstipation (ODS) erfordert eine entsprechende psychische Exploration und eine konsequente Physiotherapie.</li> </ul> </div> <p>Den Organen des Beckenbodens gemeinsam sind die Stütze des Beckenbodens und dessen Innervation. Handfeste pathomorphologische Veränderungen wie Tumoren und Prolaps sind zweifelsfrei Domäne operativer Interventionen von Urologie, Gynäkologie und Koloproktologie (als Spezialgebiet der Viszeralchirurgie). Wesentliche proktologische Beschwerden wie Enddarmentleerungsstörung (obstruktives Defäkationssyndrom, ODS) und anorektale Schmerzen ohne fassbares Substrat werden im ärztlichen Jargon meistens den sogenannten funktionellen Erkrankungen zugeordnet. Wiewohl diese einer eingehenden Diagnostik bedürften, verleiten sie doch allzu oft zu voreiligen chirurgischen Reaktionen, wenn man zum Beispiel in Hämorrhoiden irrigerweise die Ursache für ein anales Schmerzsyndrom sieht. Dementsprechend enttäuschend kann das Ergebnis dieser unnötigen Operationen sein.</p> <p>Gerade Symptome im Bereich des Intestinaltrakts können Ausdruck von bewussten oder unbewussten psychischen Problemen sein, die in nicht geringem Maße auf ein Trauma in Kindheit oder Jugend zurückgehen – oft in Form eines sexuellen Missbrauchs. Der Zusammenhang zwischen Psyche, ZNS und Darm wurde mit dem Konzept der „brain-gut axis“ schon vor 40 Jahren postuliert.<sup>1, 2</sup> Jüngere Untersuchungen des Gehirns mittels funktioneller MRT bestätigen bildgebend den Einfluss von Symptomen des RDS (Reizdarmsyndrom) auf bestimmte zerebrale Regionen.<sup>3</sup></p> <p> </p> <h2>Sexueller Missbrauch – Inzidenz und Folgen</h2> <p>Der sexuelle Missbrauch macht 11 % der vielfältigen Formen von Misshandlung aus.<sup>4</sup> Er betrifft unter den betroffenen Kindern und Jugendlichen 73 % zwischen dem 5. und 14. Lebensjahr.<sup>5</sup> Die Opfer sind zumeist weiblich, im Verhältnis 6:1.<sup>5</sup> Die „Täter“ bei sexuellem Missbrauch gegenüber Frauen sind in 98 % der Fälle Männer,<sup>6</sup> von denen 75 % im Kreis von Familie und Bekannten zu finden sind.<sup>7</sup> Die Inzidenz des sexuellen Missbrauchs in Österreich beträgt 13 % .<sup>8</sup> Der frühe sexuelle Missbrauch unterliegt oft dem „Sleeper-Effekt“<sup>5</sup> – das Trauma der Jugend wird vergessen, verdrängt, daher von den einst Betroffenen nicht mit später auftretenden intestinalen Beschwerden in Verbindung gebracht. Auch für die behandelnden Ärzte ist diese Assoziation nur sporadisch eine naheliegende.</p> <p>Die langfristigen Auswirkungen des Missbrauchs in der Vergangenheit reichen von psychischen Krankheiten über verschiedenste Schmerzmanifestationen bis zu chronischen intestinalen Beschwerden (Tab. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Urologik_Uro_1704_Weblinks_s34_1.jpg" alt="" width="992" height="817" /></p> <p>Bei Patientinnen mit intestinalen Beschwerden, meist RDS, sind nach sexuellem Missbrauch rein funktionelle Probleme (53 % ) signifikant häufiger als manifeste organische Erkrankungen des Verdauungstraktes (37 % ).<sup>9</sup> Allerdings bleibt die Ursache meist lange Zeit unentdeckt – einerseits, weil zu wenig danach gefragt wird,<sup>10</sup> andererseits, weil die Betroffenen selbst sie beharrlich verheimlichen. Hieraus resultieren zahlreiche Konsultationen („doctor shopping“), wiederholte Untersuchungen, insbesondere Endoskopien, und unnötige operative Eingriffe.<sup>9</sup></p> <h2>Enddarmobstipation</h2> <p>Für die Enddarmobstipation, in der Literatur nunmehr eingebürgert als ODS, existieren zahlreiche Synonyma: Neben Beckenbodendyssynergie, Animus, „pelvic floor outlet syndrome“ spiegelt der Begriff der paradoxen Puborectaliskontraktion den ursächlichen Mechanismus am besten wider.</p> <p>Vom ODS sind in großer Mehrzahl Frauen betroffen, einerseits wegen der anatomischen Gegebenheit des dünnen Septum rektovaginale, andererseits wegen der hohen Inzidenz einer Anamnese von sexuellem Missbrauch. Die Defäkation wird durch die gleichzeitige, somit paradoxe Kontraktion des Musculus puborectalis behindert; der wiederholte Druckanstieg im Rektum weitet dessen Vorderwand allmählich zu einer Rektozele aus (Abb. 1). Schließlich folgt die Intussuszeption des mittleren in das untere Rektumdrittel (Abb. 2). Die in den sensiblen Analkanal ragende Rektummukosa wird naturgemäß als Stuhl interpretiert, den man verzweifelt herauszupressen versucht. Das Gefühl der analen Blockierung, der Eindruck unvollständiger Entleerung und frustrane Pressversuche werden zusammengefasst als „Trias des AMP“ (anteriorer Mukosa-Prolaps, der eigentlich nur ein Deszensus der Mukosa ist). Diese nur während der Defäkation auftretenden morphologischen Veränderungen werden mittels Defäkografie objektiviert (Abb. 3).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Urologik_Uro_1704_Weblinks_s34_2.jpg" alt="" width="2148" height="767" /></p> <p>So nahe es auch läge, diese „Verkrampfung“ des Beckenbodens mit einem früheren Missbrauch zu assoziieren, wird kaum eine Sexualanamnese erhoben. Geschieht dies doch, dann signifikant häufiger bei weiblichen Patienten als bei männlichen, und in erster Linie sind es Ärztinnen, die das Thema ansprechen.<sup>10</sup> Begründet wird der häufige Verzicht der Ärzte auf Fragen nach sexuellem Missbrauch mit zu wenigen Kenntnissen oder damit, dass dieser keine Bedeutung habe. Zu wenig Zeit während der Konsultation zu haben spielt dagegen keine Rolle.<sup>10</sup></p> <p>Wenn es sich bei den geschilderten Phänomenen des ODS möglicherweise um die physische Reaktion auf ein weit zurückliegendes Trauma der Psyche handelt, ist zu bedenken, dass eine operative Behebung von Rektozele und Intussuszeption als erster Schritt eine inadäquate, weil mechanistische Annäherung an das Problem darstellt, weit entfernt von einer kausalen Therapie. Vielmehr sollten solche Patientinnen zuallererst einer konservativen Therapie zugeführt werden. Erfolg ist oft schon gegeben mit der Erklärung der Situation anhand von Skizzen und der Erleichterung des Stuhlgangs mittels milder laxierender Suppositorien oder Klistieren.</p> <p>Spätestens bei hartnäckig persistierender Enddarmobstipation mit hohem Leidensdruck ist die Exploration bezüglich eines sexuellen Missbrauchs angezeigt. Der nächste therapeutische Schritt ist die Beckenbodenreedukation mittels Biofeedback, um die gezielte Erschlaffung der quer gestreiften Sphinktermuskulatur zu erlernen.<sup>11</sup> Zukünftige Behandlungskonzepte bei ODS und anorektalen Schmerzsyndromen sollten – ähnlich der Therapie des RDS – auch eine Psychotherapie integrieren, meist mit medikamentöser Unterstützung (Antidepressiva etc.).<sup>3</sup></p> <p>Operationen können, wenn überhaupt, bestenfalls zur Ergänzung der konservativen Therapie angeboten werden – mit einer präoperativen Aufklärung, die tunlichst keine vollmundige Garantie für eine Besserung gibt. Das chirurgische Spektrum reicht von der simplen Exzision der lockeren ventralen Rektumschleimhaut (anteriores Mukosa-Stripping) bis zur transabdominellen Rektopexie. Kritisch zu sehen ist die nicht ohne Nonchalance propagierte Klammernahtmethode STARR („Stapled TransAnal Rectal Resection“), welche aufgrund der resultierenden Verengung des Rektums und der fallweisen, nicht vorhersehbaren Beeinträchtigung der Sphinkterfunktion eine anale Inkontinenz wie auch andere Komplikationen nach sich ziehen kann.<sup>12</sup></p> <p>Unmissverständliches Anliegen dieser Arbeit ist es, die wünschenswerte Sensibilität für den Zusammenhang zwischen einem möglichen sexuellen Missbrauch in der Vergangenheit und den aktuellen Symptomen von Patientinnen und Patienten zu erwecken. Sobald der Gedanke an einen Missbrauch aufkommt, sollte mit entsprechender Einfühlsamkeit nach diesem gefragt werden, um Betroffene gegebenenfalls einer professionellen Physio- und Psychotherapie zuzuführen. Auch sollten solche Überlegungen vor der Indikationsstellung für Operationen bei „funktionellen“ Problemen im kleinen Becken berücksichtigt werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Moser G: Funktionelle gastrointestinale Störungen. Wien Med Wochenschr 2006; 156: 435-40 <strong>2</strong> Engel GL: The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977; 196: 129-36 <strong>3</strong> Drossman DA: Abuse, trauma and GI illness: Is there a link? Am J Gastroenterol 2011; 106: 14-25 <strong>4</strong> Emery RE, Laumann-Billings L: An overview of the nature, causes, and consequences of abusive family relationships. Am Psychol 1998; 53: 121-35 <strong>5</strong> Egle UT et al.: Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. Stuttgart: Schattauer, 2016 <strong>6</strong> Fergusson DM, Mullen PE: Childhood sexual abuse: an evidence based perspective. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 1999 <strong>7</strong> Bange D: Die dunkle Seite der Kindheit. Sexueller Mißbrauch an Mädchen und Jungen. Ausmaß – Hintergründe – Folgen. Köln: Volksblatt Verlag, 1992 <strong>8</strong> Statistik Austria 2014 <strong>9</strong> Drossman DA: Sexual and physical abuse and gastrointestinal illness. Scand J Gastroenterol Suppl 1995; 208: 90-6 <strong>10</strong> Nicolai MPJ et al.: Pelvic floor complaints in gastroenterology practice: results of a survey in the Netherlands. Frontline Gastroenterol 2012; 3: 166-71 <strong>11</strong> Rao SSC et al.: Randomized controlled trial of biofeedback, sham feedback, and standard therapy for dyssynergic defecation. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 331-8 <strong>12</strong> Podzemny V et al.: Management of obstructed defecation. World J Gastroenterol 2015; 28: 1053-60</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Das kardiovaskuläre Risiko von IBD-Patienten
Eine aktive IBD erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, während bestehende kardiovaskuläre Probleme die Wahl der Medikation erschweren. Das Ziel ist es, die richtige Balance ...
Aktuelle Studien aus Gastroenterologie und Hepatologie
Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie (SSG) und der Swiss Association for the Study of the Liver (SASL) vom 11. bis 12. September 2025 in Interlaken ...
Neues aus der Gastroenterologie
Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...