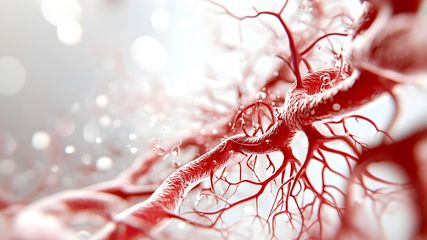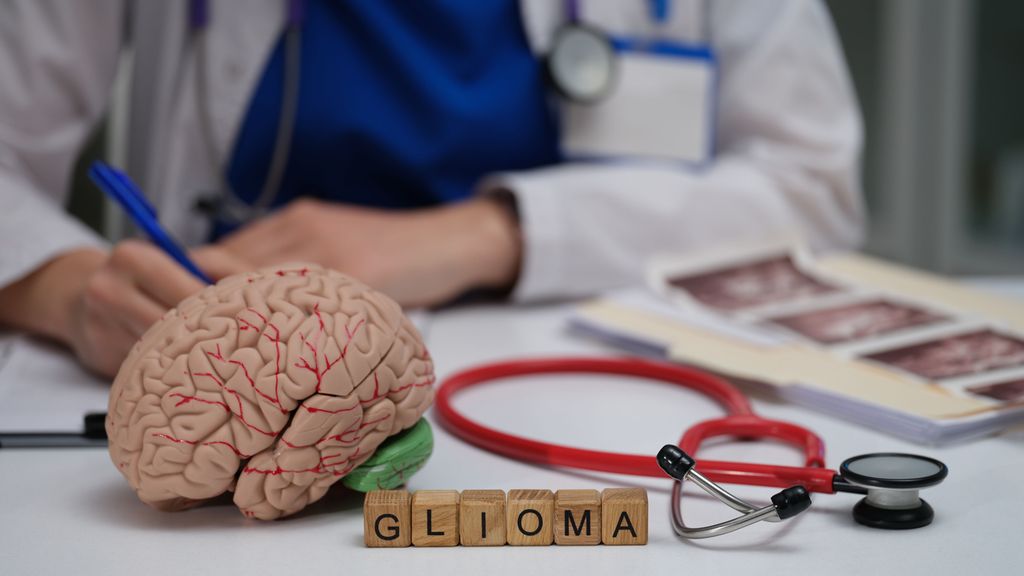
Management von Gliomen 2025
Autorin:
Dr. Tadeja Urbanic-Purkart
Leiterin der Neuroonkologischen Ambulanz
Abteilung für Allgemeine Neurologie
Universitätsklinik für Neurologie
Medizinische Universität Graz
sowie
Klinische Abteilung für Neuroradiologie, Vaskuläre und Interventionelle Radiologie
Universitätsklinik für Radiologie
Medizinische Universität Graz
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Trotz zahlreicher rezenter Erfolge in der Neurologie und Onkologie hält sich der Fortschritt in der Therapie von Gliomen zurück. Patient:innen mit Gliomen müssen immer noch mit einer geringen Überlebenswahrscheinlichkeit rechnen. Dennoch bieten zielgerichtete individualisierte Therapieverfahren Perspektiven für die Zukunft.
Die Gliome gehören mit einer Inzidenz von 6 pro 100000 Einwohner:innen in Europa zu den häufigsten Hirntumoren bei Erwachsenen.1 2023 waren laut Statistik Austria 749 Menschen von Hirntumoren betroffen, eine Häufigkeit, die zwischen jener von Ovarialtumoren (677) bzw. Lebertumoren (978) lag.2 Wo liegt der Status quo der Gliomtherapie 2025?
Therapielandschaft im Wandel – Fortschritt trotz Herausforderungen
Trotz intensiver Forschung bleibt der therapeutische Fortschritt bei Gliomen hinter anderen Tumorarten deutlich zurück. In den letzten 25 Jahren gab es zwei Zulassungen für Gliome: Temozolomid (1999) und Vorasidenib (2024 in den USA und der Schweiz). Diese Diskrepanz erklärt sich u.a. durch die komplexe Tumorbiologie, die Blut-Hirn-Schranke (BHS), das immunsuppressive Tumormikromilieu sowie eine ausgeprägte intra- und intertumorale Heterogenität.3 Hinzu kommen wirtschaftliche und regulatorische Hürden, die gerade bei seltenen Tumoren wie dem Glioblastom eine bedeutende Rolle spielen.4
Diffuse Gliome des Erwachsenen – Standard und Innovation
Diffuse Gliome im Erwachsenenalter zeichnen sich durch ein infiltratives Wachstum und molekulare Subtypen (Mutation des Isocitratdehydrogenase-Gens[IDH-Gen], 1p/19q-Kodeletion) aus. Glioblastome mit IDH-Wildtyp machen etwa 80% dieser Entitäten aus. Die charakteristischen molekularen Merkmale des IDH-Wildtyp-Glioblastoms sind die Amplifikation des Epithelien-Wachstumsfaktors (EGFR), die Mutation in der Promotorregion des Telomerase-Reverse-Transkriptase-Gens(TERT) sowie der kombinierte Zugewinn von Chromosom 7 bei gleichzeitigem Verlust von Chromosom 10 (+7/−10).
Die früher als sekundäre Glioblastome bezeichneten Tumoren werden seit der WHO-Klassifikation von 2016 als IDH-mutierte Gliome Grad 4 eingeordnet5. Nach einer sicheren Resektion oder Biopsie erfolgt die Einteilung in prognostisch günstige oder ungünstige Gruppen abhängig von Karnofsky-Performance-Status (KPS), Alter und dem Methylierungsstatus des Methylguanine-DNA-Methyltransferase-Gens(MGMT).6 Bei günstigem Profil ist das etablierte Stupp-Schema, Temozolomid kombiniert mit Strahlentherapie, gefolgt von sechs Zyklen adjuvanter Chemotherapie, Standard.6
Für ältere oder klinisch eingeschränkte Patient:innen mit unmethyliertem MGMT-Promotor empfiehlt die aktuelle Metaanalyse (der Studien CE.6, NOA-08, NORDIC)8–10 eine Deeskalation des Stupp-Schemas, da kein relevanter Überlebensvorteil durch Temozolomid zu erwarten ist. Umgekehrt konnten bereits 2018 die Ergebnisse der CeTeG/NOA-09-Studie11 bei neu diagnostiziertem MGMT-methyliertem Gliom Grad 4 prominent publiziert werden. Erstmalig erwies sich bei jüngeren Patient:innen mit methyliertem MGMT und Grad-4-Gliomen eine Kombination aus Temozolomid und Lomustin konkomitant und adjuvant (gegeben alle 6 bis 8 Wochen in Abhängigkeit von der hämatologischen Regeneration) vielversprechend; die internationale Validierung steht noch aus (NCT06419946).
Ein weiterer Therapiebaustein sind Tumortherapiefelder (TTF), seit 2017 Bestandteil der Erstlinientherapie beim Glioblastom. Ihre Akzeptanz ist regional unterschiedlich, obwohl eine tägliche Anwendung >18 Stunden mit signifikantem Überlebensvorteil assoziiert ist.12
Limitierte Überlebensraten trotz multimodaler Therapie
Trotz aller Fortschritte liegt das mediane Gesamtüberleben (OS) bei Glioblastomen nach wie vor bei nur circa 13,5 Monaten13 (Spanne 11–20 Monate); lediglich 6–7% erreichen ein Überleben über fünf Jahre.14 Daten des österreichischen Hirntumorregisters (2014–2018)15 zeigen sogar ein OS von 11,6 Monaten bei Grad-4-Gliomen (10,9 Monate bei IDH-Wildtyp).
Die Prognose von Patient:innen mit IDH-mutiertem Gliom ist sehr variabel (wenige Monate bis Jahrzehnte). Aufgrund der typischerweise langen Überlebenszeiten bei ZNS-WHO-Grad-2-Gliomen – im Gegensatz zu Astrozytomen vom ZNS-WHO-Grad 3 – erreichen prospektive Studien oft keine medianen Überlebenszeiten.16 Die CATNON-Studie berichtet für Astrozytome WHO-Grad 3 ein OS von 8,1 Jahren, wohingegen es bei Astrozytomen WHO-Grad 4 4,7 Jahre beträgt.17 Einige Risikofaktoren für ein ungünstiges Gesamtüberleben sind beschrieben worden wie höheres Alter, neurologische Defizite, eine größere Tumorlast bei Diagnosestellung sowie ein größeres postoperatives Residualvolumen. Diese scheinen mit einer kürzeren progressionsfreien Überlebenszeit (PFS) und einem kürzeren OS bei Patient:innen mit WHO-Grad-2- und -3-Gliomen assoziiert zu sein.
Neurochirurgisches Management und Resektionsstrategien
Das Resektionsausmaß gilt seit Langem als unabhängiger prognostischer Faktor.18 Ziele jeder Operation sind daher die Maximierung der Tumorentfernung bei gleichzeitigem Erhalt neurologischer Funktionen. Die fluoreszenzgestützte Chirurgie mittels 5-Aminolävulinsäure (5-ALA) hat sich hier als hilfreich erwiesen.19 Die RANO-Resect- Gruppe hat ein System zur Klassifikation des Resektionsausmaßes vorgeschlagen:20
-
Supramaximale Resektion: kein Kontrastmittel-aufnehmender Tumorrest + <5cm3 FLAIR-Signal
-
Maximale Resektion: kein KM-aufnehmender Rest, aber ≥5cm3 FLAIR-Signal
-
Submaximale Resektion: <5cm3 KM-aufnehmender Rest
-
Biopsie: reine Diagnosesicherung
Drei Risikokategorien (niedrig, intermediär, hoch) integrieren zusätzlich Alter, postoperativen Karnofsky-Status (KPS) und MGMT-Status und ermöglichen eine präzise postoperative Prognoseabschätzung.21
Potenzial: zielgerichtete Therapien bei höhergradigen Gliomen?
In einer großen Kohorte von IDH-Wildtyp-Glioblastomen konnte bei fast allen Fällen ein molekulares Profil mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) erstellt werden. Etwa die Hälfte der Patient:innen zeigte dabei potenziell therapierbare Veränderungen. Nur ein kleiner Anteil (<4%) fällt in evidenzbasierte ESCAT-Kategorie-I, BRAF-V600E-Mutation und NTRK1/2/3-Fusionen, oder Kategorie-II, FGFR1/2/3-Alterationen.22 Der „ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets“ (ESCAT) bewertet molekulare Alterationen hinsichtlich ihrer klinischen Relevanz und therapeutischen Umsetzbarkeit und unterstützt so die Wichtung genetischer Befunde in der onkologischen Therapieplanung. Der Großteil der Befunde wurde den Kategorien III und IV mit begrenzter bzw. nur präklinischer Evidenz zugeordnet. Solche Ergebnisse sollten stets in einer interdisziplinären molekularen Tumorkonferenz diskutiert und dokumentiert werden, auch im Hinblick auf mögliche Therapieentscheidungen und Kostenerstattung.
IDH-mutierte niedriggradige Gliome – Präzisionsmedizin im Aufwind
IDH-mutierte Gliome stellen eine biologisch günstigere Subgruppe dar. Mutationen im IDH1- oder IDH2-Gen verleihen dem Enzym eine abnorme (neomorphe) Aktivität, bei der aus α-Ketoglutarat das Onkometabolit 2-Hydroxyglutarat (2-HG) gebildet wird. Die Anhäufung von 2-HG in den Zellen trägt zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Gliomen bei.3,23
Bei geringem Risiko, nahezu vollständiger Resektion galt bisher ein „Watch-and-wait“-Ansatz. Höheres Risiko durch höheres Alter, neurologische Defizite, eine größere Tumorlast bei Diagnosestellung sowie ein größeres postoperatives Residualvolumen rechtfertigen eine adjuvante Radiochemotherapie mit Procarbazin/Lomustin/Vincristin (PCV) oder Temozolomid, je nach interdisziplinärer Entscheidung.6
Die INDIGO-Studie (2023) markiert einen paradigmatischen Wandel: Vorasidenib, ein dualer IDH1/2-Inhibitor, verlängerte das progressionsfreie Überleben bei vorbehandelten Grad-2-Gliomen signifikant (27,7 vs. 11,1 Monate). Auch die Zeit bis zur nächsten Intervention verlängerte sich, bei stabiler Lebensqualität. Eine Erhöhung der Leberwerte (ALT, AST, GGT) war die häufigste Nebenwirkung ≥Grad 3.24
Interessanterweise konnte bei Patient:innen mit fortgeschrittenem IDH1-mutierten Gliomen auch die Gabe von IDH-1-Inhibitor Ivosidenib 500mg einmal täglich mit einem günstigen Sicherheitsprofil, einer verlängerten Krankheitskontrolle und einem reduzierten Wachstum nicht kontrastmittelanreichernder Tumoren assoziiert werden.25 Im Vergleich zu Ivosidenib weist Vorasidenib eine bessere Penetration ins zentrale Nervensystem auf.
Zudem konnte gezeigt werden, dass eine hohe Gewebekonzentration von 2HG mit präoperativen Anfällen assoziiert war, was darauf hindeutet, dass ein Überschuss an 2HG das Risiko für präoperative Anfälle in IDH1/2-mutierten Tumoren erhöhen kann.23
Frühzeitige MRT-Veränderungen – etwa ein Anstieg des relativen zerebralen Blutvolumens – könnten als bildgebende Biomarker der Wirksamkeit dienen.26
Fazit und Ausblick
Die Behandlung diffus infiltrierender Gliome wird zunehmend individualisiert. Fortschritte wie IDH-Inhibition, molekulare Risikostratifizierung und innovative neurochirurgische Konzepte eröffnen neue Perspektiven. Gleichzeitig bleibt die Prognose insbesondere beim Glioblastom weiterhin eingeschränkt. Der Ausbau klinischer Studien, interdisziplinärer Tumorboards und spezialisierter Behandlungszentren ist essenziell, um die therapeutischen Möglichkeiten weiter zu verbessern.
Literatur:
1 Hofer et al.: Gliome im Erwachsenenalter. Leitlinie ICD-10 C71. Empfehlungen der Fachgesellschaft zur Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen. Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V., Berlin, 2017 2 Statistik Austria: Kresberkrankungen in Österreich 2025. Rev. 1, Wien, 2025 3 Pirozzi CJ, Jan H: The implications of IDH mutations for cancer development and therapy. Nat Rev Clin Oncol 2021; 18(10): 645-61 4 The Guardian 2024; https://www.theguardian.com/science/2024/feb/18/cancer-charity-warns-of-pharmaceutical-firms-holding-up-brain-tumour-research 5 Louis DN et al.: The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021;23(8): 1231-51 6 Weller M et al.: EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood. Nat Rev Clin Oncol 2021; 18(3): 170-86 7 Stupp R et al.: Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med 2005; 352(10): 987-96 8 Perry JR et al.: Short-course radiation plus temozolomide in elderly patients with glioblastoma. N Engl J Med 2017; 376(11): 1027-37 9 Wick W et al.: Temozolomide chemotherapy alone versus radiotherapy alone for malignant astrocytoma in the elderly: the NOA-08 randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2012; 13(7): 707-15 10 Hegi ME et al.: No benefit from TMZ treatment in glioblastoma with truly unmethylated MGMT promoter: Reanalysis of the CE.6 and the pooled Nordic/NOA-08 trials in elderly glioblastoma patients. Neuro Oncol 2024; 26(10): 1867-75 11 Herrlinger U et al.: Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA-09): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2019; 393(10172): 678-88 12 Toms SA et al.: Increased compliance with tumor treating fields therapy is prognostic for improved survival in the treatment of glioblastoma: a subgroup analysis of the EF-14 phase III trial. J Neurooncol. 2019; 141(2): 467-73 13 Marenco-Hillembrand L et al.: Trends in glioblastoma: outcomes over time and type of intervention: a systematic evidence based analysis. J Neurooncol 2020; 147(2): 297-307 14 Hertler C et al.: Long-term survival with IDH wildtype glioblastoma: first results from the ETERNITY Brain Tumor Funders’ Collaborative Consortium (EORTC 1419). Eur J Cancer 2023; 189: 112913 15 Hainfellner A et al.: Glioblastoma in the real-world setting: patterns of care and outcome in the Austrian population. J Neurooncol 2024; 170(2): 407-18 16 Lassman AB et al.: International retrospective study of over 1000 adults with anaplastic oligodendroglial tumors. Neuro-Oncology 2011; 13(6): 649-59 17 van den Bent MJ et al.: Adjuvant and concurrent temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma (CATNON; EORTC study 26053-22054): second interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol 2021; 22(6): 813-23 18 Suhorska B et al.: Complete resection of contrast-enhancing tumor volume is associated with improved survival in recurrent glioblastoma-results from the DIRECTOR trial. Neuro Oncol 2016; 18(4): 549-56 19 Stummer W et al.: Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial. Lancet Oncol 2006; 7(5): 392-401 20 Karschnia P et al.: Prognostic validation of a new classification system for extent of resection in glioblastoma: A report of the RANO resect group. Neuro Oncol 2023; 25(5): 940-54 21 Karschnia P et al.: Development and validation of a clinical risk model for postoperative outcome in newly diagnosed glioblastoma: A report of the RANO resect group. Neuro Oncol. 2025;27(4): 1046-60 22 Padovan M et al.: Actionable molecular alterations in newly diagnosed and recurrent IDH1/2 wild-type glioblastoma patients and therapeutic implications: a large mono-institutional experience using extensive next-generation sequencing analysis. EJC 2023; 191: 112959 23 Ohno M et al.: Tissue 2-hydroxyglutarate and preoperative seizures in patients with diffuse gliomas. Neurology 2021; 97(21): e2114-e2123 24 Mellinghoff IK et al.: Vorasidenib in IDH1- or IDH2-mutant low-grade glioma. N Engl J Med 2023; 389(7): 589-601 25 Mellinghoff IK et al.: Ivosidenib in isocitrate dehydrogenase 1 - mutated advanced glioma. J Clin Oncol 2020; 38(29): 3398-406 26 Cho NS et al.: Early volumetric, perfusion, and diffusion MRI changes after mutant isocitrate dehydrogenase (IDH) inhibitor treatment in IDH1-mutant gliomas. Neurooncol Adv 2022; 4(1): vdac124
Das könnte Sie auch interessieren:
Künstliche Intelligenz in der Medizin: Revolution oder Hype?
Die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) in der klinischen Neurologie birgt ein enormes Potenzial, die Diagnose, Behandlung und Versorgung zu revolutionieren. Durch die Analyse großer ...
Susanne Wegener: Reperfusionsversagen betrifft nicht nur Schlaganfall
Prof. Dr. med. Susanne Wegener ist leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie des Universitätsspitals Zürich. Neben ihrer klinischen Arbeit ist sie stark in der Forschung tätig. Einer ...
Akut symptomatische Anfälle – sind sie alle gleich?
Epileptische Anfälle treten bei allen Personen mit Epilepsie auf, aber umgekehrt leidet nicht jede Person, bei der ein epileptischer Anfall auftritt, an Epilepsie. Tatsächlich handelt es ...