
„Gemeinsames Vorgehen von Rheumatologen und Nephrologen“
Unser Gesprächspartner:
Dr. Balazs Odler
Klinische Abteilung für Nephrologie
Medizinische Universität Graz
Das Interview führte Dr. Felicitas Witte
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Frauen erkranken zwar häufiger an Lupusnephritis, aber Studien weisen darauf hin, dass die Nierenkrankheit bei Männern schwerer verläuft. Diese Hypothese wird durch eine neue Metaanalyse unterstützt:Männer hatten ein höheres Risiko für eine Nephritis GradIV±V, schlechtere Nierenparameter und eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine komplette Remission.1 Warum die Studie vorsichtig zu interpretieren ist und wie man Patienten mit Lupusnephritis optimal betreut, erklärt Dr. Odler aus Graz.
Haben die Ergebnisse der Studie1 Sie überrascht?
B. Odler: Nein. Wir wissen aus der klinischen Praxis, dass Manifestationen eines systemischen Lupus erythematodes (SLE) bei Männern meist mit einer hohen Aktivität assoziiert sind. Es handelt sich bei der Arbeit um eine Metaanalyse von Studien, in denen Nierenbiopsien und die Diagnostik durch die Pathologie vorhanden waren. Metaanalysen haben in sich Schwächen, etwa dass Studienaufbau, Therapieregime oder die inkludierten Patienten der einzelnen Studien nicht vergleichbar sind. Auch das seltene Auftreten von SLE bei Männern und damit sehr geringe Fallzahlen in den Studien könnten zu einer Verzerrung der Ergebnisse beitragen.
Kann man die Daten auf Europa und auf Österreich übertragen?
B. Odler: Die meisten der eingeschlossenen Studien sind aus Asien und Südamerika. Wir wissen, dass Patienten aus diesen Ländern einen anderen Verlauf des SLE haben können als in Europa. Wir versuchen daher, die Studien dahingehend zu evaluieren, ob ausreichend Patienten aus dem europäischen Raum in die Studien eingeschlossen wurden, um wirklich eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die europäische Bevölkerung einschätzen zu können.
Wie erklären Sie sich den beobachteten Zusammenhang?
B. Odler: Genetische Gründe liegen nahe. Es ist bekannt, dass Männer eine höhere Risikoallelfrequenz im HLA-Lokus aufweisen. Abgesehen davon ist der SLE bei Männern per se selten und wird damit leichter übersehen bzw. später diagnostiziert. Damit werden uns die Patienten mit bereits fortgeschrittener Erkrankung vorgestellt.
Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Studie?
B. Odler: Jeder SLE-Patient, egal ob Mann oder Frau, sollte regelmäßig auf das Vorhandensein einer Lupusnephritis untersucht werden. Dafür benötigt es nur eine Harnanalyse (Harnstreifen und in der Folge Protein/Krea-Ratio im Harn und ggf. Harnsediment) sowie die Bestimmung der errechneten glomerulären Filtrationsrate mittels Serum-Kreatinin. Die Therapie sollte entsprechend dem Ergebnis der Nierenbiopsie gesteuert werden. Gerade Patienten mit Lupusnephritis III/IV mit hohen Aktivitätszeichen in der Biopsie sollten wir wohl intensiver therapieren, also mit einer Triple-Therapie.
Gehen Sie bei Männern und Frauen mit Lupusnephritis therapeutisch unterschiedlich vor?
B. Odler: Aktuell nicht. Auch hier zählt die Aktivität in der Nierenbiopsie bei Lupusnephritis III/IV. Wir sollten Männer mit SLE genauso wie die Frauen regelmäßig kontrollieren und den Befunden entsprechend reagieren.
Die Autoren plädieren dafür, Studien zukünftig mehr auf Männer zuzuschneiden.
B. Odler: Ja, es ist sicher per se korrekt, dass wir die männlichen SLE-Patienten balancierter stratifizieren sollten, da die Erkrankung bei Männern einfach wirklich selten ist. Dies würde uns wohl auch in der Umlegbarkeit der Ergebnisse auf die männliche Population helfen. Allerdings muss auch gesagt werden, dass eine Studie nie für die männliche SLE-Population gepowert sein wird, da es schlichtweg wenige Männer mit SLE gibt.
Was halten Sie für am wichtigsten in der Behandlung der Lupusnephritis?
B. Odler: Ein sinnvolles Therapiekonzept zu erstellen, am besten in einem interdisziplinären Board mit den entsprechenden Fachdisziplinen. Zusätzlich ausreichende Zeitressourcen, um die Therapie mit den Patienten zu besprechen. Diese profitieren von einem gemeinsamen Vorgehen von Rheumatologen und Nephrologen. Die Erarbeitung eines gemeinsamen Therapiekonzeptes hilft extrem, das Vertrauen und damit die Adhärenz zu stärken.
Literatur:
1 Mahmood SB et al.: Glomerular Dis 2024; 4: 19-32
Das könnte Sie auch interessieren:
Krebsscreening bei Myositis
Idiopathische inflammatorische Myopathien (IIM) sind mit einem erhöhten Krebsrisiko assoziiert, insbesondere in den ersten Jahren nach der Diagnose. Eine neue Leitlinie der International ...
Arthrose – Mythen und Fakten
Die Arthrose ist mit einer Lebenszeitprävalenz von über 50% die häufigste chronische Gelenkerkrankung weltweit. Die Krankheit ist eindeutig mit höherem Alter und BMI assoziiert, ...
Von der Pankreasläsion zur systemischen Histiozytose
Die Erdheim-Chester-Erkrankung (ECD) ist eine seltene Form der Nicht-Langerhans-Zell-Histiozytose, die durch eine pathologische Infiltration von Zellen des mononukleären ...

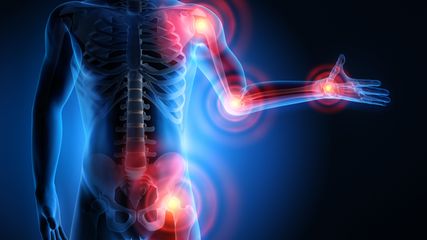
.jpg)