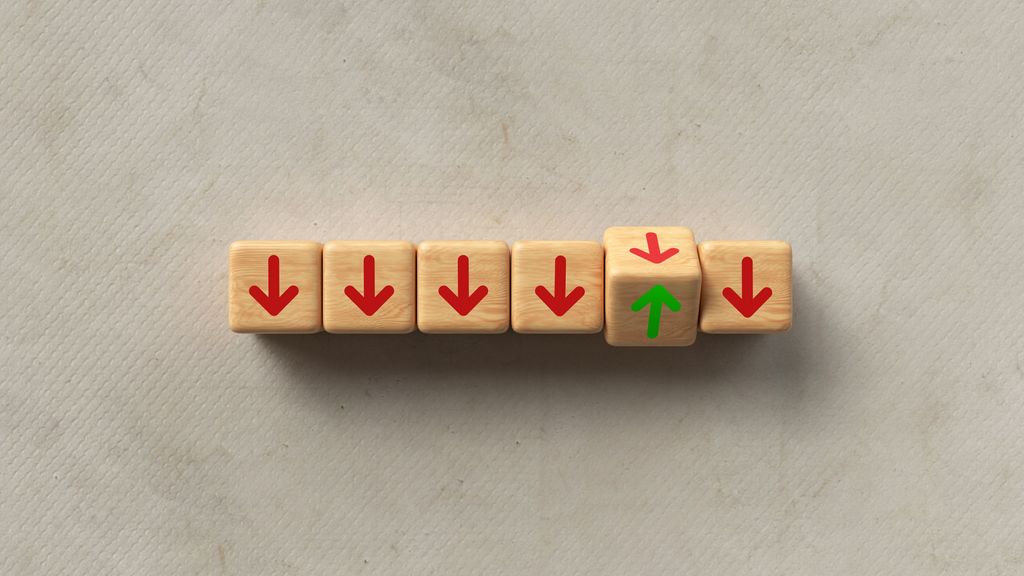
©
Getty Images/iStockphoto
Neurobiologische Gemeinsamkeiten und neue Therapieansätze
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
13.10.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Epilepsien sind häufig stigmatisierend erlebte, chronische und die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigende Erkrankungen. Die Prävalenz der Depression bei Epilepsiepatienten ist hoch, jeder Dritte (32 % ) leidet daran, präsentiert aber oft atypische Symptome. Umgekehrt haben depressive Patienten ein erhöhtes Risiko, später eine Epilepsie zu entwickeln. Den Schnittstellen zwischen den Erkrankungen und den damit befassten medizinischen Disziplinen ging ein Fachsymposium der Epilepsie-Klinik Lengg und der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich nach.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Nicht erst durch die Einführung der Elektrokonvulsionstherapie in der Behandlung depressiver Erkrankungen stellen sich Fragen zu pathophysiologischen Gemeinsamkeiten depressiver Störungen und Anfallserkrankungen. In einer von Prof. Dr. Dr. med. Thomas Grunwald von der Klinik Lengg und Prof. Dr. med. Erich Seifritz von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich organisierten Veranstaltung diskutierten Experten wichtige Schnittstellen. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1605_Weblinks_seite16_1.jpg" alt="" width="1039" height="727" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1605_Weblinks_seite16_2.jpg" alt="" width="1040" height="674" /></p> <h2>Allgemeine Aspekte der Depression</h2> <p>PD Dr. med. Annette Brühl von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) Zürich diskutierte allgemeine Aspekte zu Depressionen und beantwortete die Frage, wann man an eine Depression denken sollte. Die Liste der Haupt- und Zusatzsymptome nach ICD-10 (F32) sei lang, führte sie aus, einfacher sei der Zwei-Fragen-Test der WHO: 1. Frage: Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig bedrückt oder hoffnungslos? 2. Frage: Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun? Wenn die Antworten positiv seien, dann sollte eine weitere Exploration erfolgen.<sup>1</sup> <br />Da es zahlreiche psychiatrische Differenzialdiagnosen gebe (z.B. prolongierte Trauer, Anpassungsstörung, bipolare Störung, Angsterkrankung, Zwangserkrankung, Demenz und beginnende demenzielle Entwicklung, Schmerzerkrankung, posttraumatische Belastungsstörung, Substanzabhängigkeit, Essstörung, Persönlichkeitsstörung), sollte die Einbeziehung eines Psychiaters niederschwellig erfolgen, empfahl Brühl. In jedem Fall sollte zu Beginn einer Therapie und bei jeder Visite im weiteren Verlauf die Suizidalität abgeklärt werden. <br />Abhängig vom Schweregrad einer Depression ist eine Therapie mit Psycho- oder/und Pharmakotherapie indiziert. Die Aufklärung über Antidepressiva, Psychoedukation und wöchentliche Kontrollen in den ersten Behandlungsmonaten sei essenziell. «Die Wirksamkeitsprüfung der Medikation ist spätestens nach vier Wochen angezeigt. Wenn sich keine Verbesserung der Symptome zeigt, sollte eine Plasmaspiegel-Bestimmung erfolgen», empfahl die Referentin. Wie lange sollten die Medikamente eingenommen werden? «Mindestens vier bis neun Monate über die Remission hinaus, und zwar ohne Dosisreduktion», betonte Dr. med. Brühl. Für zahlreiche Psychotherapieformen sei eine Wirksamkeit auf depressive Störungen nachgewiesen. Bei schwerer Depression ohne ausreichendes Ansprechen auf eine adäquate Therapie nach sechs Wochen, bei Selbst- und Fremdgefährdung und bei relevanten Komorbiditäten sollte immer ein Psychiater beigezogen werden, so die Empfehlung. Erste Auswahlkriterien für die Antidepressiva seien die Verträglichkeit (Patientenpräferenz) und psychiatrische Komorbiditäten. Bei Zwangsstörungen sind z.B. SSRI oder Clomipramin eine gute Option, bei ADHS eher die SNRI. Zur Augmentation sind Lithium, Antipsychotika, Sport, Lichttherapie, Schlafentzugstherapie und eventuell Nahrungsergänzungsmittel eine Option. Die elektrischen Stimulationsverfahren EKT, rTMS, DBS und VNS wurden diskutiert. Experimentell wurden die Therapieansätze mit Ketamin, Botulinumtoxin, Neurofeedback und EPO genannt.</p> <h2>Elektrokonvulsionstherapie</h2> <p>Prof. Dr. med. Heinz Böker, Emeritus Psychiatrie und noch in psychoanalytischer Praxis in Zürich tätig, ist ein Pionier der Elektrokonvulsionstherapie, EKT, zur Depressionsbehandlung. Nach einem historischen Rückblick zeigte er auf, für welche Patienten die moderne EKT infrage kommt. Sie erfolgt heute in Kurznarkose unter Muskelrelaxation. Obwohl der Wirkungsmechanismus noch immer ungeklärt ist (der Krampfanfall selbst, die Applikation von elektrischem Strom?), ist die Summe der kurz- und langfristigen Einzeleffekte so überzeugend, dass die EKT sogar Therapie der ersten Wahl sein kann. «Bei akuter lebensbedrohlicher Katatonie, wahnhaften Depressionen, depressivem Stupor und schizoaffektiven Psychosen mit depressiver Verstimmung sowie endogenen Depressionen mit hoher Suizidalität, Nahrungsverweigerung oder ausserordentlichem Leidensdruck ist ein Einsatz ‹first line› gerechtfertigt», führte Prof. Böker aus. Als Therapie der zweiten und dritten Wahl kann die EKT bei therapieresistenten Depressionen oder Manien appliziert werden. Es gebe nur drei absolute Kontraindikationen (KI): kürzlich überstandener Herzinfarkt, zerebrales oder aortales Aneurysma/Angiom und erhöhter Hirndruck. Höheres Alter, Schwangerschaft und Herzschrittmacher sind dagegen keine KI. Relative KI (KHK, schwere Hypertonie, Post-Stroke, pulmonale Erkrankungen) erfordern vorgängig ein internistisches Konsilium. Zur Praxis der EKT an der PUK berichtete Prof. Böker, dass diese seit 2013 auch ambulant erfolgen könne, es werden drei Einzelapplikationen pro Woche als Serie mit bis zu 12 Einzelbehandlungen verabreicht. Insgesamt liegt die Nebenwirkungsrate bei 23 % und umfasst leichte kognitive Störungen, kardiovaskuläre NW sowie Kopfschmerzen, Nausea usw. Nur bei 2 % treten ernsthafte NW auf. «Es ist nicht gerechtfertigt, die EKT nur als letzte Option in der Depressionsbehandlung einzusetzen», schloss Prof. Böker. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1605_Weblinks_seite17.jpg" alt="" width="1417" height="866" /></p> <h2>Weitere «Electroceuticals»</h2> <p>«Electroceuticals sind Medikamente, deren Wirkstoffe elektrische Impulse sind», erklärte Prof. Dr. med. Thomas Schläpfer von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn den Begriff. Neuromodulierende Interventionen sind die tiefe Hirnstimulation (DBS), die repetitive Magnetstimulation (rTMS) und die Vagusnervstimulation (VNS). Der Einsatz der DBS bei Depressionen basiert auf der Vorstellung, dass neurale Schaltkreise den Affekt bestimmen und frontaler Cortex, Hippocampus, Nucleus accumbens (Anhedonie), Striatum (Belohnung) und Hypothalamus die zentralen Schaltstellen sind. Eine DBS des Nucleus accumbens führt zu einer deutlichen Verbesserung in der Hamilton Depression Scale über zwei Jahre hinaus. Bisher stimulierte man an drei Orten und kam auf 50 % Responder.<sup>2</sup> In aktuell laufenden Studien (FORESEE, Forebrain Stimulation Depression<sup>3</sup>) wird die Idee verfolgt, einen Schritt tiefer im prätektalen Grau zu stimulieren. In einer ersten offenen Studie mit acht hochgradig therapieresistenten Patienten konnte die Re­sponserate auf 87,5 % erhöht werden. Zum Stand der Anwendung der «Electroceuticals» zeigte Prof. Schläpfer eine Tabelle (Tab. 1).</p> <h2>Risiken unter Antidepressiva</h2> <p>PD Dr. med. Reinhard Ganz von der Klinik Lengg zeigte auf, dass das Risiko einer prokonvulsiven Wirkung von Antidepressiva (AD) weit überschätzt wird. Bei geeigneter Wahl des Präparates (insbesondere SSRI) und bei einem vorsichtigen therapeutischen Regime sind AD auch bei Epilepsiepatienten gut verträglich, sie haben einen dosisabhängigen Effekt auf die Anfallsfrequenz, dieser scheint unabhängig vom Anfallstyp und unabhängig vom antidepressiven Effekt zu sein. «Eine antidepressive Therapie mit serotonergen oder serotonergen/noradrenergen Antidepressiva hat im therapeutischen Dosisbereich kein klinisch relevantes epileptogenes Potenzial», erklärte Dr. med. Ganz. Damit stünden sehr gute Medikamente zur Verfügung, betonte er. <br />Für eine Vielzahl von Antikonvulsiva ist ein depressiogener Effekt nachgewiesen: Phenobarbital, Phenytoin, Primidon, Vigabatrin, Tiagabin, Felbamat, Topiramat. Enzyminduktoren wirken über eine Minderung der Folsäurekonzentration depressionsfördernd. Ein Wechsel von Antiepileptika, die ein höheres Risiko der Auslösung von depressiven Symptomen haben, hin zu solchen, die stimmungsneutral sind oder sogar einen günstigen Effekt auf die Stimmung haben, sollte bei einer manifesten Depression geprüft werden. Zu den Substanzen, die die Stimmung stabilisieren können, zählen unter anderem Carbamazepin und Valproat. Lamotrigin und Gabapentin tragen sogar eher zu einer Stimmungsaufhellung bei und kommen für eine medikamentöse Umstellung besonders infrage.<sup>4</sup> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1605_Weblinks_seite18.jpg" alt="" width="1417" height="1004" /></p> <h2>Auf atypische Symptome achten</h2> <p>Symptome einer Depression werden oft als normale Reaktion auf eine chronische Epilepsie angesehen. Psychoreaktive Aspekte seien die Unvorhersehbarkeit der Anfälle, das Erleben von Kontrollverlust, Erleben von Beschämung, reale soziale und berufliche Einschränkungen und gesellschaftliche Stigmatisierung, führte Dr. Matthias Schmutz, Psychologe in der Klinik Lengg, an. Affektive Störungen von Epilepsiepatienten haben oft atypische Züge, die die Diagnose erschweren. Zusätzlich stellen die Patienten ihre psychiatrischen Symptome oft aus Angst in den Hintergrund, hierdurch noch stärker stigmatisiert zu werden. Die Therapie der Depression ist aber sehr wichtig, da die erfolgreiche Behandlung wesentlich auf die Lebensqualität Einfluss nimmt und das erhöhte Suizidrisiko reduzieren kann.<sup>5, 6</sup> <br />Die Formen der Depression werden nach dem Zeitpunkt des Auftretens in präiktal, iktal und postiktal eingeteilt. Interiktale depressive Symptome oder Episoden unterscheiden sich oftmals von der «klassischen» unipolaren, schweren depressiven Episode, die noch am ehesten erkannt wird. Atypische depressive Störungen bei Epilepsie gehen mit Dysphorie, Anergie, Stimmungsschwankungen mit Dysphorie, Freud- und Hoffnungslosigkeit, diffusen Schmerzen, Insomnie, Furcht und Angst einher. Schlafstörungen bei Epilepsiepatienten sind häufig (65,5 % <sup>7</sup>) und korrespondieren mit weiteren medizinischen Problemen wie übermässigem Hypnotikagebrauch, AED-Polytherapie und COPD, Asthma und OSAS, worauf Dr. med. Aribert Bauerfeind vom Schlaflabor der Klinik Lengg verwies.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Whooley MA et al: J Gen Intern Med 1997; 12(7): 439-45 <strong>2</strong> Magnezi R et al: Comparison between neurostimulation techniques repetitive transcranial magnetic stimulation vs electroconvulsive therapy for the treatment of resistant depression: patient preference and cost-effectiveness. Patient Prefer Adherence 2016; 10: 1481-7 <strong>3</strong> Bewernick et al: Long-term effects of nucleus accumbens deep brain stimulation in treatment-resistant depression: evidence for sustained efficacy. Neuropsychopharmacology 2012; 37(9): 1975-85 <strong>4</strong> Alper K et al: Seizure incidence in psychopharmacological clinical trials: an analysis of Food and Drug Administration (FDA) summary basis of approval reports. Biol Psychiatry 2007 ; 62(4): 345-54 <strong>5</strong> Kanner AM: Management of psychiatric and neurological comorbidities in epilepsy. Nat Rev Neurol 2016; 12(2): 106-16 <strong>6</strong> Tellez-Zenteno JF et al: Psychiatric comorbidity in epilepsy: a population-based analysis. Epilepsia 2007; 48(12): 2336-44 <strong>7</strong> Yang Kli et al: Severity of self-reported insomnia in adults with epilepsy is related to comorbid medical disorders and depressive symptoms. Epilepsy Behav 2016; 60: 27-32</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Phytotherapie bei Angsterkrankungen und assoziierten Beschwerden
Pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr Bedeutung in der Psychiatrie. Insbesondere bei Angsterkrankungen und Depressionen stellen Phytotherapeutika eine sinnvolle Alternative zu ...
Gesundheits-Apps: Zukunft der Therapie?
Digitale Gesundheitsanwendungen rücken zunehmend in den Fokus. Die digitale Transformation bietet Chancen und Herausforderungen.
Stellungnahme zum Konsensus Statement Schizophrenie 2023
In dem Konsensus Statement Schizophrenie 20231 wurde die Sachlage zur Diagnostik und Therapie schizophrener Erkrankungen in 19 Kapiteln erarbeitet. Doch besteht im Bereich der ...


