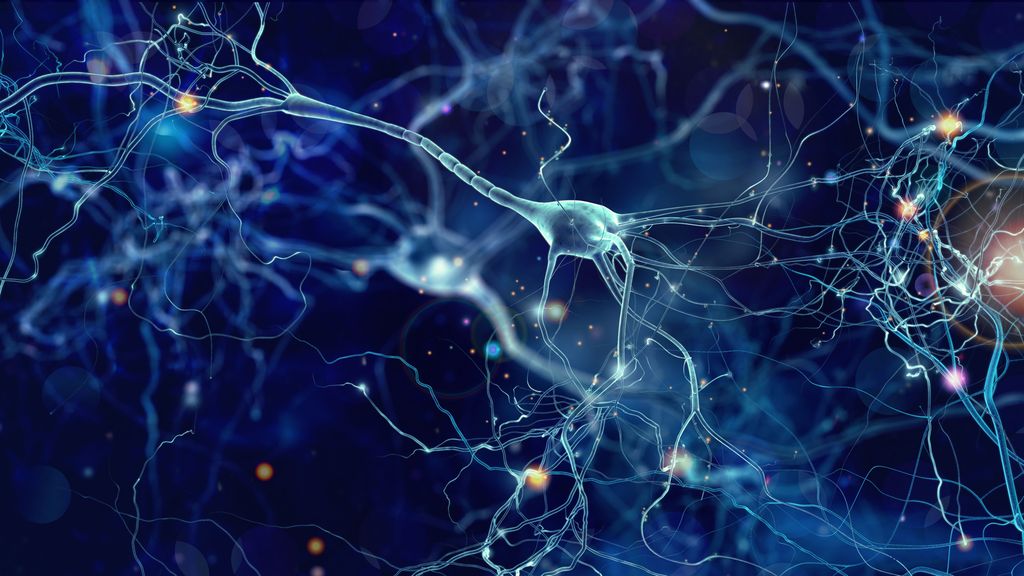
©
Getty Images/iStockphoto
Update Grundlagenforschung und viel Praxisrelevantes
Jatros
Autor:
Dr. Susanne Schelosky
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Fragt man am Ende einer Tagung einzelne Teilnehmer nach den Höhepunkten der Veranstaltung, so werden meist sehr viele unterschiedliche Themen aufgeführt. Die Präsidentensitzung beim diesjährigen Epilepsiekongress in Wien fanden alle erwähnenswert. Die von den Tagungsleitern Prof. Dr. Christoph Baumgartner und PD Dr. Susanne Pirker ausgewählten Referenten und Topics vermittelten Einblicke in die wissenschaftliche Forschung oder hatten hohe Praxisrelevanz. </p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Bereits seit zehn Jahren tagen die Epileptologen der deutschsprachigen Länder gemeinsam, um Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und aktuelle brennende Fragen der klinischen Epileptologie zu diskutieren. Das große Thema war die Diskussion der Frage, wie es gelingt, mit einer modernen Epilepsietherapie den Betroffenen ein durch die Erkrankung weitgehend uneingeschränktes Leben zu ermöglichen.<br />Unter dem Vorsitz von Kongresspräsident Prof. Christoph Baumgartner, Vorstand der Neurologischen Abteilung des Krankenhauses Hietzing, gab es im Präsidentensymposium Neues aus der Epileptogenese-Forschung und eine Leistungsschau, wie durch modernste Bildgebung (fMRT) und Konnektomanalyse die Epilepsiechirurgie optimiert werden kann. Neue Ansätze im Patientenmonitoring im stationären, vor allem aber im ambulanten Bereich wollen die Patientensicherheit erhöhen und das Therapiemonitoring unterstützen. Relevantes zur Epileptologie auf der Intensivstation und zum plötzlichen Tod bei Epilepsie (SUDEP) gaben Einblicke in klinisch wichtige Bereiche.</p> <h2>Epileptogenese</h2> <p>Ein Drittel der Patienten erreicht durch die heute zur Verfügung stehenden antiepi­leptischen Therapien keine ausreichende Anfallsfreiheit. Umso wichtiger ist es, die grundlegenden Pathomechanismen der Epilepsie zu erforschen. <br />Ein wichtiger Ansatzpunkt sind genetische Untersuchungen. Bei einigen wenigen seltenen kindlichen Epilepsieformen sind bereits die genetischen Ursachen bekannt, was therapeutische Konsequenzen hat. Die Regulation der Genexpression im Rahmen der Embryogenese, Zellteilung und Differenzierung im ZNS führt normalerweise zu einer Adaptierung von Funktionen in sich nicht teilenden Nervenzellen und in Astrozyten, Oligodendrozyten und Mikroglia. In der Pathogenese vieler neuronaler Erkrankungen spielen Proteine wie Ionenkanäle und Rezeptoren eine bedeutende Rolle. Von Bedeutung sind auch epigenetische Mechanismen.<br />Prof. Andrea Rossetti, Neurologe und Epileptologe an der Universität Lausanne, diskutierte weitere Pathomechanismen, die in der Epileptogenese eine Rolle spielen. Eine interessante Hypothese geht davon aus, dass die Initiation eine Entzündung, zum Beispiel aufgrund eines Traumas, eines Schlaganfalls oder einer Infektion, darstellt. Die Aktivierung von Astrozyten und Mikroglia führt zur Freisetzung prokonvulsiver Zytokine, IL-1β, HMBG1 und TNF-α, die die Epileptogenese fortsetzen. Bekannt sind auch mögliche protektive Mechanismen: Überexpression von hemmenden Neuropeptiden, kompensatorische Erhöhung der GABA-Synthese, Sprouten von Interneuronen im Subiculum. Das Subiculum stellt eine Verbindungsstruktur zwischen dem Gyrus parahippocampalis und dem Hippocampus dar. Es ist im Temporallappen in unmittelbarer Nähe zum Ammonshorn (Cornu ammonis) lokalisiert. Dieser Teil des Gehirns gehört zum Archikortex, dem entwicklungsbiologisch gesehen ältesten Teil des Cortex cerebri. Forschungserkenntnisse der letzten Jahre weisen darauf hin, dass das Subiculum aktiv an der Generierung epileptischer Anfälle im Rahmen der Temporallappenepilepsie beteiligt ist.</p> <h2>Patientenmonitoring</h2> <p>Neue Ansätze zum Patientenmonitoring im stationären und ambulanten Setting stellte Prof. Andreas Schulze-Bonhage, Leiter des Epilepsiezentrums am Universitätsklinikum Freiburg, vor. Vorrangiges Ziel sei es, die Sicherheit von Epilepsiepatienten zu erhöhen und eine bessere Steuerung der Therapie anhand verlässlicher Daten über die Anfallssituation zu ermöglichen. Da sich viele sozialmedizinische Entscheidungen wie über Fahrerlaubnis, Berufsausübung, Schwerbehinderung an der Anfallskontrolle orientieren, sei es besonders wichtig, diese sicher dokumentieren zu können. Fernziel sei die Entwicklung von Alarmsystemen, die einen Anfall bereits in der Entstehung detektieren können. Nächster Schritt werde es dann sein, gezielte iktale und möglicherweise präiktale Therapieansätze zu entwickeln. <br />Iktale Entladungen können sehr genau mittels intrakranieller Anfallsdetektion erfasst werden. Intrakranielle EEG-Analysen ermöglichen ein Monitoring der kortikalen Exzitabilität unter Verwendung der Analyse von Hirnantworten auf Perturbationen. Dies eröffnet neue Optionen für ein Monitoring im Stunden- bis Tagebereich mit Chancen für Warnsysteme und für neue Interventionen in präiktalen Phasen. Ein erstes Gerät zum Langzeitmonitoring (NeuroVista-Implantat) kann bis zu vier Jahre lang eine kontinuierliche Analyse eines intrakraniellen EEG liefern. Möglich wird damit auch ein Therapiemonitoring. In Zukunft ließe sich so der Erfolg von Therapien in Echtzeit kontrollieren. <br />Ambulantes Monitoring mittels EEG und Video birgt viele Fehlerquellen und erfordert einen hohen technischen, zeitlichen und personellen Aufwand. Mithilfe von Surrogat-Biomarkern wie der Erfassung von körperlichen Anfallssymptomen will man dem begegnen. Durch eine Miniaturisierung der Sensoren und Integration in mobile Kommunikationssysteme sind eine ambulante Schlafüberwachung und die Aufzeichnung anfallsartiger Bewegungen verbessert worden. Die Grand-mal-Detektion mittels EMG oder EKG ist eine weitere Option. Aktuelles multimodales Assessment mit Embrace oder über ein in die Kleidung integriertes multimodales Assessment (Neuronaut) stecken in der Phase der Erprobung. Auch für die Anfallsvorhersage könnte die Methode von Bedeutung werden. „Wir haben die Hoffnung, anhand des Erregungsmusters Phasen besonders hoher Anfallswahrscheinlichkeit identifizieren zu können“, sagte Prof. Schulze-Bonhage. Die Patienten könnten sich in diesen Phasen besonders vorsichtig verhalten und etwa Autofahrten unterlassen. Zudem würde dies zeitlich gezielte Behandlungen ermöglichen.</p> <h2>Durchblick und Ausblick mit kognitivem fMRT</h2> <p>In den vergangenen 20 Jahren konnten die Indikationen für epilepsiechirurgische Eingriffe signifikant erweitert werden. Die Vorhersagemöglichkeiten des Verlaufs nach einer Operation am Temporallappen waren bislang begrenzt. Durch die verbesserte Diagnostik sind solche Eingriffe auch bei Patienten mit weniger schwer behandelbaren fokalen Epilepsien sowie bei Patienten mit präoperativ ausgezeichneten kognitiven Leistungen möglich, bei denen aufgrund des hohen Risikos von postoperativen kognitiven Defiziten der Nutzen eines epilepsiechirurgischen Eingriffs besonders sorgfältig abgewogen werden muss. Prof. Silvia Bonelli-Nauer, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Wien, zeigte, welchen Beitrag die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) beim Epilepsie-Imaging spielt.<br />Epilepsie-Imaging beinhaltet die umfassende Beschreibung epileptischer Syndrome mittels Genetik, Bildgebung, Kognition, Anfallssemiologie, Antiepileptika und interiktaler Veränderungen. Präoperative Diagnostik will Vorhersagen zu Outcome und Reorganisation machen. Am Beispiel Sprache erläuterte die Referentin, wie durch anatomische und funktionale Konnektivitätsstudien die Strukturen aufgezeigt werden können, die für den Spracherhalt notwendig sind. „Wir sind vom Zonen- und Netzwerkdenken zur Konnektomanalyse übergegangen. In der Region of Interest wird das gesamte Konnektom dargestellt und die Operation kann entsprechend geplant werden. Eine Konnektomanalyse ist elegant, um Vorhersagen zu treffen“, erläuterte Prof. Bonelli-Nauer.<br />Durch ein Gedächtnis-fMRT mit Lateralisation und Lokalisation von Gedächtnisfunktionen ist eine Prädiktion von postoperativen Gedächtniseinbußen möglich. Lokalisationen von verbalem und visuellem Gedächtnis sind mit 70 bzw. 100 % vorhersagbar. fMRT ist geeignet, um kognitive Funktionen bei Patienten mit Epilepsie zu untersuchen, und erlaubt die Exploration spezifischer Effekte auf dem Netzwerk-Level in Ergänzung zur neuropsychologischen Untersuchung. Störungen der Verbindungen in kognitiven Netzwerken könnten eine Erklärung für kognitive Störungen sein, die über die Anfallsursprungszone hinausgehen. Dargestellt werden kann auch die Effizienz der postoperativen Reorganisation.</p> <h2>Epileptologie auf der Intensivstation</h2> <p>Was der Neurologe bei einem Patienten mit epileptischen Anfällen auf der Intensivstation beachten sollte, fasste Prof. Andrea Rossetti zusammen. Ein EEG-Monitoring sei nach internationalen Leitlinien „zu empfehlen“ bei refraktärem Status epilepticus (RSE) und zu „erwägen“ bei unklaren Bewusstseinstrübungen. Automatisierte EEG-Softwares seien zwar zeitsparend, sollten aber auch einen Rückgriff auf die ursprünglichen Daten erlauben. „Meine Empfehlung ist, das EEG liberal einzusetzen, für die Therapie entscheidend ist die klinische Lage“, so Rossetti. Ein kontinuierliches EEG (cEEG) sei bei der RSE-Therapie angezeigt. Sind Anfälle nicht epileptiform, könne die Messdauer begrenzt werden.</p> <h2>Plötzlicher Tod bei Epilepsie</h2> <p>SUDEP steht für „sudden unexpected death in epilepsy“ und bezeichnet einen plötzlichen unerwarteten Tod bei Epilepsie ohne erkennbare Ursache. Das kumulative Lebenszeitrisiko für SUDEP liegt bei 7–8 % bei früh beginnender Epilepsie und ist eine fatale Komplikation bei generalisiertem tonisch-klonischem Anfall (GTKA). Die Autopsie erbringt häufig keine offensichtliche Todesursache.<br />Wann, wie und warum Patienten und Angehörige über die Gefahr eines SUDEP informiert werden sollten, diskutierte Prof. Rainer Surges, Klinik für Epileptologie an der Universitätsklinik Bonn. Befragungen haben gezeigt, dass Patienten informiert werden wollen. Die Ärzte denken aber oft, eine Aufklärung habe keine Konsequenzen, und unterlassen sie deswegen. Aufklärung sei wichtig, da sie gezielte Verhaltensänderungen bzw. Maßnahmen wie Anfallsdetektion, Schulung der Betreuer in kardiopulmonaler Reanimation, Schlafüberwachung (z.B. mit Babyphone) ermöglicht. 86 % der SUDEP-Fälle ereignen sich unbeobachtet und treten häufiger im Schlaf auf. Eine gute Anfallskontrolle (Medikamente, Chirurgie, Vagusnerv-Stimulation) ist die beste Prävention. Eine frühe kardiopulmonale Reanimation innerhalb von drei Minuten nach Anfallsende kann lebensrettend sein.<br />Die Mehrzahl der Patienten wünscht (mehr) Information, je jünger, desto mehr Wissbegier. Günstige Zeitpunkte für das Gespräch sieht Prof. Surges bei Kontrollterminen, Adhärenzproblemen, Pharmakoresistenz, Auszug aus dem Elternhaus, Kinderwunsch. Eine Aufklärung über SUDEP hat gemäß Untersuchungen keine Auswirkung auf die Gemütslage.</p> <div id="fazit"> <h2>Epilepsie in der Öffentlichkeit</h2> <p>Ein Höhepunkt der Tagung war wieder der öffentliche Patiententag, der vor allem dem Austausch zwischen Öffentlichkeit, Patienten und Klinikern diente. Betroffene, Angehörige und Interessierte hatten die Gelegenheit, sich über die Krankheit Epilepsie zu informieren und mit Selbsthilfegruppen in einen Dialog zu treten. Neben Expertenvorträgen zu Behandlungsmöglichkeiten, Epilepsie und Lebensqualität sowie über Kinderwunsch bei Epilepsie gab es Diskussionen zu den Themen „Erste Hilfe beim Anfall durch Laien, Angehörige und Ersthelfer“ und „Was Epilepsie-Patienten sich von ihrem Arzt wünschen“. Selbsthilfegruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stellten ihre Unterstützungsangebote vor.<br /> Im wissenschaftlichen Teil der Tagung gab es eine Sitzung, in der Experten aufzeigten, wie sich die Wahrnehmung von Anfällen im Laufe der Zeit, von der Antike bis heute, gewandelt hat. Florian Losch, Klinik für Neurologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, spannte den Bogen von der archaischen Medizin, die von Sehern, Ärzten und Priestern dominiert worden war, bis zur „Medizin“ in großen griechischen Epen. Dr. Florian Weissinger, Klinik für Neurologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, befasste sich mit den Bibelstellen, die von epileptischen Anfällen erzählen. Wie bedeutend in Kirchen das Thema Anfälle, Besessenheit etc. ist, zeige sich in den bis dato rund 40 Schutzpatronen, die bei entsprechenden Leiden angerufen werden können.<br />In Zeiten moderner Dämonie durch soziale Medien sei es sehr wichtig, Patienten auf Informationen im Internet zu verweisen, die auf einer wissenschaftlichen Basis beruhen und nicht nur Meinungen und Einzelfälle widerspiegeln. Eine Stichprobe von YouTube-Videos von „epileptischen“ Anfällen liess erkennen, dass die Mehrzahl keine epileptischen Anfälle, sondern Anfälle anderer Genese zeigt. „Wir müssen uns fragen, wie wir mit unseren Botschaften an die Menschen kommen. Vor allem gilt es auch zu klären, was sie wirklich wissen wollen und im Netz suchen“, forderte Dr. Thomas Mayer, Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg. Da die häufigste Quelle bei Laienrecherchen Wikipedia sei, werden die dortigen Einträge aktuell auf ihre Richtigkeit geprüft.</p> </div></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 10. Gemeinsame Tagung der Deutschen und Österreichischen Gesellschaften für Epileptologie und der Schweizerischen Epilepsie-Liga, 3.–6. Mai 2017, Wien
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...
Nahrungsergänzungsmittel bei ME/CFS: neue Hoffnung oder falsche Versprechen?
Chronische Erschöpfung, die nicht vergeht, Schmerzen, Konzentrationsprobleme, ein Leben in Zeitlupe. Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) betrifft weltweit ...


