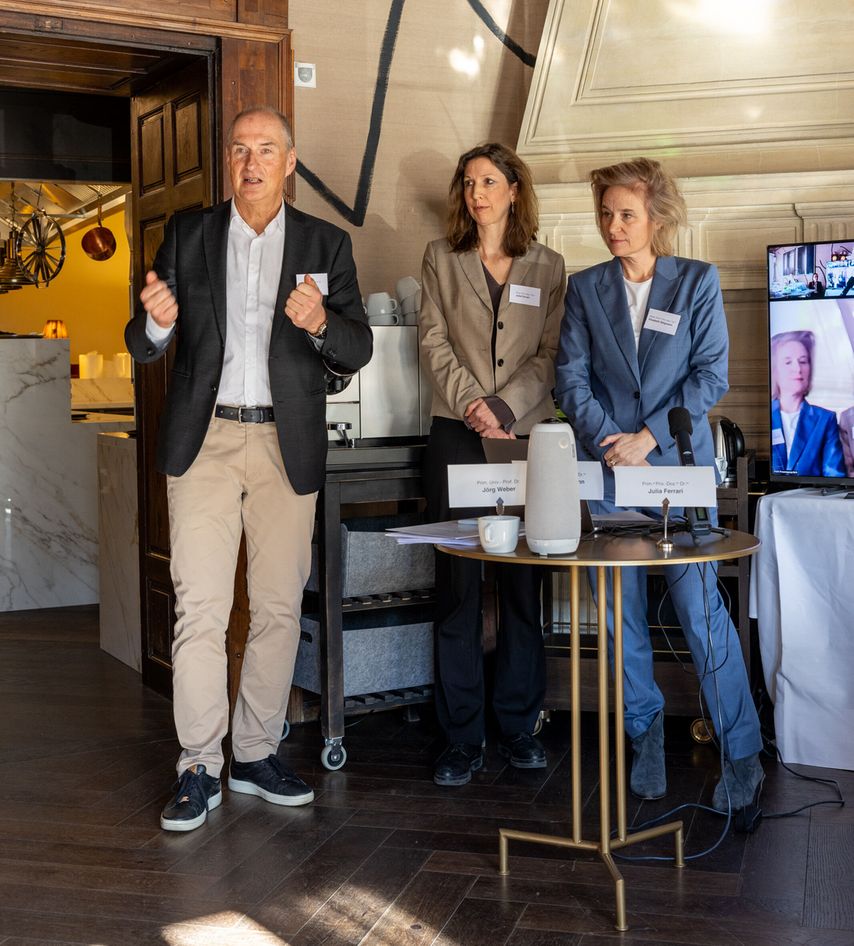ÖGN-Pressekonferenz unter dem Motto „Herausforderungen annehmen“
Im Vorfeld zur Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) lud die ÖGN heimische Medienvertreter:innen am 6. März zum Pressegesprächin Wien ein. Es wurde viel über neue Alzheimertherapien, Lebensstilmodifikation, aber auch über die Erfassung von Gesundheitsdaten diskutiert.
Univ.-Prof. Dr. Jörg Weber begrüßte die Anwesenden und übergab das Wort an den Kongresspräsidenten Univ.-Prof. Dr. Stefan Kiechl, der aus Innsbruck per Video zugeschalten war: „Rund 1000 Teilnehmer:innen treffen heuer wieder in Innsbruck zusammen, unter dem diesjährigen Motto ‚Herausforderungen annehmen‘.“ Das Motto steht sinnbildlich für den Wandel der Neurologie von einem rein diagnostischen zu einem therapeutischen Fach. „Fast alle neurologischen Leiden – von gewissen Krebsformen abgesehen – können heutzutage erfolgreich behandelt werden“, erklärte Kiechl.
Neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bringen neue Herausforderungen für den Beruf des Neurologen/der Neurologin, wie Univ.-Prof. Dr. Jörg Weber, links im Bild, erklärt. Neben ihm von links nach rechts: Priv.-Doz. Dr. Julia Ferrari und Assoc. Prof. Priv.-Doz. Elisabeth Stögmann
Modifizierbare Risikofaktoren
Aus den dazugewonnenen Möglichkeiten für Diagnostik und Therapie folgt auch Verantwortung. Daher betonen alle Redner:innen den Stellenwert von Prävention und der Modifikation von Risikofaktoren. „Hirngesundheit heißt Lebensqualität. Ein Verlust der Hirngesundheit geht mit einem Verlust der Autonomie einher“, betont Weber. Priv.-Doz. Dr. Julia Ferrari führt aus, dass es um die Krankheitslast in der Bevölkerung sowie die durch Krankheit und Behinderung verlorenen guten Lebensjahre geht. Weltweit sind neurologische Krankheiten eine Hauptursache für in Behinderung verbrachte Lebensjahre. Aber: „Wenn man Risikofaktoren minimiert, kann man viele neurologische Erkrankungen verhindern“, erklärt Ferrari.
Durch gezielte Lebensstilmodifikation wie gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und das Management anderer Risikofaktoren kann das Risiko für Schlaganfall um bis zu 80%, das für Demenz um 45% und das für die Entwicklung einer metabolischen Neuropathie um bis zu69% gesenkt werden. Deshalb ist es wichtig, dass in der Gesellschaft das Bewusstsein dafür steigt. „Es gibt oft von Patient:innen den Wunsch, lieber eine Tablette zu nehmen, als den Lebensstil zu ändern“, meint Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Elisabeth Stögmann. Dabei ist aber wichtig, den Patient:innen auch für ihre Lebenssituation passende Empfehlungen geben zu können. „Bei eingeschränkter Beweglichkeit oder Zeit haben sich sogenannte Excercise Snacks – also zum Beispiel 30 Minuten aufgeteilt auf 30 kleine Einheiten – bewährt“, erklärt Ass. Prof. Dr. Atbin Djamshidian.
Neue Therapien für die Alzheimerkrankheit stehen vor der Tür
Neben der Lebensstilmodifikation werden große Erwartungen in die neuen Antikörperpräparate gegen Amyloid-β-Plaques gesetzt. Hier fiel entzwischen die Entscheidung der EU-Kommission für die Zulassung von Lecanemab. Donanemab, eine ebenfalls gegen Amyloid-β gerichtete Substanz, erhielt bisher noch keine Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA).
Mit der Marktzulassung von Antikörperpräparaten bei Morbus Alzheimer werden weitreichende Veränderungen für die Behandlung von Alzheimerpatient:innen erwartet. Die Frühdiagnostik bekommt damit einen neuen Stellenwert. Schließlich lassen sich die pathologischen Veränderungen bereits 15 bis 20 Jahre vor der klinischen Manifestation diagnostizieren; auch wenn die Alzheimererkankung nicht bei all diesen Patient:innen ausbricht. Bisher konnten Betroffene aber wenig mit der Information anfangen. Dies ändert sich nun mit den neuen krankheitsmodifizierenden Therapien, die vor der Tür stehen. Zur Versorgung und Diagnostik gab es viele Fragen aus dem Publikum. Stögmann nutzte die Gelegenheit, um das Stufenmodell der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft (ÖAG) vorzustellen. „Im Idealfall fängt die Diagnostik beim Hausarzt an, der einen ersten Screeningtest macht. Danach werden beim Facharzt ein MRT und neuropsychologische Diagnostik zur weiteren Abklärung durchgeführt“, erklärt Stögmann. Bei guter Frühdiagnostik soll man verhindern können, dass eine leichte kognitive Störung zu einer Demenz wird und in Zukunft frühzeitig Antikörperpräparate anwenden können. Für ein Screening von Gesunden sind die Tests noch zu ungenau und die Therapie ist noch nicht ausreichend. Ferrari stellt klar: „Frühdiagnostik von Alzheimerdemenz soll erst bei klinischen Symptomen – Leitsymptom Vergesslichkeit – stattfinden.“
Schlaganfälle: gut akut versorgt, Nachversorgung kommt zu kurz
Neben Morbus Alzheimer wurde auch über die Erfolge und Herausforderungen anderer neurologischer Krankheiten gesprochen. Kiechl referierte dazu zum Thema Schlaganfall: „Den akuten Schlaganfall können wir mittlerweile sehr gut behandeln.“ Die Zahlen sprechen für sich: Nach drei Monaten sind 65–70% der Betroffenen in Österreich wieder funktionell unabhängig. „Was viele aber nicht wissen, ist, dass es sich bei dem Schlaganfall auch um eine chronische Erkrankung handelt, die mit Fatigue, Demenz und Depression einhergeht“, erklärt Kiechl. Dem kann mittlerweile gut mit einer gezielten Nachbetreuung, der sogenannten Post-Stroke-Care, entgegengewirkt werden. Wichtig ist, ein Augenmerk für Komborbiditäten und Risikofaktoren zu haben. So können Schlafstörungen und Depressionen das Risiko für das Auftreten eines Schlaganfall erheblich steigern.
Priv.-Doz. Dr. Bettina Pfausler erinnert daran, dass auch erheblich langer Schlaf ein Warnsignal sein kann. Hierbei geht es um dauerhaft 10–15 Stunden langen Schlaf, der auf eine Depression hinweisen kann. Auch die Versorgung und Nachbehandlung kleiner Schlaganfälle sollten nicht zu kurz kommen, da diese oftmals mit dem Risiko weiterer Schlaganfälle einhergehen.
Bei Morbus Parkinson noch Luft nach oben
Weniger von Aufbruchstimmung geprägt sind die Aussichten zu Morbus Parkinson. „Bei der Parkinsonkrankheit sehen wir die am stärksten steigende Inzidenz und es gibt keine Diagnostik, die vergleichbar ist mit jener, die wir bei Alzheimer zur Verfügung haben“, erklärt Djamsidian, der ebenfalls aus Innsbruck zugeschaltet ist. Zu Biomarkerdiagnostik wird daher noch geforscht. Denn auch hier gilt: „Früherkennung ist wichtig, um rechtzeitig zu behandeln und Komplikationen vorzubeugen“, so Djamshidian.
Zudem kann auch bei der Parkinsonkrankheit viel mit Prävention erreicht werden. Hierzu gehört ebenso, dass Betroffene bei sich einschleichendem Hörverlust mit Hörgeräten versorgt werden.
Forderungen an Politik und Gesellschaft
Großes Interesse gab es daran, welche Forderungen die Referent:innen an Gesellschaft und Politik haben. Neben dem Wunsch, dass der Stufenplan der ÖAG auch von der Politik übernommen wird, ging es hier auch um das Thema Gesundheitsdaten. Schließlich gibt es derzeit auch noch keine erfassten Daten über die Frühstadien von Demenz, sondern nur epidemiologische Hochrechnungen. Wobei bei diesem Punkt die Diagnostik selbst ein Teil des Problems ist. Es stelle sich schließlich auch die Frage: „Wie viele Vorstadien von Demenz haben wir?“, so Stögmann. Dabei spiele der Wandel von rein klinischen Diagnosekriterien zu vorrangig über biologische Marker definierte Kriterien mit eine Rolle. Die ÖAG ist hier seit mehreren Jahren dabei, zusammen mit dem Ministerium ein Qualitätsregister zu etablieren.
Mit der „leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung“ gibt es bereits ein gutes Beispiel für den Umgang mit Gesundheitsdaten, das eine pseudonymisierte Auswertung erlaubt. Bei Schlaganfall können somit auch Trajektorien gezogen werden, wenn ein Patient ein Jahr nach Entlassung wieder im Spital landet. Hier endlich auch eine Lösung für Demenz zu schaffen, sehen die Redner:innen als Aufgabe der neuen Regierung an. Zudem wünschte sich das Podium, dass das Bewusstsein für Gesundheit in der Bevölkerung steigt. „Prävention und krankheitsmodifizierende Therapien schließen sich aber nicht aus“, stellt Stögmann klar. Neben Sport und Bewegung, sind relevante Lebensstilfaktoren auch Zucker, Alkohol, Cholesterin und Luftverschmutzung.
Quelle:
Pressekonferenz der ÖGN am 6.März 2025 in Wien
Das könnte Sie auch interessieren:
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...
Nahrungsergänzungsmittel bei ME/CFS: neue Hoffnung oder falsche Versprechen?
Chronische Erschöpfung, die nicht vergeht, Schmerzen, Konzentrationsprobleme, ein Leben in Zeitlupe. Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) betrifft weltweit ...