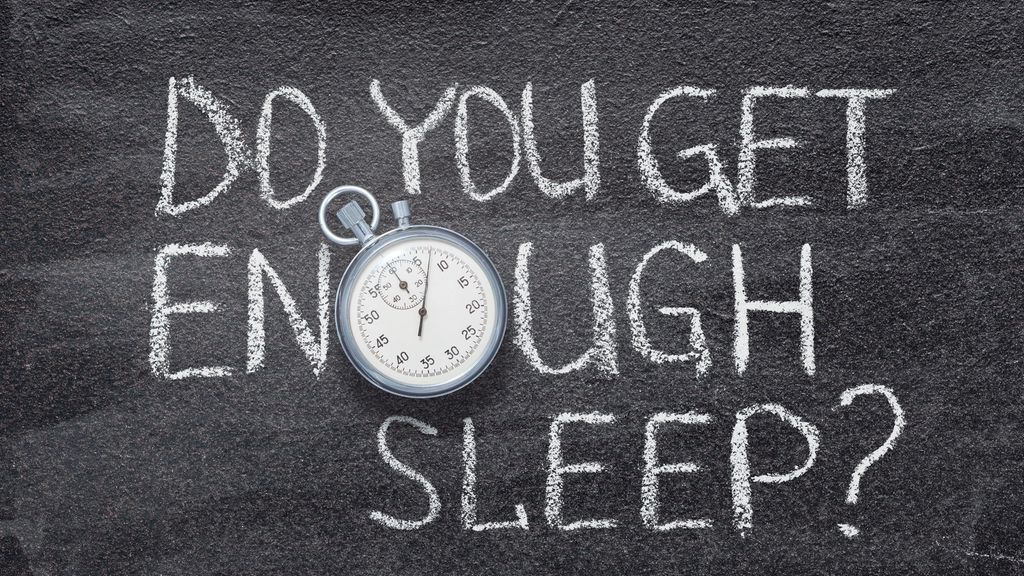
Kann Schlaf Neurodegeneration vorhersagen?
Autorin:
Dr. Ambra Stefani, PhD
Schlaflabor
Universitätsklinik für Neurologie
Innsbruck
E-Mail: ambra.stefani@i-med.ac.at
Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Biologisch gesehen ist es daher naheliegend, dass der Schlaf eine lebensnotwendige Funktion erfüllen muss. Auch wenn manche die Schlafzeit gerne abkürzen würden, um mehr vom Tag zu haben: Das wäre aus verschiedenen Gründen keine gute Idee.
Keypoints
-
Der Zusammenhang zwischen Schlaf und Neurodegeneration lässt sich folgendermaßen beschreiben: Neurodegenerative Prozesse führen zu Schlafstörungen, und Störungen des Schlafes tragen zur Neurodegeneration bei.
-
Die Beseitigung von fehlgefaltetemAmyloid-β, Tau, α-Synuclein und anderen Proteinen im Gehirn wird durch die vermehrte Zufuhr von interstitiellen Flüssigkeiten im Gehirn (durch das glymphatische System) erleichtert, die stark mit dem Tiefschlaf assoziiert ist.
-
Der Schlaf ist also eine Säule der Hirngesundheit.
-
Veränderungen im Schlaf können eine Neurodegeneration vorhersagen.
Die Funktionen des Schlafs sind noch nicht vollständig geklärt, allerdings ist ausreichender und guter Schlaf notwendig für verschiedene kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Entscheidungsfindung usw. Abgesehen davon gibt es einen bidirektionalen Link zwischen Schlaf und Neurodegeneration. Ein Überblick über diese Zusammenhänge wird im Folgenden verschafft.
Der Schlaf ist kein passiver Zustand, sondern ein stark regulierter. Mehrere Hirnregionen und -bahnen sind an der Förderung von Schlaf und Wachsein beteiligt, außerdem modulatorische Flip-Flop-Schalter mit einer gegenseitigen Hemmung, vor allem zwischen dem präoptischen Areal und den Monoaminen sowie zwischen dem sublaterodorsalen Nukleus und dem ventrolateralen periaquäduktalen Grau/dem lateralen pontinen Tegmentum. Außerhalb dieser Systeme befinden sich die zustandsstabilisierenden Hormone im lateralen hypothalamischen Areal und die umwelt-/organismusadaptiven Eingänge, die durch den dorsomedialen Hypothalamus integriert werden.1
Schlafstörungen bei neurodegenerativen Erkrankungen
Da viele Hirnareale und Systeme in die Schlafregulierung involviert sind, ist es nicht überraschend, dass diese bei Patient:innen mit neurodegenerativen Erkrankungen vom zugrunde liegenden neurodegenerativen Prozess betroffen sind und dass daher Schlafstörungen bei diesen Patient:innen häufig sind.2 Fokale und Netzwerkprobleme im Zusammenhang mit der Ausbreitung fehlgefalteter Proteine und der ortsspezifischen Anfälligkeit bei Proteinopathien sind der Grund dafür, dass unterschiedliche Schlafphänotypen mit verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Diese Veränderungen im Schlaf sind durch eine Routine-Video-Polysomnographie nicht immer erkennbar, aber Analysen der Schlafmikrostruktur, wie z.B. durch Machine-Learning-Methoden, können mehr erkennen. Eine rezente Studie zeigte z.B., dass solche Methoden anhand elektroenzephalografischer Merkmale im Schlaf Patient:innen mit Demenz, solche mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und kognitiv unauffällige Kontrollen unterscheiden können.3
Änderungen im Schlaf sind aber bereits in den Frühphasen neurodegenerativer Erkrankungen vorhanden. So ist z.B. mittlerweile bekannt, dass es in der Frühphase einer Alzheimererkrankung zu einer reduzierten Schlafeffizienz kommt und dass dabei auch Schlafapnoe und/oder Tagesmüdigkeit häufig sind; oder dass eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung in der Frühphase von Alpha-Synucleinopathien (Parkinsonerkrankung, Demenz mit Lewy-Körperchen, Multisystematrophie) auftritt, auch mehrere Jahre (in manchen Fälle über 10 Jahre) bevor die Patient:innen eine Bewegungsstörung oder kognitive Störungen entwickeln.4
Schlecht schlafen: Ursache für oder Auswirkung von Neurodegeneration?
Die Frage ist daher: Sind Schlafstörungen ein Zeichen des neurodegenerativen Prozesses oder tragen sie zur Neurodegeneration bei? Basierend auf den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen: am ehesten beides. Und es ist sehr schwer, zu entflechten, was zuerst kommt.
Am Beispiel der Alzheimererkrankung: Durch die Neurodegeneration kommt es zu einer Schlaffragmentierung, welche u.a. zu inflammatorischem Stress und zu übermäßiger Amyloid-β-Freigabe führt, mit darauffolgender erhöhter Anfälligkeit für eine Alzheimererkrankung. Inflammatorischer und hypoxischer Stress können aber auch eine Folge von Schlaffragmentierung aus anderen Gründen oder von Schlafapnoe sein und wiederum zur erhöhten Anfälligkeit für eine Alzheimererkrankung führen.5
Wie genau kommt es dazu? Dies hängt zumindest teilweise mit dem glymphatischen System zusammen, das für die Beseitigung von Abfallstoffen im Gehirn zuständig ist. Die Beseitigung von Amyloid-β, Tau, α-Synuclein und anderen Proteinen im Gehirn wird durch die vermehrte Zufuhr von interstitiellen Flüssigkeiten im Gehirn erleichtert, die stark mit dem Tiefschlaf assoziiert ist.
Durch verminderten, fragmentierten und zirkadian gestörten Schlaf erhöhen sich die neuronale Aktivität und damit auch die Produktion toxischer Proteine – wie von Amyloid-β, hyperphosphoryliertem Tau und α-Synuclein – sowie die Akkumulation dieser Proteine als Folge der verringerten glymphatischen Clearance. Darüber hinaus verstärken erhöhte Entzündungsprozesse (z.B. chronische Glia-Aktivierung), sowie die Produktion exzitotoxischer reaktiver Sauerstoffspezies und eine dysregulierte antioxidative Aktivität die neuronalen und synaptischen Schäden, die zu Neurodegeneration führen und weitere Schlaf-wach- und zirkadiane Störungen fördern.1
Schlafstörungen als Biomarkerfür neurologische Erkrankungen
Der Schlaf ist also eine Säule der Hirngesundheit. Kann man ausgehend von diesem Konzept die Schlussfolgerung ziehen, dass Veränderungen im Schlaf eine Neurodegeneration vorhersagen können? Eine Studie des Schlaflabors der Medizinischen Universität Innsbruck zeigte, dass eine Abnahme der Schlafeffizienz, des Tiefschlafs oder des REM-Schlafs mit einem erhöhten Risiko für das langfristige Auftreten von Neurodegeneration verbunden war, während eine Abnahme der nächtlichen Wachzeiten zu einer Verringerung des Risikos führte.6 Schlaf kann daher als Marker von Neurodegeneration gesehen werden.
Während die Beeinträchtigung des Schlafs und des zirkadianen Rhythmus z.T. mit dem natürlichen Alterungsprozess zusammenhängen kann, kann eine Reihe äußerer Einflüsse das Problem noch verschärfen. Kann denn eine Verbesserung des Schlafs die Progression einer neurodegenerativen Erkrankung beeinflussen? Eine Studie hat sich mit den Konsequenzen der reziproken Beziehung zwischen Amyloid-β, Tiefschlaf und Gedächtnisfunktion unter verschiedenen Umständen und mit dem potenziellen Nutzen des Schlafs als neuer Biomarker beschäftigt. Bei gesunden älteren Erwachsenen mit geringer Amyloid-β-Belastung ist die Qualität des Tiefschlafs hoch, was die Hippocampus-abhängige Gedächtniskonsolidierung erleichtert. Bei älteren Erwachsenen mit Amyloid-β-Belastung ist hingegen die Qualität des Tiefschlafs gering, was zu einer beeinträchtigten Gedächtniskonsolidierung führt. Sollte jedoch die Tiefschlafqualität durch therapeutische Schlafintervention bei Amyloid-β-positiven älteren Erwachsenen verbessert werden, müsste die Gedächtniskonsolidierung durch zwei sich nicht gegenseitig ausschließende Wege verbessert werden: i) durch Minimierung der negativen Auswirkungen der Amyloid-β-Belastung auf die schlafabhängige Gedächtnisverarbeitung und/oder ii) durch Erleichterung einer größeren glymphatischen Aβ-Clearance.7
Man könnte sogar die Hypothese aufstellen: Bereits wenn keine prodromale oder präklinische neurodegenerative Erkrankung besteht, sondern nur Risikofaktoren, könnte gute Schlafqualität der Neurodegeneration vorbeugen.
Literatur:
1 Schneider L: Neurobiology and neuroprotective benefits of sleep. Continuum (Minneap Minn) 2020; 26(4): 848-70 2 Iranzo A: Sleep in neurodegenerative diseases. Sleep Med Clin 2016; 11(1): 1-18 3 Ye EM et al.: Dementia detection from brain activity during sleep. Sleep 2023; 46(3): zsac286 4 Högl B et al.: Idiopathic REM sleep behaviour disorder and neurodegeneration - an update. Nat Rev Neurol 2018; 14(1): 40-55 5 Ju YE et al.: Sleep quality and preclinical Alzheimer disease. JAMA Neurol 2013; 70(5): 587-93 6 Ibrahim A et al.: Sleep features and long-term incident neurodegeneration: a polysomnographic study. medRxiv 2023.03.23.23287636; doi: https://doi.org/10.1101/2023.03.23.23287636 7 Mander BA et al.: Sleep: A novel mechanistic pathway, biomarker, and treatment target in the pathology of Alzheimer’s disease? Trends Neurosci 2016; 39(8): 552-66
Das könnte Sie auch interessieren:
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...
Nahrungsergänzungsmittel bei ME/CFS: neue Hoffnung oder falsche Versprechen?
Chronische Erschöpfung, die nicht vergeht, Schmerzen, Konzentrationsprobleme, ein Leben in Zeitlupe. Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) betrifft weltweit ...


