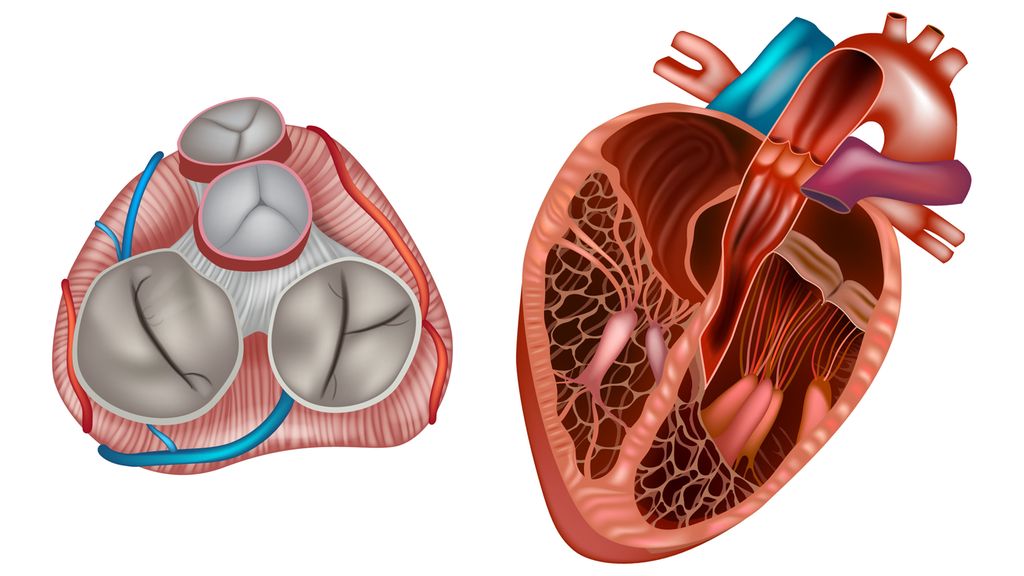
Was sich bei Klappenerkrankungen durch die neuen ESC-Guidelines ändert
Autor:
Priv.-Doz. DDr. Robert Zilberszac, PhD, EDIC
Universitätsklinik für Innere Medizin II
Abteilung für Kardiologie
Medizinische Universität Wien
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Um dem großen Wissenszuwachs im Bereich der Klappenerkrankungen Rechnung zu tragen, hat die ESC 2021 neue Guidelines herausgegeben.1 Für Sie die wesentlichen Neuerungen im kurzen Überblick.
Keypoints
-
Die neuen ESC-Guidelines bieten:
-
eine stärkere Einbindung interventioneller Verfahren,
-
frühere Cut-offs zur Klappensanierung bei asymptomatischen Patienten und
-
klare Kriterien zur Indikationsstellung bei TAVI vs. Chirurgie der Aortenklappenstenose.
Aortenklappe
Asymptomatische Aortenklappeninsuffizienz
Die bisherigen Cut-offs für die Indikation zum Klappenersatz wurden insofern angepasst, als nun der linksventrikuläre enddiastolische Diameter (mit einem bisherigen Cut-off von >70mm) nicht mehr berücksichtigt wird. Die bereits bestehenden Grenzwerte, die den endsystolischen Diameter (>50mm, bzw >25mm/m2 Körperoberfläche) und die linksventrikuläre Auswurffraktion (<50%) umfassen, bleiben bestehen. Hier wird nun aber zusätzlich bei niedrigem operativem Risiko eine IIb-Indikation zur elektiven Operation gestellt, wenn der endsystolische Diameter bei >20mm/m2 Körperoberfläche oder die linksventrikuläre Auswurffraktion bei <55% liegt.
Asymptomatische Aortenklappenstenose
Der Cut-off für die Indikation zum Klappenersatz bei asymptomatischer linksventrikulärer Dysfunktion wurde um eine linksventrikuläre Auswurffraktion <55% (Empfehlungsgrad IIa) zusätzlich zu dem bereits bestehenden Grenzwert von <50% (Empfehlungsgrad Ib) erweitert. Die pulmonale Hypertension, welche in den bisherigen Guidelines noch eine Rolle gespielt hat, wird nun nicht mehr berücksichtigt. Weiterhin gelten 3-fach über die alters- und geschlechtsspezifische Norm erhöhte BNP-Werte sowie eine rasche hämodynamische Progression der Stenose (≥0,3m/s/Jahr) bei stark verkalkter Klappe als IIa-Indikation zum elektiven Aortenklappenersatz. Neues ist hier auch bezüglich der OP-Indikation „höchstgradige Aortenstenose“ zu berichten: Der Cut-off hierfür wurde von einer maximalen Flussgeschwindigkeit von 5,5 auf 5m/s gesenkt. Wurde in den Guidelines von 2017 für asymptomatische Patienten noch ausschließlich der chirurgische Klappenersatz berücksichtigt, so wird dies in den neuen Guidelines neutraler formuliert („Intervention should be considered...“).
TAVI vs. Chirurgie
Hervorgehoben wird die Wichtigkeit des Heart Teams bei der Indikationsstellung bzgl. des Therapieverfahrens und es wird nun auch ausdrücklich die Einbindung des Patientenwunsches in die Entscheidungsfindung betont. Der chirurgische Klappenersatz wird nun empfohlen für Patienten mit niedrigem Risiko, definiert als Alter <75 Jahre und STS-PROM/EuroSCORE II <4%. Die TAVI wird empfohlen, wenn das Patientenalter ≥75 Jahre ist oder der STS-PROM/EuroSCORE II >8% liegt bzw. wenn die Patienten inoperabel sind.
Mitralklappe
Asymptomatische primäre Mitralklappeninsuffizienz
Der Cut-off zur OP-Indikation bezüglich des linksventrikulären endsystolischen Diameters wurde von ≥45mm auf ≥40mm herabgesetzt, der Cut-off für die linksventrikuläre Auswurffraktion bleibt weiter bei 60%. Ebenso bleiben neu aufgetretenes Vorhofflimmern bzw. Lungenhochdruck (definiert als echokardiografisch geschätzter systolischer Pulmonalisdruck ≥50mmHg) als OP-Indikationen bestehen. Auch bei asymptomatischen Patienten, bei denen all diese Kriterien nicht bestehen, darf eine elektive Mitralklappenrekonstruktion in Erwägung gezogen werden, wenn der linke Vorhof deutlich dilatiert ist (Volumsindex ≥60ml/m2 oder Durchmesser ≥55mm), ein niedriges operatives Risiko gegeben ist und eine hohe Wahrscheinlichkeit für Rekonstruierbarkeit der Klappe besteht.
Sekundäre (ischämisch-funktionelle) Mitralklappeninsuffizienz
Bei operablen Patienten wird in der neuen Guideline unabhängig von der Ventrikelfunktion (vormals Cut-off ≥30%) klar zu einer konkomitanten Sanierung der Mitralklappe bei gleichzeitig geplanter Bypassoperation geraten. Bei inoperablen Patienten wird ein schrittweises Vorgehen mit interventioneller Revaskularisierung, gefolgt von einem interventionellem Edge-to-edge-Verfahren (z.B. MitraClip), empfohlen, sofern die Mitralinsuffizienz durch die Revaskularisierung alleine nicht reduziert werden kann.
Sekundäre (nichtischämisch-funktionelle) Mitralklappeninsuffizienz
Der Grad der Empfehlung eines interventionellen Edge-to-edge-Verfahrens bei inoperablen Patienten wurde von IIb auf IIa aufgewertet. Es wird zwar weiterhin verlangt, dass diese Patienten Kriterien erfüllen sollen, die ein Ansprechen auf die Therapie wahrscheinlich machen, jedoch wird nicht mehr, wie in den Guidelines von 2017, eine voll ausgebaute medikamentöse Herzinsuffizienztherapie inkl. CRT (falls indiziert) eingefordert,damit die Patienten überhaupt für diese Verfahren infrage kommen. Auch die linksventrikuläre Auswurffraktion soll bei diesen Überlegungen keine Rolle mehr spielen. Selbst für Patienten, bei denen ein Therapieansprechen nicht sehr wahrscheinlich ist, kann, nach sorgfältiger Evaluierung durch das Heart Team, ein solches Verfahren angedacht werden (Grad der Empfehlung: IIb), um möglicherweise die Zeit bis zu einer Herztransplantation oder LVAD-Implantation zu überbrücken.
Trikuspidalklappe
Primäre Operationsindikationen bei primärer Trikuspidalklappeninsuffizienz
Es gilt weiterhin eine IIa-Empfehlung für eine operative Sanierung, wenn operable Patienten eine rechtsventrikuläre Dilatation aufweisen (die Rechtsventrikelfunktion wird nicht mehr explizit erwähnt), selbst wenn sie keine oder nur milde Beschwerden haben. Symptomatische Patienten sollen dann operiert werden, wenn sie noch keine schwere rechtsventrikuläre Dysfunktion aufweisen.
Primäre Operations-/Interventionsindikationen bei sekundärer Trikuspidalklappeninsuffizienz
Erstmals werden hier auch interventionelle Verfahren in den Guidelines berücksichtigt. Für inoperable symptomatische Patienten mit einer höhergradigen sekundären Trikuspidalinsuffizienz gilt nun eine IIb-Empfehlung einer interventionellen Sanierung der Klappe, sofern diese in einem erfahrenen, spezialisierten Herzklappenzentrum durchgeführt wird.
Die Indikation zur Chirurgie besteht für operable Patienten, die entweder Symptome oder eine rechtsventrikuläre Dilatation aufweisen, sofern keine schwerwiegende rechts- oder linksventrikuläre Dysfunktion und kein schwerer Lungenhochdruck vorliegen. Die Ätiologie der Trikuspidalinsuffizienz spielt hier keine Rolle mehr (vormals galt diese Empfehlung nur für Patienten, die nach einer linksseitigen Klappenoperation eine Trikuspidalinsuffizienz entwickelt hatten).
Fazit
Zusammengefasst bieten die neuen ESC Guidelines eine stärkere Einbindung interventioneller Verfahren, frühere Cut-offs zur Klappensanierung bei asymptomatischen Patienten und klare Kriterien zur Indikationsstellung bei TAVI vs. Chirurgie der Aortenklappenstenose.
Literatur:
1 Alec Vahanian et al. for the ESC/EACTS Scientific Document Group: 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2021; 00, 1-72. doi:10.1093/eurheartj/ehab395
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
Neue Wege in der Diagnostik des Vorhofflimmerns
Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung unserer Zeit. Die Folgen reichen von eingeschränkter Lebensqualität und Belastbarkeit bis zu schwerwiegenden Komplikationen wie ...


