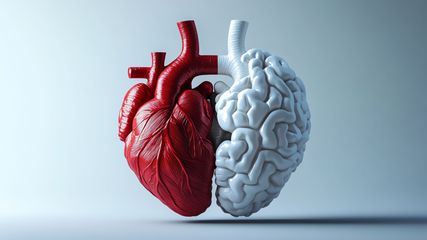Kommen neue Therapien zur Hypertonie?
Bericht: Reno Barth
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Im Rahmen einer Hotline Session des ESC 2025 wurden die Ergebnisse klinischer Studien zu zwei Antihypertensiva mit innovativem Wirkmechanismus vorgestellt, des Aldosteron-Synthase-Inhibitors Baxdrostat sowie des RNA-Interferenz-Therapeutikums Zilebesiran, die die Produktion von Angiotensin in der Leber unterbindet. Während das Studienziel mit Baxdrostat erreicht wurde, waren die Ergebnisse mit Zilebesiran ambivalent, rechtfertigen jedoch weitere klinische Studien.
Aldosteron ist von zentraler Bedeutung sowohl für die Entwicklung von Hypertonie als auch für die resultierenden Endorganschäden, erläutert Prof. Dr. Bryan Williams vom University College London. Die Option, Aldosteron durch Blockade der Mineralokortikoid-Rezeptoren zu blockieren, werde zwar klinisch mit Erfolg eingesetzt, sei jedoch durch dosisabhängige Nebenwirkungen limitiert. Baxdrostat ist ein experimenteller, hochselektiver Inhibitor der Aldosteron-Synthase, der in der Phase-III-Studie BaxHTN in einer Population von knapp 800 Patient:innen mit unkontrollierter oder resistenter Hypertonie untersucht wurde –und das mit Erfolg.
Eine tägliche Dosis von 1mg oder 2mg Baxdrostat führte zu signifikanten Blutdrucksenkungen im Vergleich zu Placebo nach 12 Wochen. Bei 794 analysierten Patient:innen betrugen die placebokorrigierten Reduktionen des systolischen Blutdrucks (SBP) –8,7mmHg für 1mg und –9,8mmHg für 2mg (p<0,0001). Die absoluten Reduktionen betrugen –14,5 und –15,7mmHg für die beiden Baxdrostat-Gruppen sowie –5,8mmHg für Placebo. Die Wirksamkeit war in allen Subgruppen vergleichbar, also unabhängig von Alter, Geschlecht Ethnizität, Body-Mass-Index und Nierenfunktion, wobei Voraussetzung für die Aufnahme in die Studie eine eGFR von mindestens 45ml/min/1,73m2 war. Auch der nächtliche und der durchschnittliche 24-h-Blutdruck nahmen unter Baxdrostat in klinisch relevantem Ausmaß ab. Die Aldosteron-Spiegel gingen unter Baxdrostat innerhalb von 4 Wochen um mindestens 60% zurück und blieben bis Woche 12 auf niedrigem Niveau.
Einen kontrollierten SBP (<130mmHg) erreichten nach 12 Wochen 39,4% der Patient:innen mit 1mg und 40% mit 2mg im Vergleich zu 18,7% in der Placebogruppe. Die Verträglichkeit war gut. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten bei 1,9% (1mg), 3,4% (2mg) und 2,7% (Placebo) der Patient:innen auf. Bei 0,8% (1mg) und 1,5% (2mg) der Patient:innen musste die Behandlung wegen Hyperkaliämie abgebrochen werden. Es gab keine Berichte von adrenokortikaler Insuffizienz. Die Ergebnisse von BaxHTN wurden zeitgleich mit der Präsentation im New England Journal of Medicine publiziert.1 Die Studie wird in einer offenen Verlängerungsphase weitergeführt.
Zilebesiran kommt in die Phase III
Eine gänzlich andere Strategie wird mit dem RNA-Interferenz-Therapeutikum Zilebesiran gewählt. Zilebesiran reguliert die Produktion von Angiotensinogen in der Leber herunter und greift damit an einem höheren Punkt in den RAAS-Pathway ein als andere bislang untersuchten Blutdruck-Medikamente. Ein potenzieller Vorteil von Zilebesiran liegt in der langen Wirkdauer von 6 Monaten nach subkutaner Injektion. Dies könnte angesichts der insgesamt suboptimalen Adhärenz in der Blutdrucktherapie die Ergebnisse verbessern, so Dr. Neha Pagidipati vom Duke Clinical Research Institute in Durham, USA.
Pagidipati präsentierte im Rahmen des ESC 2025 die Daten der Phase-II-Studie KARDIA-3, die die Wirkung von Zilebesiran auf den Blutdruck bei hypertensiven Patient:innen mit hohem kardiovaskulärem Risiko untersuchte. Die 270 Patient:innen mit einem Durchschnittsalter von 67 Jahren hatten einen systolischen Blutdruck von 140–170mmHg und waren bereits auf zwei bis vier Antihypertensiva eingestellt. In dieser Population führte eine Einzeldosis von 300mg Zilebesiran im Vergleich zu Placebo zu einer Reduktion des SBP um 12,3mmHg nach 3 Monaten. Angesichts eines deutlichen Effekts in der Placebogruppe von –7,3 mmHg betrug die Differenz zu Placebo lediglich 5mmHg und verfehlte die statistische Signifikanz. Die Dosierung von Zilebesiran mit 600mg brachte im Vergleich zu 300mg keinen weiteren Vorteil. Die meisten Nebenwirkungen waren mild oder moderat und vorübergehend, mit wenigen ernsthaften Ereignissen (3,8% unter Zilebesiran).
Die Entwicklung von Zilebesiran wird dennoch weitergehen. Denn prädefinierte Subgruppenanalysen zeigen deutliche und signifikante Effekte bei Patient:innen, die bei Einschluss bereits ein Diuretikum als Bestandteil ihrer antihypertensiven Therapie einnahmen. Eine Phase-III-Studie mit harten kardiovaskulären Endpunkten ist geplant. Voraussetzung für den Einschluss wird ein systolischer Blutdruck von mindestens 140mmHg unter stabiler Therapie mit mindestens zwei Antihypertensiva sein, darunter ein Diuretikum.
Quelle:
ESC-Kongress 2025, Hotline Session 4, Vortrag: Williams B.: BaxHTN – Efficacy and safety of the aldosterone synthase inhibitor baxdrostat in patients with uncontrolled or resistant hypertension. Und Vortrag: Pagidipati N: KARDIA-3: Zilebesiran as add-on therapy in adults with hypertension and established cardiovascular disease or at high cardiovascular risk
Literatur:
1Flack JM et al.: Efficacy and safety of baxdrostat in uncontrolled and resistant hypertension. N Engl J Med 2025; doi: 10.1056/NEJMoa2507109. Online ahead of print
Das könnte Sie auch interessieren:
Konsensus zu psychischer Gesundheit und kardiovaskulären Erkrankungen
Die ESC hat in Kooperation mit weiteren Fachgesellschaften ein Konsensus-Statement publiziert,1 das der multidirektionalen Beziehung von psychischen und kardiovaskulären Erkrankungen ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...