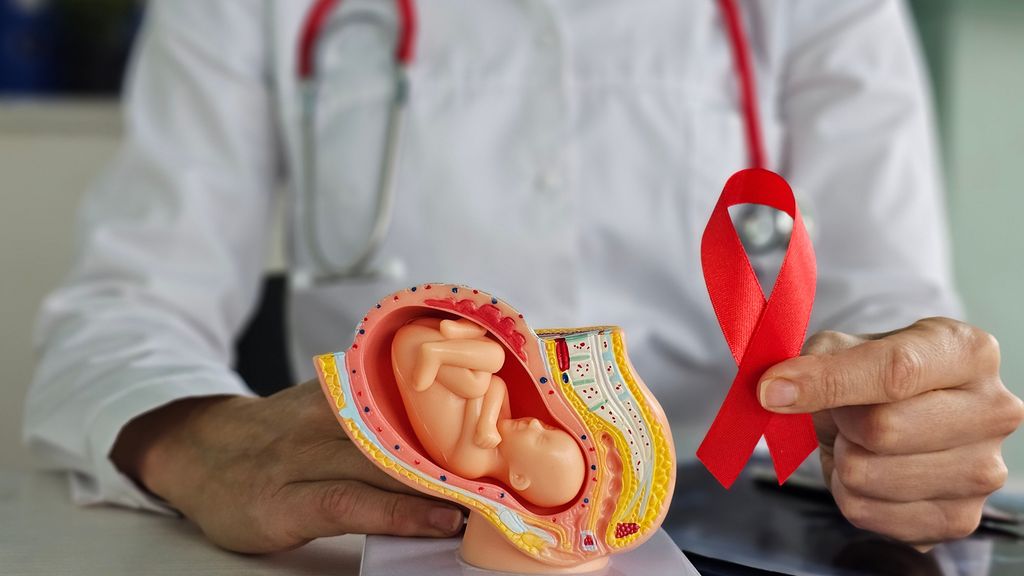
ART bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit
Autorin:
Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Katharina Grabmeier-Pfistershammer
Ambulanz für sexuell-übertragbare Infektionen
AKH Wien
Universitätsklinik für Dermatologie
Medizinische Universität Wien
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die antiretrovirale Therapie (ART) ist bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und in der Stillzeit für Mutter und Kind wichtig und auch gut verträglich. Das Wissen darüber ist vor allem für all jene Fachkreise von besonderer Relevanz, die mit HIV-infizierten Frauen arbeiten. Dabei geht es nicht zuletzt auch darum, die nach wie vor bestehende Stigmatisierung zu reduzieren.
Keypoints
-
Das Risiko für eine vertikale HIV-Infektion lässt sich durch geeignete Maßnahmen auf unter 1% senken.
-
Der Großteil der gängigen HIV-Therapieregime kann in der Schwangerschaft unverändert fortgeführt werden.
-
Schwangere, deren Viruslast zum Zeitpunkt der Geburt unter der Nachweisbarkeitsgrenze liegt, können vaginal entbinden.
-
Ist die Viruslast der Mutter supprimiert, kann das Neugeborene gestillt werden.
UNAIDS verfolgt das Ziel, bis 2030 HIV und Aids bei Kindern zu beenden. 2023 infizierten sich 120000 Kinder zwischen 0 und 14 Jahren weltweit mit HIV, die überwiegende Zahl von ihnen in utero, bei der Geburt oder durch das Stillen.1 Der Großteil dieser Infektionen wäre durch geeignete Maßnahmen, allen voran durch eine zeitgerechte antiretrovirale Therapie bei der werdenden Mutter vermeidbar. Grundvoraussetzung dafür ist es, die mütterliche HIV-Infektion zu kennen – bis zu 40% der vertikalen Transmissionen erfolgen, weil die HIV-Infektion der Mutter nicht bekannt ist. Deswegen empfehlen alle Leitlinien eine HIV-Testung in der frühen Schwangerschaft sowie die Testwiederholung, sollte während der Schwangerschaft ein Risiko für eine mütterliche Neuinfektion bestehen.2,3
HIV-Therapie in der Schwangerschaft
Therapien in der Schwangerschaft zielen für gewöhnlich darauf ab, die werdende Mutter zu behandeln, und müssen in Hinblick auf potenzielle Toxizität für das Ungeborene beurteilt werden. Bei der antiretroviralen Therapie einer Schwangeren verfolgt diese Therapie jedoch zwei Ziele – den Erhalt der Gesundheit der Mutter sowie die Vermeidung der Infektion des Ungeborenen.
Daten zur Sicherheit des Einsatzes von Medikamenten in der Schwangerschaft stehen leider zumeist erst Jahre nach der Zulassung eines Medikaments in ausreichender Zahl zur Verfügung.4 Sie kommen oftmals aus Registern, in die Behandler (freiwillig) melden müssen. Daten zu antiretroviralen Therapien in der Schwangerschaft werden im sogenannten Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) gesammelt.5 Ab 200 beobachteten Expositionen kann eine Beurteilung eines Medikaments erfolgen. Mittlerweile liegen zu fast allen aktuell in der Erstlinientherapie von Menschen mit HIV empfohlenen Medikamenten genügend Daten vor, um den Einsatz in der Schwangerschaft zu rechtfertigen. Jede therapienaive schwangere Frau mit HIV sollte so rasch wie möglich eine antiretrovirale Therapie erhalten.2,3
Für verhältnismäßig viele Frauen mit HIV war eine Schwangerschaft Anlass für einen HIV-Test und führte damit zur HIV-Diagnose. Der Großteil der Frauen mit HIV in Österreich, die schwanger werden, nimmt jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt eine antiretrovirale Therapie ein. Eine hohe Zahl der Schwangerschaften von Frauen mit HIV, in einer rezenten US-Studie sind es über 80%, erfolgt nicht geplant.6 Es ist in vielen Fällen aber möglich, eine laufende antiretrovirale Therapie auch in der Schwangerschaft unverändert fortzuführen, und diese sollte primär auch ohne Unterbrechung beibehalten werden. Es muss bei der Therapieauswahl von Frauen im gebärfähigen Alter und mit Kinderwunsch für gewöhnlich keine Einschränkung gemacht werden und jungen Frauen sollte nicht aufgrund der Tatsache, dass sie schwanger werden könnten, bestimmte Therapieregime vorenthalten werden.
Ziel der antiretroviralen Therapie ist es, die Viruslast der Mutter unter die Nachweisbarkeitsgrenze zu senken und dort zu halten. Dies sollte so früh und rasch wie möglich passieren. Besteht zum Zeitpunkt der Geburt eine virologische Suppression, so kann der Geburtsmodus (vaginale Geburt oder Sectio) rein nach geburtshilflichen Kriterien und dem Wunsch der Mutter gewählt werden.2,3 Eine Sectio bringt bei supprimierter Viruslast keinen Vorteil in Hinblick auf das Übertragungsrisiko der Infektion auf das Kind, ebenso wenig die früher regelmäßig angewandte intrapartale Gabe von Zidovudin. Diese beiden Maßnahmen stellen heutzutage nur mehr Notfallmaßnahmen bei nicht supprimierter Viruslast der Mutter dar, zumeist weil die Diagnose der Mutter erst sehr kurz vor der Geburt gestellt wurde oder überhaupt keine (erfolgreiche) Behandlung in der Schwangerschaft erfolgt ist.
Mutter-auf-Kind-Übertragung bei der Geburt und beim Stillen
Seit der PARTNER-Studie wissen wir, dass Menschen mit HIV und supprimierter Viruslast das Virus auf sexuellem Weg nicht weitergeben; dies ist unter dem Schlagwort U=U, „undetectable=untransmissable“, zusammengefasst.7,8 Zu anderen als dem sexuellen Transmissionsweg gibt es keine großen randomisierten Studien, um U=U zu zeigen, allerdings ist es biologisch plausibel, dass diese Daten in gewisser Weise auf andere Risikosituationen extrapolierbar sind. In einer rezenten französischen Kohortenstudie, die mehr als 5000 Mutter-Kind-Paare verfolgt hat, wurde so – schlüssig – bei Müttern, die bereits zum Zeitpunkt der Konzeption eine ART erhielten und zum Geburtszeitpunkt virologisch supprimiert waren, keine einzige Mutter-auf-Kind-Übertragung beobachtet.9 Aufgrund dieser und anderer Studien kann daher – in Analogie zu sexuellen Risikokontakten – bei supprimierter Viruslast der Mutter während der gesamten Schwangerschaft und bei der Geburt auch auf eine Postexpositionsprophylaxe für das Neugeborene, die sogenannte Neo-PEP, verzichtet werden.2,3
Ähnliche Überlegungen gelten auch für das Stillen. Während die WHO bereits seit Langem für Frauen mit HIV ausschließliches Stillen in den ersten Lebensmonaten empfiehlt, sind Leitlinien aus „High-income“-Ländern noch eher zurückhaltend.10 Lange wurde hier strikt ein Stillverzicht empfohlen, auch weil das Zurückgreifen auf Säuglingsmilch und sauberes Trinkwasser möglich ist. Daten aus Ländern, die der WHO-Empfehlung (gezwungenermaßen) folgen, zeigen aber, dass bei erfolgreicher ART der Mutter das Risiko einer Transmission auf das Kind, wenn auch nicht null, so doch sehr niedrig ist.11 Aufgrund der vielen Vorteile des Stillens – sowohl für das Neugeborene als auch die Mutter – wird in rezenten europäischen und auch den deutsch-österreichischen Leitlinien daher bei supprimierter mütterlicher Viruslast empfohlen, eine gemeinsame Entscheidung von Mutter und Behandler bezüglich des Stillens zu treffen.2,3 Auch wenn gestillt wird, ergibt sich daraus keine Indikation für eine Postexpositionsprophylaxe für das Neugeborene, aber es sollten engmaschige Viruslastkontrollen bei der Mutter durchgeführt werden und bei nachweisbarer Viruslast sollte das Stillen unterbrochen oder beendet werden.
Post- und Präexpositionsprophylaxe
In Schwangerschaft und Stillzeit sind Frauen in Hinblick auf eine HIV-Neuinfektion sehr vulnerabel. Eine akute Infektion geht für gewöhnlich mit einer sehr hohen Viruslast und hoher Wahrscheinlichkeit einer Transmission auf das Un-/Neugeborene einher. Daher sind in Ländern mit hoher HIV-Prävalenz, aber auch bei HIV-negativen Frauen mit einem hohen Risiko für eine HIV-Infektion in Schwangerschaft und Postpartalzeit Präventionsmaßnahmen (und wiederholte Testungen) wichtig. Mittlerweile liegen erste Daten vor, dass der Einsatz einer (lang wirksamen) Präexpositionsprophylaxe in solchen Situationen einen guten Schutz für die (werdende) Mutter gegenüber HIV darstellt und keine negativen Auswirkungen auf den Verlauf einer Schwangerschaft hat.12
Neben klassischen antiretroviralen Wirkstoffen könnten in diesem Szenario in Zukunft auch lang wirksame, breit neutralisierende Antikörper zum Einsatz kommen. Dafür gibt es ebenso erste Daten wie für die Anwendung als Post- und Präexpositionsprophylaxe bei Neugeborenen während des Stillens.13,14 Ein großer Vorteil dieser breit neutralisierenden Antikörper ist ihre lange Wirksamkeit über 3 Monate und ihre gute Verträglichkeit. Nachteile sind neben den zurzeit noch sehr hohen Kosten Transport- und Lagerungserfordernisse sowie die Tatsache, dass aufgrund der Diversität der HI-Viren wahrscheinlich ein einziger „Antikörper-Cocktail“ nicht weltweit in allen Fällen die richtige Mischung darstellen wird.
Zusammenfassung
Eine HIV-Infektion stellt heutzutage bei rechtzeitiger Diagnose und regelrechter Therapie zwar eine chronische, aber eine gut behandelbare Erkrankung dar. Durch die antiretrovirale Therapie und die damit einhergehende virologische Suppression und immunologische Stabilisierung ist die Lebenserwartung von Menschen mit HIV ähnlich der der Gesamtbevölkerung, wenn keine anderen zusätzlichen Erkrankungen wie z.B. eine Suchterkrankung vorliegen.Eine ganz normale Lebens- und damit auch Familienplanung ist daher möglich. Kinderwunsch, Schwangerschaft und auch Stillen sind unter entsprechenden Begleitmaßnahmen für Mutter und Kind sicher. Das Wissen darüber ist von besonderer Bedeutung in allen Fachkreisen, die mit werdenden und jungen Müttern mit einer HIV-Infektion arbeiten, auch um die Stigmatisierung, die gerade Frauen mit HIV in dieser Situation noch immer oft erleben müssen, zu reduzieren.
Literatur:
1 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 2024: The urgency of now. AIDS at a crossroads. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2024-unaids-global-aids-update_en.pdf ; zuletzt aufgerufen am 8.4.2025 2 Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. (DAIG): S2k-Leitlinie HIV-Therapie in der Schwangerschaft und bei HIV-exponierten Neugeborenen. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/055-002 ; zuletzt aufgerufen am 8.4.2025 3 EACS: Guidelines Version 12.0, October 2023. https://www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf ; zuletzt aufgerufen am 8.4.2025 4 Short WR et al.: Safety data timelines for pregnant individuals with HIV on antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 2024; 79(6): 1472-4 5 The antiretroviral pregnancy registry: https://www.apregistry.com/ ; zuletzt aufgerufen am 8.4.2025 6 Dasgupta S et al.: Sexual and reproductive health among cisgender women with HIV aged 18-44 years. Am J Prev Med 2024; 67(1): 32-45 7 Rodger AJ et al.: Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. Lancet 2019; 393(10189): 2428-38 8 Rodger AJ et al.: Sexual activity without condoms and risk of hiv transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy. JAMA 2016; 316(2): 171-81 9 Sibiude J et al.: Update of perinatal human immunodeficiency virus type 1 transmission in France: Zero transmission for 5482 mothers on continuous antiretroviral therapy from conception and with undetectable viral load at delivery. Clin Infect Dis 2023; 76(3): e590-8 10 Keane A et al.: Guidelines and practice of breastfeeding in women living with HIV-results from the European INSURE survey. HIV Med 2024; 25(3): 391-7 11 Powers JS et al.: Human immunodeficiency virus and breastfeeding: clinical considerations and mechanisms of transmission in the modern era of combined antiretroviral therapy. Clin Perinatol 2024; 51(4): 783-99 12 Delany-Moretlwe S et al.: Evaluation of long-acting cabotegravir safety and pharmacokinetics in pregnant women in eastern and southern Africa: a secondary analysis of HPTN 084. J Int AIDS Soc 2025; 28(1): e26401 13 Cunningham CK et al.: Tolerability, and pharmacokinetics of long-acting broadly neutralizing HIV-1 monoclonal antibody VRC07-523LS in newborn infants exposed to HIV-1. J Pediatric Infect Dis Soc 2025; 14(2): piaf002 14 Van de Perre P et al.: Preventing breast milk HIV transmission using broadly neutralizing monoclonal antibodies: One size does not fit all. Immun Inflamm Dis 2024; 12(3): e1216
Das könnte Sie auch interessieren:
Zentrum für sexuelle Gesundheit in Wien: integrierte Versorgung bei HIV und STI
Die Aids Hilfe Wien ist insbesondere in der HIV- und STI-Prävention und -Testung eine der etabliertesten Einrichtungen in Österreich. Trotz der Erfolge in Beratung, Testangeboten und ...
Infektionen in Krankenhäusern in Deutschland
Welche Infektionen führen häufig zu Hospitalisierungen und wie viel kostet die stationäre Behandlung von Infektionskrankheiten? Eine deutsche Expert:innengruppe versuchte, diese Fragen ...
Real-World-Erfahrungen: neue Antibiotika im klinischen Einsatz
Neue Betalaktamantibiotika bzw. Betalaktamase-Inhibitoren stellen eine wichtige Erweiterung der Therapieoptionen bei schweren Infektionen dar. Sie sind gegen Carbapenem-resistente ...


