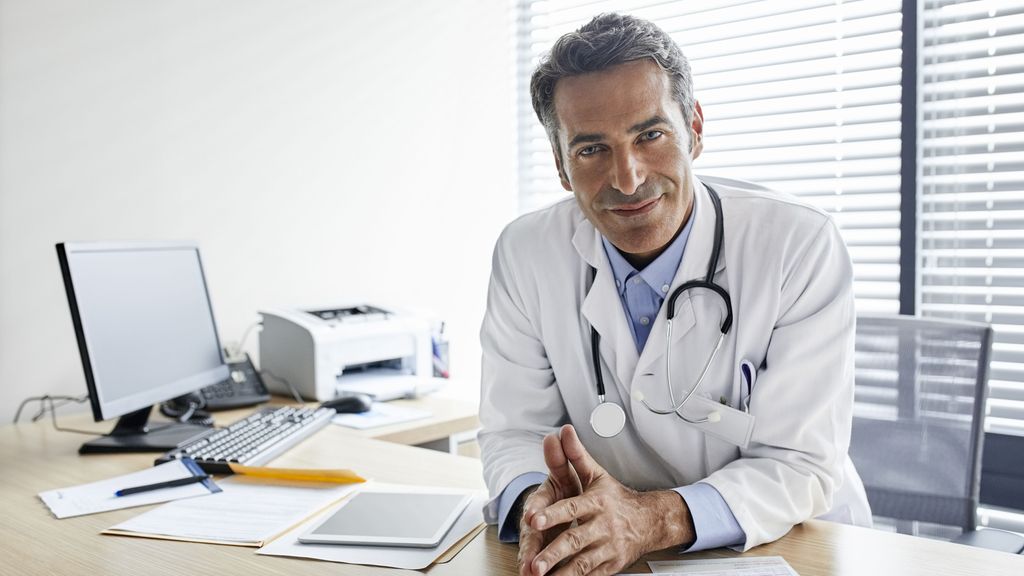
©
Getty Images
Unbelehrbarkeit ist keine Tugend
DAM
Autor:
Dr. Christian Euler
Präsident des ÖHV<br> E-Mail: ch.euler@a1business.at
30
Min. Lesezeit
17.11.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Nach dem Ausstieg der Kollegen aus dem Probebetrieb E-Medikation in Deutschlandsberg ist diese Säule des Reformprojektes ELGA zum dritten Mal an der Realität gescheitert.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Begonnen hat alles 2007 mit dem Salzburger Arzneimittelsicherheitsgurt. Damals haben Apotheker an der Ärzteschaft vorbei angeboten, die Medikation ihrer Kunden auf Verträglichkeit zu prüfen. Basis waren die Daten aus der elektronischen Rezeptabrechnung und ein neues, leistungsstarkes Rechenzentrum der pharmazeutischen Gehaltskasse. Vor allem anderen aber war es die Erkenntnis der Apotheker, dass jemand, der in Zukunft nicht irgendwo die e-card hinzustecken vermag, von der Gesundheitspolitik nicht gesehen, geschweige denn berücksichtigt werden wird. Die österreichische Apothekerschaft investierte 1,3 Mio. Euro in dieses Projekt, das gemeinsam mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger betrieben wurde. Die Stellungnahmen der Gesundheitspolitiker waren euphorisch. Gerettete Menschenleben schwirrten durch den Raum. Doch bald wurde aus Euphorie Agonie.</p> <p>Es folgte 2011 der E-Medikations-Pilotversuch rund um das Sozialmedizinische Zentrum Ost (SMZ Ost) in Wien. Um es kurz zu machen: Im Mai 2012 wurde in einem ausführlichen, vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger in Auftrag gegebenen und vom Institut für medizinische Statistik, Informatik und intelligente Systeme durchgeführten Evaluationsbericht empfohlen, die Idee einer E-Medikation unter der Voraussetzung eines grundlegenden Redesigns, wie im Bericht konkretisiert, weiter zu verfolgen. Mehr konnte man dem Auftraggeber nicht bieten. Das genügte allerdings für die veröffentlichte volle Zufriedenheit des damaligen Hauptverbands-Vorsitzenden Dr. Hans Jörg Schelling, der auf ein österreichweites Rollout drängte.</p> <p>Auch der dritte Anlauf rund um Deutschlandsberg 2016 wurde zur Pleiten-, Pech- und Pannenshow. Immer noch wird vom Akzeptanzmanagement mit der Interaktionsprüfung durch die E-Medikation geworben. Immer noch verspricht man den Patienten Arzneimittelsicherheit durch E-Medikation. Immer noch wurde nicht zur Kenntnis genommen, dass ein qualitätsvolles Programm zur automatisierten Arzneimittelverträglichkeitsprüfung nicht existiert.</p> <p>Schon im 2014 erschienenen ELGA-Handbuch, dessen Hauptautor BMGF-Sektionschef und ELGA-Befürworter Dr. Clemens Auer ist, wird auf Seite 26 festgehalten, dass im ELGA-Gesetz – im Gegensatz zum Pilotversuch – weder eine Wechselwirkungs- noch eine Reichweitenprüfung vorgesehen ist. „… diese Prüfung wird in den Köpfen der ELGA-GDA (Gesundheitsdienstleister) stattfinden.“</p> <p>Die im Evaluationsbericht von 2012 dringend empfohlene Reduktion des Zeitaufwandes und Verbesserung der Alltagstauglichkeit wurden auch 2016 nicht erreicht. Die primär hoch motivierten Probebetriebsteilnehmer verloren trotz intensiver Betreuung und finanzieller Entschädigung den Mut und die Geduld.</p> <p>Es klingt wie ein Zurück an den Start, wenn die Apotheker jetzt wissen lassen, sie könnten das Projekt E-Medikation auch alleine, also ohne Ärzte, durchführen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass der in allen Gesundheitsbelangen unvermeidliche Hofrat Dr. Gerald Bachinger das laut hörbar, mit drohendem Unterton und beängstigender Realitätsferne, auch für möglich hält.</p> <h2>Weniger wäre mehr</h2> <p>Zweifellos ist das Wissen um die Medikation eines Patienten ein sehr guter Weg, sich ein erstes Bild von ihm zu machen. Wenn wir in unseren Diensten auf uns bisher unbekannte Hilfesuchende treffen, ist die Frage „Welche Medikamente nehmen Sie ein?“ Standard. Jedes Medikationseinnahmeschema als Beilage zu einer Zuweisung an einen Fachkollegen ist nicht nur ein Zeichen von Höflichkeit, sondern auch in der Sache hilfreich. So verstehe ich die Sympathie für diese E-Medikation, wie sie von Spitalskollegen wiederholt bekundet wurde. Diese hilfreiche Information wäre aber auch aus einer Arzneimittelhistorie, also der chronologischen Auflistung der verschriebenen Medikamente, zu beziehen, und das müsste nicht einmal elektronisch sein.</p> <p>Wenn eine flächendeckende E-Medikation jedem Zugriffsberechtigten diesen Einblick in die Behandlungsbemühungen gewährte, wäre das viel und – wie ich meine – genug. Ob die Arzneimittel, die verschrieben wurden, auch tatsächlich genommen werden und ob das in der angegebenen Dosierung erfolgt, kann auch das hochgezüchtetste E-Medikations-Programm nicht bestätigen.</p> <p>Der Mut zur Reduktion fehlt, das Wissen um den ärztlichen Arbeitsalltag fehlt. So will man hoch hinaus und kommt gerade deshalb nicht vom Fleck. Die Kosten für diese „Ehrenrunden“ in Zeiten der Kontingentierung von Medikamenten sollen an dieser Stelle nicht thematisiert werden.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Der neue elektronische Eltern-Kind-Pass
Im Jahr 2014 initiierte das Gesundheitsministerium eine interdisziplinäre Plattform zur Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes. Es bedurfte wohl der Androhung der Kündigung der Mutter- ...
Präpartale Stillberatung für ein erfolgreiches Stillen
Im Jahr 1992 wurde von der WHO gemeinsam mit UNICEF die «Baby Friendly Hospital Initiative» (BFHI) begründet. Das Anliegen war, die Grundbedingungen für das Stillen weltweit zu ...
Die stille Kündigung – Quiet Quitting
Das Phänomen Quiet Quitting, das das Verhalten von Mitarbeiter:innen beschreibt, die ihr Engagement in der Arbeit auf ein Minimum reduzieren, betrifft auch den Gesundheitsbereich. Wegen ...


