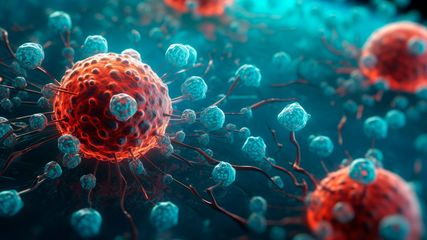©
Getty Images/iStockphoto
Nebenwirkungen der Testosterontherapie
ÖGU Aktuell
30
Min. Lesezeit
14.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Zu den Effekten einer Testosteronsubstitution gibt es zahlreiche Untersuchungen. Häufig wird die Behandlung mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko in Verbindung gebracht. Eine aktuelle Datenbankauswertung, die im März beim Kongress der European Association of Urology (EAU) in London vorgestellt wurde, kam zu differenzierten Ergebnissen. Dr. Julian Hanske, der die Studie in London präsentierte, erklärt im Interview, worauf es dabei ankam.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Die Daten wie vieler Männer haben Sie für Ihre Studie ausgewertet? Und was waren die Einschlusskriterien?</strong><br /> Insgesamt waren es 6844 Männer im Alter von 40 bis 65 Jahren; die Hälfte hatte zwischen 2006 und 2010 Testosteron verschrieben bekommen, die andere Hälfte nicht. Wir haben eine sogenannte Twin-Pair-Analyse vorgenommen. Dabei haben wir für jeden Patienten unter Testosteronersatztherapie einen „Zwilling“ gesucht, der ihm in allen relevanten Aspekten wie Alter, Größe, Gewicht, Lebensumständen, Vorerkrankungen etc. exakt entsprach, aber keine Testosteronbehandlung erhalten hatte.<br /> Ausgeschlossen waren alle Männer mit zuvor erfassten kardiovaskulären Vorerkrankungen, Gerinnungsstörungen (z.B. Faktor-V-Leiden-Mutation), thromboembolischen Ereignissen oder Schlafapnoe, denn wir wollten sicher sein, dass nur die Auswirkungen des Testosterons in die Analyse einfließen.</p> <p><strong>Gibt es Unterschiede zwischen dieser Population und derjenigen anderer Studien, zum Beispiel das Alter oder der Gesundheitszustand?</strong><br /> Der Hauptunterschied ist in der Tat das Alter der Männer. Wir konnten die TRICARE-Datenbank der Versicherung für Angehörige des US-Militärs nutzen. Der Vorteil gegenüber anderen Datenbanken, etwa SEER („Surveillance, Epidemiology, and End Results“) vom National Cancer Institute kombiniert mit Medicare, ist, dass bei TRICARE auch jüngere Patienten erfasst sind.</p> <p><strong><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Urologik_Uro_1703_Weblinks_urologik_uro_1703_seite_20_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="607" />Welche Endpunkte haben Sie definiert und wie sahen die Ergebnisse aus? </strong><br /> Wir haben das eventfreie Überleben („event free survival“, EFS) und das absolute 2-Jahres-Risiko für Thromboembolien, obstruktive Schlafapnoe und kardiovaskuläre Ereignisse wie Myokardinfarkte, Schlaganfälle etc. der beiden Gruppen verglichen. Dabei zeigte sich, dass es hinsichtlich der Thromboembolien keine Unterschiede im EFS beider Gruppen gab (Abb. 1). Dagegen war bei kardiovaskulären Ereignissen das EFS in der Therapiegruppe länger als in der Kontrollgruppe (Abb. 2). Und bei der Schlafapnoe schnitten die Männer der Therapiegruppe schlechter ab als die Kontrollen (Abb. 3). Dies gilt sowohl für das EFS als auch für das 2-Jahres-Risiko. Da es sich bei unserer Untersuchung um eine Datenbankauswertung handelt, können wir aber nur bestätigen, dass ein Zusammenhang zwischen Testosteronsubstitution und Schlafapnoe besteht. Wir können nicht erklären, wie es dazu kommt. Dennoch sollte man das Ergebnis im Hinterkopf behalten, wenn man einen Patienten hinsichtlich einer Testosteronsubstitution berät. Immerhin ist die Schlaf apnoe ein vor allem bei Männern weit verbreitetes Problem und ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Krank heiten.<img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Urologik_Uro_1703_Weblinks_urologik_uro_1703_seite_21_tab2-4.jpg" alt="" width="1088" height="2430" /></p> <p><strong>In früheren Studien wurde die TRT mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko in Verbindung gebracht. Wie erklären Sie sich die unterschiedlichen Resultate?</strong><br /> Auch hier gilt: Die Daten zeigen lediglich den Sachverhalt auf. Über die Ursachen kann man nur spekulieren. Das Alter der Männer könnte eine Rolle spielen. Möglicherweise sind Männer, die sich Testosteron verschreiben lassen, ohnehin agiler und fitter und senken dadurch ihr Risiko eines kardiovaskulären Ereignisses. Einen konkreten Hinweis kann unsere Studie jedoch nicht geben. Dann kann man auch nicht generell von einem protektiven Effekt der TRT bei Herz- und Gefäßkrankheiten sprechen? Nein, das würde viel zu weit greifen und ist durch unsere Untersuchung nicht gedeckt.</p> <p><strong>In die Untersuchung waren auch junge Männer eingeschlossen, die die Behandlung über viele Jahre fortführen müssen. Sind weitere Nachbeobachtungen über einen längeren Zeitraum vorgesehen, um Langzeiteffekte beurteilen zu können?</strong><br /> Auch das ist leider nicht möglich. Einerseits liegt das daran, dass die Männer von TRICARE zu Medicare wechseln, sobald sie über 65 Jahre alt sind. Andererseits ist bei TRICARE nur ersichtlich, dass die Patienten die Medikamente verschrieben bekommen haben. Ob und wie regelmäßig sie diese eingenommen haben, lässt sich nicht nachverfolgen, da keine Blutwerte erfasst werden. Zudem ist es aus rechtlichen und Datenschutzgründen nur erlaubt, Personengruppen in eine Analyse einzubeziehen, individuelle Auswertungen sind daher nicht möglich. Es besteht mithin noch Forschungsbedarf.</p> <p><strong>Herr Dr. Hanske, vielen Dank für das Gespräch.</strong></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Korrelation von Stoffwechselmetaboliten mit bildmorphologischen, genetischen und biologischen Markern bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom
Das Prostata-spezifische Antigen (PSA), die multiparametrische Magnetresonanztomografie (mpMRT) der Prostata und seltener noch der Prostate-Cancer-Antigen-3-Test (PCA-3) haben sich als ...
Immer mehr Kinder haben Nierensteine
Die Häufigkeit von Nierensteinen bei Kindern hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig zugenommen. Zu den häufigsten Ursachen zählen Übergewicht, der vermehrte Konsum ...
Klassifikationssysteme für intraoperative Komplikationen in der Urologie
Intraoperative Komplikationen gehören zum chirurgischen Alltag, deren systematische Erfassung ist jedoch in der Urologie nach wie vor lückenhaft. Vorhandene Klassifikationssysteme werden ...