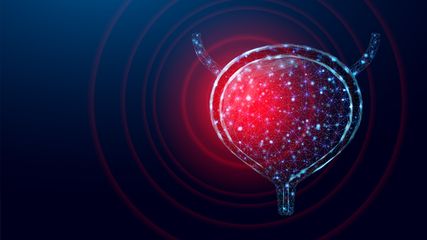<p class="article-intro">Kaum eine andere urologische Erkrankung hat in den letzten Jahren einen vergleichbaren Innovationsprozess bezüglich der operativen Therapie erlebt wie das benigne Prostatasyndrom (BPS). Auch wenn die monopolare transurethrale Prostataresektion (TURP) immer noch als Standardverfahren mit geringer Komplikationsrate angesehen wird,1 wurden inzwischen zahlreiche Verfahren entwickelt mit dem Ziel, die Morbidität des Eingriffs weiter zu reduzieren (Tab. 1).</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1902_Weblinks_s24_tab1.jpg" alt="" width="703" height="890" /></p> <p>Zu diesen Verfahren zählen zunächst die bipolare TURP<sup>2–4</sup>, aber auch die Laserablation mit dem KTP-Laser<sup>5</sup> und die Laserenukleation mit dem Holmiumlaser<sup>6– 9</sup> und dem Thuliumlaser<sup>10</sup>. Manche Verfahren konnten sich nicht durchsetzen, wie die interstitielle Laserkoagulation oder die Radiofrequenzablation.<sup>11, 12</sup> Inzwischen sind aber weitere Verfahren hinzugekommen, wie die Urolift-Technik<sup>13</sup>, das interstitielle REZUM-Verfahren mit Wasserdampf<sup>14</sup> oder der temporäre iTINDStent<sup>15</sup>. Auch von radiologischer Seite ist die Prostataembolisation als minimal invasive Alternative hinzugekommen.<sup>16</sup> Für sehr große Prostataadenome stehen auch laparoskopische oder roboterassistierte Enukleationstechniken zur Verfügung.<sup>17</sup> <br />Insofern wird es für den behandelnden Urologen immer schwerer, das richtige Verfahren für seinen Patienten auszuwählen. Diese Arbeit möchte – basierend auf mehr als 4000 prospektiv dokumentierten Patienten in den letzten 15 Jahren – ein wenig Übersicht in die aktuellen therapeutischen Strategien des BPS bringen.</p> <h2>Technische Ausrüstung zur transurethralen Prostataresektion (TURP)</h2> <p>Gerade aufgrund der zahlreichen Neuentwicklungen zur Behandlung des BPS hat sich auch die TURP methodisch und technologisch signifikant weiterentwickelt. Im Vordergrund steht zum einen die Videotechnik mit Einführung der HD-Technologie.<sup>18, 19</sup> Dies ermöglicht eine bessere Auflösung und Vergrößerung des Operationsfelds bis hin zu einem Quasi-3D-Effekt (Abb. 1). Der Operateur arbeitet vor einem 26-Zoll-HD-Flachbildschirm mit Wide View (16:9) im Vergleich zu den früher üblichen 13-Zoll-Röhrenmonitoren (4:3), was bei besserer Bildschärfe einer Vergrößerung um den Faktor 4 entspricht. Diese Systeme sollten Standard in jedem endourologischen Operationssaal sein.<br />Parallel hierzu wurde die bipolare HF-Technik entwickelt und inzwischen perfektioniert. Die monopolare Elektroresektion erfolgt klassisch mit hochfrequentem Schneidestrom bei einer Leistung von maximal 200 Watt. Dies wird durch einen Mikroprozessor während der Aktivierung der Schlinge im Gewebe gesteuert. Hierfür wird eine nicht leitende hochohmige Spülflüssigkeit (z. B. Glycin-Mannit-Gemisch; Purisole, Kabi-Fresenius) benötigt.<sup>20, 21</sup> Dadurch kommt es zu einem direkten Eintritt der Stromenergie in das Gewebe mit Ableitung über die Elektrode. Bei der bipolaren Technik ist initial eine höhere Leistung erforderlich (bis zu 400 W), da hier bei der Passage durch die leitende Spüllösung (0,9 % NaCl) ein Lichtbogen mit entsprechender Vaporisation (Plasma) entstehen muss. Erst damit kann die Schlinge in das Gewebe eindringen. Sobald die Schlinge schneidet, wird die HF-Leistung auf Werte zwischen 90 und 120 W heruntergeregelt.<sup>2</sup> Neueste HF-Generatoren erreichen dies auf eine Weise, dass der Urologe dies nicht mehr als Verzögerung wahrnimmt. Entscheidender Vorteil der bipolaren Technik ist das Vermeiden des klassischen TUR-Syndroms mit hypertoner Hyperhydratation. Außerdem kann durch Steuerung (= Verlangsamung) der Duchzugsgeschwindigkeit der Schlinge ein Koagulationseffekt erzielt werden (Abb. 2a).<br />All dies hat dazu geführt, dass sich die bipolare Technik zunehmend für die transurethrale Resektion durchgesetzt hat. Da keine spezielle Spüllösung erforderlich ist, kann die bipolare TURP auch mit Lasertechniken (Enukleation) kombiniert werden.<sup>9, 22</sup> Inzwischen ist das Instrumentarium weiterentwickelt worden, was die bipolare Enukleationstechnik mittels einer keilförmigen Elektrode / Schlinge ermöglicht (Abb. 2c).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1902_Weblinks_s24_abb1.jpg" alt="" width="538" height="867" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1902_Weblinks_s24_abb2.jpg" alt="" width="807" height="791" /></p> <p> </p> <h2>Technische Ausrüstung zur Laserenuklation</h2> <p>Primär profitieren alle Laserverfahren auch von der neuen HD-Videotechnologie (Abb. 1). Ursprünglich wurde die Laserenukleation Energien (2,2 W, 18 Hz = 42 J; 2 W, 25 Hz = 50 J; 1,8 W, 40 Hz = 72 J) und einer 2-Lappen- oder 1-Lappen-Technik mit kompletter Enukleation des Adenoms.<sup>9, 22, 23</sup> Andererseits wird auch der Einsatz höherer Energien (4 J, 30 Hz = 120 J) propagiert (S. Piesche, persönliche Mitteilung). Der Vorteil geringerer Energien liegt vor allem in den Kosten, da solche Lasergeräte deutlich billiger sind.<br />Das Prinzip der Holmium-YAG-Laserenuklation basiert auf einer durch den gepulsten Laserstrahl induzierten Präparation des Adenoms von der Kapsel.<sup>23</sup> Hier sind aufgrund eigener klinischer Erfahrungen höhere Energien nicht relevant (Abb. 2d). Der Vorteil höherer Energien liegt bei der Durchtrennung von Gewebe, was bei der 3-Lappen-Technik bedeutsam ist. Die Koagulation von Blutungen kann am besten durch Defokussierung des Laserstrahls erreicht werden. In der Zwischenzeit sind auch mit dem Thulium-YAG-Laser gute Ergebnisse publiziert worden.<sup>10, 22, 23</sup> Als kontinuierlicher Laser führt er bei der Enukleation vermehrt zur Gewebskoagulation. Dies hat allerdings deutliche Vorteile bei der Gewebedurchtrennung und Blutstillung. Daher dominiert beim Einsatz des Thuliumlasers die 3-Lappen-Technik. Obwohl der KTP-Laser eigentlich zur Gewebeablation konstruiert wurde, wird dieser Laser aufgrund der hohen Absorption der Laserenergie im Hämoglobinbereich (Abb. 2b) mit seiner Side-Fire-Sonde auch zur Prostataenukleation eingesetzt.<sup>22, 24</sup> Allerdings erfolgt hier die Enukleation vor allem mechanisch und der Laser dient in erster Linie zur Blutstillung. <br />Wichtig für alle transurethralen Enukleationstechniken ist ein gut und sicher funktionierender Morcellator. Hierfür stehen drei Typen zur Verfügung, mittels Guillotine- artigen Messers (Lumenis), alternierend rotierenden Messers eines umgebauten Arthroskopie-Shavers (Pyrania, Richard Wolf) oder einfach rotierenden Messers (Karl Storz). Entscheidend für schnelle Morcellationsleistungen (bis zu 10 g/min) sind hierbei gute Sichtverhältnisse und eine ausreichender Sog, um einer Verstopfung des Morcellators vorzubeugen (Abb. 3).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1902_Weblinks_s24_abb3.jpg" alt="" width="801" height="786" /></p> <h2>Laparoskopische und roboterassistierte Enukleation des Prostataadenoms</h2> <p>Auch wenn mittels transurethraler Enukelationstechniken Adenome bis zu 240 g entfernt werden konnten, ist es evident, dass hier diese Technologie an ihre Grenzen stößt.<sup>25, 26</sup> Daher sehen wir bei sehr großen Adenomen (> 150 ccm) die Indikation für eine laparoskopische oder roboterassistierte Enukleation.<sup>17</sup> Diese erfolgt mit extraperitonealem Zugang über eine Inzision des Blasenhalses und der Prostatakapsel in einer modifizierten Millin-Technik (Abb. 4). Das Präparat kann dann in einem Bergebeutel über den subumbilikalen Zugang meist in zwei Teilen geborgen werden. Vorteile der laparoskopischen Technik gegenüber der klassisch offenen Adenomektomie liegen in der besseren Blutstillung und der Möglichkeit einer exakten Blasenhalsrekonstruktion mittels endoskopischer Nahttechnik.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1902_Weblinks_s24_abb4.jpg" alt="" width="1063" height="803" /></p> <h2>Aktueller Stand neuer Therapiealternativen</h2> <p>In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Therapieverfahren als Alternative zur TURP vorgestellt worden, die sich wegen Ineffektvität, hoher Nebenwirkungen und fehlender Reproduzierbarkeit nicht im klinischen Alltag bewährt haben. Hierzu gehören interstitelle Ablationstechniken unabhängig von der Wahl des Lasers (Neodym- YAG, Diodenlaser, Holmium-YAG) bzw. der übrigen Energieformen (Mikrowelle, Radiofrequenzablation, HF-Koagulation) und toxischen Verfahren (Alkoholinjektion). Problematisch war bei allen Verfahren die Vorhersehbarkeit der induzierten Nekrose, was einerseits zu transurethralem Abgang von Gewebsnekrosen (Sludge) und andererseits zu hohen Reoperationsraten führte.<sup>11, 12</sup></p> <p>Unter diesen Erfahrungen müssen auch einige der jüngsten Verfahren betrachtet werden (Abb. 5):</p> <p><strong>Urolift</strong> <br />Hierbei werden je zwei komprimierende Nähte transurethral gesetzt, um die Prostataseitenlappen zu verdrängen. Kurz- und Langzeitstudien über 2 Jahre haben die Effektivität des Konzepts bestätigt. Allerdings müssen hier wirklich die echten Langzeitdaten abgewartet werden.<sup>13</sup></p> <p><strong>iTIND</strong> <br />In diesem Fall wird ein Nitinolexpander für 2–3 Tage in die prostatische Harnröhre eingesetzt, was zu einer symmetrischen Inzision im Bereich der Seitenlappen führt. Auch hier sehen die Frühergebnisse gut aus.<sup>15</sup> REZUM Hier wird ähnlich wie bei den interstitiellen Ablationstechniken Wasserdampf in die Seitenlappen injiziert, was zu einer raschen Gewebsnekrose führt. Hier scheint die Vorhersehbarkeit der Nekrose besser zu sein als bei den früheren Techniken.<sup>14 </sup></p> <p><strong>Prostatembolisation</strong> <br />Inzwischen befassen sich auch die interventionellen Radiologen mit dem BPS. Es erfolgt mittels modernster Angiografietechnik (Dyna-CT) eine Sondierung der Prostataarterien mit anschließender Partikelembolisation. Dies ist ein technisch sehr anspruchsvoller Eingriff und besitzt wohl für den Patienten den Charme, dass man nicht transurethral vorgehen muss. Dennoch sind auch hier die Langzeitergebnisse, insbesondere die Reoperationsraten, nicht bekannt.<sup>16 </sup></p> <p>Alle diese Techniken haben den Vorteil für den Patienten, dass sie die prograde Ejakulation erhalten. Sie werden daher auch vor allem für jüngere Männer propagiert.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1902_Weblinks_s24_abb5.jpg" alt="" width="804" height="860" /></p> <h2>Indikationsstellung bei BPS</h2> <p>Steht die Indikation zur chirurgischen Therapie, hängt die Wahl der Therapie von zahlreichen Faktoren ab, wie Alter, sexueller Aktivität, Begleiterkrankungen (Antikoagulation), Größe der Prostata, Struktur der Prostata (prominenter Mittellappen) und Stadium des BPS.<sup>1</sup></p> <p><strong>Prostatagröße</strong> <br />Während früher eine Prostatagröße von 60 ccm als Grenzgröße für die TURP galt, kann ein erfahrener Operateur (mit einer Resektionsgeschwindigkeit von max. 1 g/min) sicher bis zu 90 ccm problemlos resezieren. Hier kommen die Vorteile der bipolaren TURP ins Spiel, da längere Operationszeiten nicht mit einem höheren Risiko eines TUR-Syndroms verbunden sind. <br />Andererseits liegen die Vorteile der Enukleationstechniken gerade in einer schnelleren Abtragungsrate (2–3 g/min inklusive der Morcellation). Darüber hinaus lassen sich die größeren Adenome meist besser enukleieren. Insofern liegt der Indikationsbereich abhängig von den Erfahrungen des Operateurs zwischen 60 und 150 ccm. Danach bevorzugen wir zumindest die laparoskopische Enukleation.<br /><br /> <strong>Erhalt der Ejakulation</strong> <br />Vor allem bei jüngeren Patienten (55– 65 Jahre) spielt der Erhalt der prograden Ejakulation noch eine Rolle. Basierend auf den Studien von Alloussi et al. kann hier eine spezielle Resektionstechnik mit alleiniger Resektion der kranialen Abschnitte der Seitenlappen erfolgen. Bei Patienten mit kleinem Adenom bietet sich hier die Blasenhalsinzision an. Bei Patienten mit großem endovesikalem Mittellappen kann auch nur eine Mittellappenresektion erfolgen. Die Patienten müssen allerdings über die entsprechend höheren Rezidivraten (30–40 %) informiert werden.</p> <p><strong>Patienten unter Antikoagulation</strong> <br />Mit zuehmender Aktivität der Kardiologen bezüglich der Implantation von Koronarstents stellt sich für viele Patienten mit BPS das Problem der Verzögerung der notwendigen Operation aufgrund der kardiologisch notwendigen Triple-Antikoagulation. Eine präventive Einnahme von Acetylsalicylsäure (z. B. ASS 100) stellt keine Kontraindikation für eine TURP oder Enukleation dar. Demgegenüber stellt die intensive (Triple-)Antikoagulation eine Herausforderung dar, da sie mit einer 20 % igen Rate an postoperativen Blutungskomplikationen vergesellschaftet ist.<sup>27</sup> Hier bietet sich die Gewebsablation mit dem KTP-Laser als sicheres Verfahren an. Alternativ kann auch eine bipolare Vaporisation mit speziellen Elektroden erfolgen.<sup>5, 28 </sup></p> <h2>Perspektiven für die Zukunft</h2> <p><strong>Robotische TURP</strong> <br />Schon 1989 hatte die Gruppe um John Wickham einen Roboter zur Durchführung einer transurethralen Prostataresektion (Probot) vorgestellt. Hierbei erfolgte die Morcellation der Prostata von innen mittels eines Gewebeverflüssigers (ähnlich einem Rührmix) basierend auf den Daten des transrektalen Ultraschalls (TRUS). Eine direkte endoskopische Kontrolle war aufgrund der ausgeprägten Gewebeblutung nicht möglich, was zu entsprechenden Komplikationen (i. e. Kapselperforation, Gefäßverletzung) führte, sodass das Projekt wieder eingestellt wurde.<sup>29 </sup></p> <p><strong>Aquaablation (Procept)</strong> <br />2015 stellte Gilling das Konzept der transurethralen Aquaablation der Prostata vor. Inzwischen besitzt das Gerät eine CE-Zulassung. Die Gewebeverflüssigung erfolgt durch Hydrodissektion mit einem adaptierbaren Wasserstrahl (Kärcher- Prinzip). Auch hier wird TRUS zur individuellen Berechnung der Ablation allerdings in Kombination mit der Video-Endoskopie eingesetzt. Das Gerät wird bei 12 Uhr am Blasenhals platziert und kann von dort Prostatagewebe in einem Winkel von maximal 210° abladieren. Die Ablationstiefe reicht bis maximal 3 cm und wird in der Nähe des Kollikels deutlich reduziert. Hiermit sind Ablationsgeschwindigkeiten von bis zu 5 g Prostatagewebe pro Minute möglich. Es liegen inzwischen auch sehr positive Erfahrungen aus Deutschland vor.<sup>30</sup></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Die verbesserte Videotechnik und HF-Technologie haben zu einer weiteren Verbesserung der TURP geführt. Die Enukleationstechnik setzt sich vermehrt bei größeren Adenomen durch, wobei der Holmium-YAG-Laser die Vorreiterrolle spielt. Bei sehr großen Adenomen tritt die offene Enukleation gegenüber der laparoskopischen und roboterassistierten Technik weiter in den Hintergrund. Als Basis für zukünftige Entwicklungen auf dem Gebiet der operativen Therapie des BPS sollten folgende Erfolgskriterien gelten: vernünftige Operationszeiten, geringe Komplikationsraten, kurze Katheterzeit, frühe Kontinenz und gute Langzeitergebnisse.<br /> Sicherlich können manche Verfahren auch als „Zwischenlösung“ dienen, beispielsweise mit Erhalt der prograden Ejakulation. Hier sollten aber auch die Therapiekosten im vernünftigen Rahmen bleiben und die Patienten sollten adäquat aufgeklärt sein. Im eigenen Krankenkollektiv stellt die Harnsperre die Hauptindikation zum operativen Vorgehen dar und ejakulationsprotektive Verfahren spielen eine untergeordnete Rolle.</p> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Rassweiler J et al.: Complications of transurethral resection of the prostate (TURP) – incidence, management, and prevention. Eur Urol 2006; 50: 969-80 <strong>2</strong> Rassweiler J et al.: Bipolar transurethral resection of the prostate – technical modification and early clinical experience. Min Inv Therap 2007; 16: 11-21 <strong>3</strong> Mamoulakis C et al.: Results from an international multicentre double-blind randomization controlled trial on the perioperative efficacy and safety of bipolar vs monopolar transurethral resection of the prostate. BJU Int 2012; 109: 240-8 <strong>4</strong> Skolarikos A et al.: Safety and efficacy of bipolar versus monopolar transurethral resection of the prostate in patients with large prostated or severe lower urinary tract symptoms: post hoc analysis of a European multicenter randomized controlled trial. J Urol 2016; 195: 677-84 <strong>5</strong> Bachman A et al.: Photoselective vaporization (PVP) versus transurethral resection of the prostate (TURP): a prospective bi-centre study of perioperative morbidity and early functional outcome. Eur Urol 2005; 48: 965-72 <strong>6</strong> Gilling P: Holmium laser enucleation of the prostate. BJU Int 2008; 101: 131-42 <strong>7</strong> Kuntz RM et al.: Holmium laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy for prostate greater than 100 grams: 5-year follow-up results of a randomized clinical trial. Eur Urol 2008; 53: 160-8 <strong>8</strong> Montorsi F et al.: Holmium laser enucleation versus transurethral resection of the prostate: results from a 2-center prospective, randomized trial in patients with obstructive benign prostatic hyperplasia. J Urol 2004; 172: 1926-9 <strong>9</strong> Rassweiler J et al.: Transurethrale Laserenukleation der Prostata mit dem Holmiumlaser: Wieviel Leistung ist nötig? Urologe A 2008; 47: 441-8 <strong>10</strong> Bach T et al.: Revolix vaporesection of the prostate: initial results after 54 patients with an one-year follow- up. World J Urol 2007; 25: 257-62 <strong>11</strong> Rosario DJ et al.: Durability and cost-effectiveness of transurethral needle ablation of the prostate as an alternative to transurethral resection of the prostate when alpha-adrenergic antagonist therapy fails. J Urol 2007; 177: 1047-51 <strong>12</strong> Muschter R, Reich O: Operative und instrumentelle Therapie bei BPH/BPS. Urologe A 2008; 47(2): 155-65 <strong>13</strong> Sievert KD et al.: Minimally invasive prostatic urethral lift (PUL) efficacious in TURP candidates: a multicenter German evaluation after 2 years. World J Urol 2018; doi: 10.1007/s00345-018-2494-1 [Epub ahead of print] <strong>14</strong> McVary KT et al.: Rezūm water vapor thermal therapy for lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia: 4-year results from randomized controlled study. Urology 2019; 126: 171-9 <strong>15</strong> Porpiglia F et al.: 3-year follow-up of temporary implantable nitinol device implantation for the treatment of benign prostatic obstruction. BJU Int 2018; 122(1): 106-12 <strong>16</strong> Zumstein V et al.: Prostatic artery embolization versus standard surgical treatment for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. Eur Urol Focus 2018; pii: S2405- 4569(18)30277-3, doi: 10.1016/j.euf.2018.09.005 [Epub ahead of print] <strong>17</strong> Pavan N et al.: Robot-assisted versus standard laparoscopy for simple prostatectomy: multicenter comparative outcomes. Urology 2016; 91: 104-10 <strong>18</strong> Faul P: Video-TUR: raising the gold standard. Eur Urol 1993; 24: 256-61 <strong>19</strong> Rassweiler J et al.: Zukunft der Laparoskopie und Robotik in der Urologie. Akt Urol 2018; 49: 488-99 <strong>20</strong> Barba M, Fastenmeier K, Hartung R: Electrocautery: principles and practice. J Endourol 2003; 17: 541-555 <strong>21</strong> Hahn RG, Ekengren JC: Patterns of irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate as indicated by ethanol. J Urol 1993; 149: 502-6 <strong>22</strong> Miernik A et al.: Endoskopische Enucleation der Prostata. Urologe A 2019 [Epub ahead of print] <strong>23</strong> Bach T, Muschter R, Sroka R, Gravas S, Skolarikos A, Herrmann TRW, Bayer T, Knoll T, Abbou CC, Janetschek G, Bachmann A, Rassweiler JJ (2011): Laser treatment of benign prostatic obstruction: basics and physical differences. Eur Urol 2012; 61: 317-25 <strong>24</strong> Rassweiler J et al.: Editorial comment on „What is relevant for Lasers in Urology?“ World J Urol 2015; 33(4): 461-2 <strong>25</strong> Naspro R et al.: Holmium laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy > 70 g: 24-month follow-up. Eur Urol 2006; 50: 563-8 <strong>26</strong> Wilson LC et al.: A randomised trial comparing holmium laser enucleation versus transurethral resection in the treatment of prostates larger than 40 grams: results at 2 years. Eur Urol 2006; 50: 569-73 <strong>27</strong> Madersbacher S et al.: Reoperation, myocardial infarction and mortality after transurethral and open prostatectomy: a nation-wide, long-term analysis of 23,123 cases. Eur Urol 2005; 47: 499-504 <strong>28</strong> Geavlete B et al.: Continuous vs conventional bipolar plasma vaporisation of the prostate and standard monopolar resection: a prospective, randomised comparison of a new technological advance. BJU Int 2014; 113: 288-95 <strong>29</strong> Harris SJ et al.: The Probot – an active robot for prostate resection. Proc Inst Mech Eng H 1997; 211(4): 317-25 <strong>30</strong> Bach T et al.: Aquablation of the prostate: single-center results of a nonselected, consecutive patient cohort. World J Urol 2018; doi: 10.1007/s00345-018-2509-y [Epub ahead of print]</p>
</div>
</p>