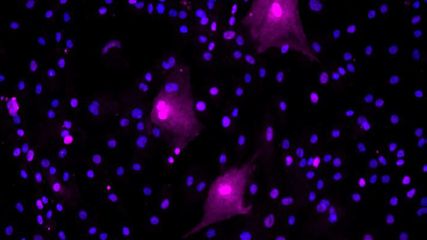©
Getty Images/iStockphoto
Unter der Bettdecke und auf der Couch
Jatros
30
Min. Lesezeit
14.02.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Sexualität und Depression – zwei Themen, die von Rheumatologen im Patientengespräch oft vermieden werden. Bei der Jahrestagung der ÖGR 2018 wurde in einer Session angesprochen, was in der Praxis oft unausgesprochen bleibt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Obwohl allgemein bekannt sein dürfte, dass Sexualität untrennbar mit Lebensqualität, Wohlbefinden und Gesundheit verbunden ist, lässt der professionelle Umgang mit diesem Thema im Arzt-Patienten- Gespräch noch viel zu wünschen übrig, wie Dr. Judith Sautner, LK Stockerau, ausführte. Rheumatologen sind dabei keine Ausnahme: Eine Umfrage unter Health Professionals aus Oslo zeigte zum Beispiel, dass zwar fast alle Befragten zustimmten, dass Sexualität ein wichtiges Thema in der Betreuung von Rheumapatienten sei; dennoch gaben 71 % zu, das Thema nie oder nur ganz selten anzusprechen.<sup>1</sup> Unter den genannten Gründen waren Zeitmangel, Peinlichkeit der Situation und gegensätzliches Geschlecht zwischen Arzt und Patient. Health Professionals mit einer einschlägigen Ausbildung fühlen sich entsprechend sicherer beim Ansprechen dieses Themas.<br /> Ein Bedarf an Beratung besteht durchaus, wie eine neue österreichische Studie zeigt: Eine groß angelegte Patientinnenbefragung an mehreren österreichischen Zentren ergab, dass RA-Patientinnen gegenüber gesunden Kontrollpersonen signifikant schlechtere Scores im CSFQ („Changes in Sexual Functioning Questionnaire“) und auch signifikant häufiger pathologische CSFQ-Scores aufweisen.<sup>2</sup> „Die Ergebnisse waren für alle abgefragten Komponenten hoch signifikant“, so Sautner. Ein besonders häufiges Problem war Scheidentrockenheit.<br /> Von allen erhobenen Risikofaktoren war die RA am stärksten mit einer sexuellen Dysfunktion assoziiert. Weitere Risikofaktoren waren höheres Alter und geringer Ausbildungsstatus. Der Unterschied zwischen RA-Patientinnen und gesunden Kontrollpersonen war in jeder Altersgruppe signifikant. Die Auswertung zeigte weiters einen Zusammenhang zwischen sexueller Dysfunktion und erhöhten Depressions-Scores. Der Grad der Behinderung, die Krankheitsaktivität und die Medikation hatten in dieser Studie keine signifikante Auswirkung auf die sexuelle Funktion.</p> <h2>Was kann der Rheumatologe zur sexuellen Gesundheit beitragen?</h2> <p>„Wir sind zwar keine Sexualtherapeuten, aber wir sind mögliche wichtige Ansprechpartner“, sagt Sautner. „Wir können Hilfestellung geben und Kontakte zu Sexual- und Psychotherapeuten herstellen.“ Wichtig sei jedenfalls eine vermehrte Kommunikation in patientenadäquater Sprache. Ein diesbezügliches Kommunikationstraining für medizinisches Personal wäre wünschenswert.<br /> Generell kann Bewegung empfohlen werden: Über Schmerzreduktion und verbesserte Beweglichkeit hat etwa Physiotherapie einen positiven Effekt auf die Sexualität von RA-Patientinnen gezeigt. Regelmäßige körperliche Aktivität reduziert Fatigue und fördert die Erregbarkeit. Ein Beckenbodentraining, z.B. nach Kegel, bringt zusätzlich eine Orgasmusverbesserung. Auch bei Männern verbessert regelmäßiges Training die sexuelle Performance und reduziert die Rate an erektiler Dysfunktion.<br /> „Einige konkrete Tipps können wir auch ohne spezielle Ausbildung geben“, meint Sautner. So ist etwa eine warme Dusche vor dem Geschlechtsverkehr günstig, um die Muskeln zu lockern. Im Bedarfsfall können Analgetika eingesetzt werden. Für schmerzende Gelenke könne man Coolpacks empfehlen, bei Sicca-Problemen lokale Gels. Beim Geschlechtsakt selbst kann die Wahl der richtigen Position, abgestimmt auf die Grundkrankheit und die betroffenen Gelenke, entscheidend sein. Patienten mit akuten Entzündungen sollten eine passive Position einnehmen.</p> <h2>Stressoren für RA</h2> <p>In den 1980er-Jahren belegten mehrere Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen belastenden Lebensereignissen oder Stressoren und dem Ausbruch von Krankheiten. Die „Stresshypothese“ wurde 1992 von Köhler auf die rheumatoide Arthritis angewandt: Stress könne demnach die Ausbildung oder den Verlauf einer RA beeinflussen. Dr. Rudolf Puchner, Wels, präsentierte dazu Studien, welche diesen Zusammenhang untersucht haben. Zusammengefasst sprechen die Ergebnisse dafür, dass leichter bis moderater chronischer Stress die Entzündung und damit die RA-Krankheitsaktivität steigern kann. Cutolo et al. berichten, dass zu Beginn der Erkrankung Stress auch mit einer rascheren radiologischen Progression korrelieren kann.<sup>3</sup> Major Stress scheint dagegen keine Auswirkungen auf den Verlauf der RA zu haben.<sup>4</sup> Davids et al. wiesen dann 2008 nach, dass chronischer interpersoneller Stress mit einer vermehrten Produktion von IL-6 und einer verminderten Inhibition der IL-6-Produktion durch Glukokortikoide einhergeht, womit sich die erhöhte Entzündungsaktivität erklären lässt.<sup>5</sup></p> <h2>Zytokine singen den Blues</h2> <p>Depressionen treten bei Rheumapatienten etwa doppelt so häufig auf wie in der Allgemeinpopulation. Als mögliche Ursachen stehen u.a. die Konfrontation mit einer chronischen Erkrankung, mangelnder Behandlungserfolg, das Gefühl der Hilflosigkeit, Schmerzen, Funktionseinschränkungen bzw. ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren in Diskussion. Forschungsergebnisse sprechen jedoch auch für einen direkten Zusammenhang zwischen Depression und Entzündungsaktivität.<sup>6–8</sup> „Man nimmt an, dass proinflammatorische Zytokine den Neurotransmitter- Metabolismus negativ beeinflussen“, erklärt Puchner. Umgekehrt kann eine Depression die Entzündung fördern, etwa durch verminderte Therapieadhärenz.<br /> Wie auch immer der Zusammenhang sein mag: Fakt ist, dass Depressionen zu einem deutlich schlechteren Krankheitsverlauf bei RA führen und deshalb rasch diagnostiziert und behandelt werden sollten. „Bei jedem RA-Patienten sollte an das mögliche Vorliegen einer Depression gedacht werden“, betont Puchner. Zum Depressions- Screening bei Rheumapatienten empfiehlt er den BDI-FS (Beck Depressions- Inventar – Fast Screen). Dieser kann in wenigen Minuten einen Hinweis auf eine Major Depression liefern und ist für Patienten mit chronischen Erkrankungen besonders geeignet, weil er keine somatischen Beschwerden zur Diagnose der Depression verwendet. „Rheumasymptome wie Müdigkeit oder Fatigue könnten sonst zu falsch positiven Ergebnissen führen“, erklärt Puchner.<br /> Eine Überweisung zum Facharzt für Psychiatrie muss nicht sofort erfolgen. Prinzipiell kann auch der Rheumatologe eine erste antidepressive Therapie einleiten (Ausnahme: Suizidrisiko!). Entspannungstechniken sind vom Patienten selbst erlernbar und geben das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Auch Achtsamkeitstraining und kognitive Verhaltenstherapie können depressive Symptome und chronischen Schmerz günstig beeinflussen. Als medikamentöse Therapie empfiehlt Puchner, mit SNRI in einer kleinen Dosis zu starten, weil Medikamente dieser Substanzgruppe auch eine schmerzstillende Wirkung haben.<br /> IL-6-Hemmer wie Tocilizumab könnten sich möglicherweise positiv auf die Stimmungslage auszuwirken. Diese Beobachtung wurde von Ärzten und Patienten gemacht und bekräftigt die Theorie, wonach Depressionen durch die Entzündungskaskade beeinflusst werden. Weitere Studien sind diesbezüglich notwendig.<br /> „Allgemeinmediziner und Internisten können mit der Frühdiagnose der Depression und einem Therapiebeginn einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität ihrer Patienten leisten“, sagte Puchner. „Spätestens bei ausbleibendem Therapieerfolg ist die Kooperation mit Fachärzten für Psychiatrie sinnvoll.“<br /> Dass eine klinisch-psychologische Intervention schon nach kurzer Zeit zu erheblichen Verbesserungen der subjektiven Lebensqualität führen und die Therapieadhärenz steigern kann, zeigte schließlich Mag. Doris Wolf, Graz. Sie berichtete über eine laufende Studie des Berufsverbandes österreichischer PsychologInnen (BÖP). Für die Studie wurden Gutscheine für je vier kostenlose Einheiten psychologischer Behandlung an Rheumapatienten verteilt. Von denjenigen, die das Angebot in Anspruch nahmen, suchte die Mehrheit (84 % ) Hilfe bei der Schmerzbewältigung. „Obwohl vier Sitzungen nach allgemeinen Maßstäben eigentlich sehr wenig sind, konnte das psychische Wohlbefinden der Patienten damit deutlich gesteigert und die Krankheitsbewältigung signifikant verbessert werden“, berichtete Wolf.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie
& Rehabilitation (ÖGR), 29. November bis
1. Dezember 2018, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Helland Y et al.: Current practice and barriers to the management of sexual issues in rheumatology: results of a survey of health professionals. Scand J Rheumatol 2013; 42(1): 20-6 <strong>2</strong> Puchner R et al.: High burden of sexual dysfunction in female patients with rheumatoid arthritis: results of a cross-sectional study. J Rheumatol 2018; Sep 1. pii: jrheum.171287. doi: 10.3899/jrheum.171287 [Epub ahead of print] <strong>3</strong> Cutolo M et al.: Stress as a risk factor in the pathogenesis of RA. Neuromodulation 2006; 13(5-6): 277-82 <strong>4</strong> Hermann M et al.: Stress and rheumatic diseases. Rheum Dis Clin North Am 2000; 26(4): 737-63 <strong>5</strong> Davis MC et al.: Chronic stress and regulation of cellular markers of inflammation in rheumatoid arthritis: implications for fatigue. Brain Behav Immun 2008; 22(1): 24-32 <strong>6</strong> Kojima M et al.: Depression, inflammation, and pain in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2009; 61(8): 1018-24 <strong>7</strong> Raison CL, Miller AH: Do cytokines really sing the blues? Cerebrum 2013; 2013: 10 <strong>8</strong> Nerukar L et al.: Rheumatoid arthritis and depression: an inflammatory perspective. Lancet Psychiatry 2018. pii: S2215- 0366(18)30255-4 [Epub ahead of print]</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...