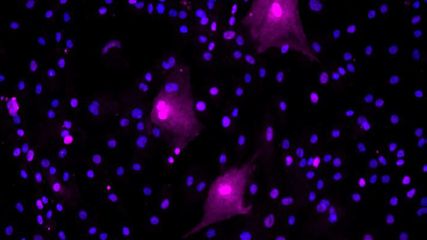©
Getty Images/iStockphoto
Progressionshemmung bei Arthrose – sichere Biologika – Vitamin D bei SLE
Jatros
Autor:
Dr. Susanne Kammerer
30
Min. Lesezeit
15.02.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Trotz frühlingshafter Temperaturen sorgten die zahlreichen interessanten Vorträge für bis zum Bersten gefüllte Vortragssäle beim Jahrestreffen von ACR/ARHP in San Diego, Kalifornien. Im Folgenden eine kleine Auswahl der präsentierten Daten.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Arthrose: Fibroblasten­-wachstums­faktor bewirkt Knorpelzuwachs</h2> <p>Nach Ausführung von Dr. Marc Hochberg, Medizinisches Zentrum der Universität Maryland in Baltimore (USA), scheint der rekombinante humane Fibroblastenwachstumsfaktor 18 Sprifermin das erste Medizinprodukt in klinischer Entwicklung zu sein, das dosisabhängig den Knorpelverlust bei Kniegelenksarthrose verhindern und sogar zu einem Anstieg der Knorpeldicke führen kann (Hochberg M, Abstract-Nr. 1L). Darauf weisen die Zweijahresdaten einer Phase-II-Studie hin, die insgesamt auf fünf Jahre angelegt ist. In der Studie FORWARD erhielten 549 Patienten mit symptomatischer radiologisch abgesicherter Kniegelenksarthrose 6 bis 12 Monate lang dreimal pro Woche entweder Injektionen mit Placebo oder mit Sprifermin. Primärer Studienendpunkt war die Veränderung der gesamten tibiofemoralen Gelenkdicke im Verlauf von zwei Jahren. Die Injektionen mit dem Fibroblastenwachstumsfaktor führten zu einem dosisabhängigen Anstieg der Knorpeldicke. Dabei nahm sowohl die Knorpeldicke im medialen als auch im lateralen Femorotibialgelenk zu. Die Injektionen hatten aber keine Auswirkung auf die Symptome: Sowohl die Placebo- als auch die Sprifermin-Injektionen führten zu einer Verbesserung von 50 % der Symptome, gemessen im gesamten WOMAC-Score. „Wir führen unsere Studie über einen Gesamtzeitraum von fünf Jahren durch, weil wir hoffen, dass wir nach drei bis fünf Jahren auch einen Einfluss auf Symptome wie Schmerz nachweisen können. Es wird aber auch schwierig sein, hier Unterschiede aufzuzeigen, weil alle Patienten Schmerzmittel einnehmen durften“, erklärte Dr. Hochberg.<br />Die häufigsten Nebenwirkungen bestanden in Arthralgien und Rückenschmerzen. Es gab jedoch keinen Unterschied bei den Studienabbrüchen aufgrund von Nebenwirkungen in der Placebo- und der Sprifermin-Gruppe. Zudem waren die Nebenwirkungen bei Sprifermin-Therapie nur im ersten Injektionszyklus signifikant häufiger als bei Placebo. <br />Nach Ausführung von Dr. Hochberg könnte Sprifermin das erste in der Entwicklung befindliche Medizinprodukt sein, das in der Lage ist, den Knorpelverlust bei Arthrose zu bremsen und sogar zu einem Zuwachs an Knorpelmasse zu führen. Diese strukturellen Vorteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Fibroblastenwachstumsfaktor um ein echtes krankheitsveränderndes Arzneimittel bei Arthrose mit akzeptablem Nutzen-Risiko-Profil handelt.</p> <h2>Biologika in der Schwange­r­-schaft: kein erhöhtes Infektionsrisiko für Säuglinge</h2> <p>In einer Beobachtungsstudie wurden Informationen von 502 Schwangerschaften ausgewertet, in der Mütter mit rheumatoider Arthritis (RA) mit einem Biologikum behandelt werden mussten (Chambers CD, Abstract-Nr. 1785). Diese Schwangerschaften verglich man mit 231 Schwangerschaften von RA-Patientinnen, die kein Biologikum einnahmen, und 423 Schwangerschaften von gesunden Frauen. Hier zeigte sich: Die Kinder der Mütter mit Biologika-Exposition hatten im ersten Lebensjahr kein erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen. <br />Alle Infektionen der Kinder wurden von Pädiatern von der Geburt bis zum Erreichen des ersten Lebensjahrs dokumentiert. Ernste oder opportunistische Infektionen kamen bei 4,0 % der Kinder von den RA-Müttern mit Biologika-Exposition vor im Vergleich zu 2,6 % der RA-Mütter, die keine Biologika einnahmen. 2,1 % der Babys gesunder Mütter erlebten solche Infektionen im ersten Lebensjahr. Selbst Kinder von Frauen mit RA, bei denen die letzte Dosis eines Biologikums nach der 32. Schwangerschaftswoche verabreicht wurde, wiesen kein höheres Risiko auf im Vergleich zum Nachwuchs von RA-Patientinnen, die kein Biologikum einnahmen. Dies wurde befürchtet, da es gerade in der späten Schwangerschaft zu einem Plazentatransfer der Wirkstoffe kommt. <br />„Die Ergebnisse unserer Studie sind beruhigend für Rheumapatientinnen, bei denen auch während der Schwangerschaft nicht auf die Behandlung mit einem Biologikum verzichtet werden kann“, schloss Prof. Christina Chambers, Kodirektorin des „Center for Better Beginnings“, University of California in San Diego (USA) und Erstautorin der Untersuchung, aus diesen Ergebnissen.</p> <h2>Autoimmunität und Krebs: eine enge Beziehung</h2> <p>Die Vergesellschaftung bestimmter Autoimmunerkrankungen mit Krebs ist bereits länger bekannt. Dabei können sowohl natürlich vorkommende als auch pharmakologisch induzierte Antitumorimmunantworten zu Autoimmunerkrankungen führen (Shah A, Session 5T051). Im Bereich der rheumatologischen Erkrankungen weisen vor allem Patienten mit Myositis und Sklerodermie ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko auf. „Informationen von diesen Patienten zeigen uns, dass natürlich vorkommende Antitumorimmun­antworten zu Autoimmunstörungen führen können“, erklärte Prof. Ami Shah, Direktorin von Clinical and Translational Research am Johns Hopkins Scleroderma Center in Baltimore (USA). Sowohl bei Sklerodermie als auch bei Myositis kommt es zu einem deutlichen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Krebs und dem Beginn einer rheumatologischen Erkrankung. Aktuelle Daten weisen auf einen paraneoplastischen Mechanismus der Sklerodermiepathogenese bei Patienten mit Sklerodermie und RNA-Polymerase-III-Autoantikörpern hin. „Diese Patienten zeigen uns den Zusammenhang zwischen einer Krebserkrankung und der Autoimmunität“, erklärte Prof. Shah. Eine eigene Kohorte von Sklerodermiepatienten mit diesen Autoantikörpern wies im Verlauf von zwei Jahren nach der Diagnose der Sklerodermie ein mehr als fünffach erhöhtes Krebsrisiko auf. Dieser Zusammenhang weist darauf hin, dass die Sklerodermie bei bestimmten Patienten ein Nebenprodukt einer körpereigenen Antitumorantwort ist. Dadurch stellt sich die Frage, ob im Umkehrschluss auch einige innovative Arzneimittel, die in der Onkologie benutzt werden, um Antitumorimmunantworten zu triggern (wie die Checkpoint-Inhibitoren), durch ähnliche Mechanismen zur Entstehung von Autoimmunerkrankungen beitragen können. Ersten Erfahrungen zufolge ist dies in der Tat der Fall. Rheumatologen sollten zumindest bei einigen ihrer Patienten ein intensives Screening auf onkologische Erkrankungen durchführen – so der Rat von Prof. Shah.</p> <h2>Bei Lupuspatienten auf gute Vitamin-D-Versorgung achten</h2> <p>Bei bis zu 40 % der Patienten mit Lupus erythematodes (SLE) entsteht eine Lupusnephritis, die zur terminalen Niereninsuffizienz führen kann. Schon länger ist bekannt, dass Patienten mit dieser Autoimmunerkrankung oft zu niedrige Vitamin-D-Spiegel aufweisen. Eine aktuelle Studie von Dr. Michelle Petri, Hopkins Lupus Center an der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore (USA), zeigte jetzt, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel das Risiko für diese Patienten für eine terminale Niereninsuffizienz deutlich erhöhen (Petri M, Abstract-Nr. 665). Die Forscher analysierten 1392 SLE-Patienten und stellten fest: Patienten, deren Vitamin-D-Spiegel zu niedrig waren (unter 20ng/ml), hatten ein um 87 % erhöhtes Risiko, eine terminale Niereninsuffizienz zu erleiden. Selbst wenn andere Risikofaktoren einbezogen wurden, war das Risiko noch um 66 % erhöht. Zudem wiesen SLE-Patienten mit schlechter Vitamin-D-Versorgung auch 69 % mehr Schäden an der Haut auf. „Eine Supplementierung mit Vitamin D ist sehr sicher“, erklärte Dr. Petri. „Sie hilft uns dabei, eine der gefürchtetsten Komplikationen des SLE zu verhindern, und reduziert vermutlich auch das kardiovaskuläre Risiko.“ Ihres Erachtens sollte bei SLE-Patienten eine Vitamin-D-Ergänzung fester Bestandteil des Therapieplans sein, wodurch auch die Proteinurie günstig beeinflusst werden kann.</p> <h2>Secukinumab verlangsamt die radiologische Progression bei PsA</h2> <p>Die FUTURE-5-Studie, die beim ACR-Kongress die Aufnahme in die begehrte Late-Breaker-Session schaffte, zeigte erstmals, dass der IL-17-Blocker Secukinumab die strukturelle Krankheitsprogression bei Patienten mit Psoriasisarthritis verlangsamen kann (Mease P, Abstract-Nr. 17L). Schon in den Studien FUTURE 1 und FUTURE 2 hatte Secukinumab seine rasch eintretende und starke Wirksamkeit bei Psoriasis unter Beweis gestellt. Jetzt wurde erstmals die Auswirkung auf die radiologische Progression untersucht. Mit fast 1000 Patienten ist die FUTURE-5-Studie auch die größte randomisierte Studie, die bei Patienten mit PsA durchgeführt wurde. Hier wurde die radiologische Progression als sekundärer Studienendpunkt untersucht. Dabei beurteilten zwei verblindete Prüfärzte Röntgenaufnahmen von Händen/Handgelenken/Füßen und dokumentierten ihre Ergebnisse in einem standardisierten Bewertungssystem für radiologische Veränderungen (modifizierter Sharp-van-der-Heijde-Score, SHS). In allen Secukinumab-Studienarmen (150mg und 300mg jeweils mit oder ohne Aufsättigung) wurde die radiologische Progression im Vergleich zu Placebo zu Woche 24 signifikant gebremst. Patienten, die mit dem IL-17-Blocker behandelt wurden, zeigten auch eine dramatische Verbesserung der Enthesitis und Daktylitis. „Besonders der Einfluss auf die Enthesitis hat für unsere Patienten eine große Bedeutung, da eine Enthesitis der Achillessehne eine starke funktionelle Einschränkung nach sich zieht“, erklärte Prof. Philip J. Mease, Swedish Medical Center und University of Washington in Seattle (USA), bei der Studienvorstellung.<br />Erwartungsgemäß war die Wirksamkeit bei Patienten, die zuvor nicht mit TNF-Blockern behandelt wurden, größer. Eine signifikante Überlegenheit versus Placebo zeigte sich auch beim primären Studienendpunkt von FUTURE 5, dem Ansprechen gemäß den Kriterien des American College of Rheumatology (ACR) um 20 % . Dies erreichten zu Woche 16 bis zu 62 % der mit Secukinumab therapierten Patienten.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: ACR/ARHP Annual Meeting, 4.–8. November 2017, San Diego, Kalifornien (USA)
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...