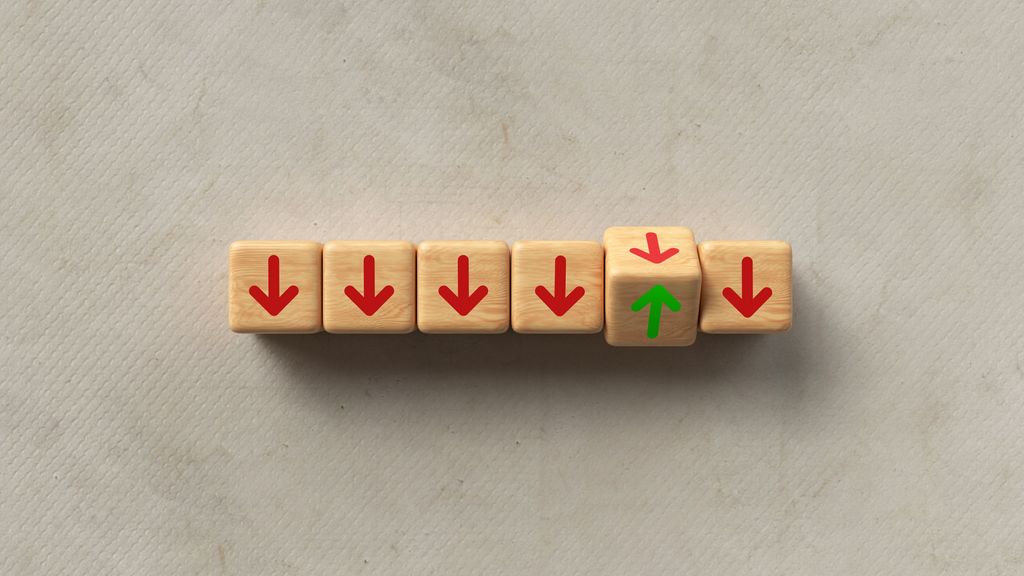
©
Getty Images/iStockphoto
Multisystemische Therapie (MST): Therapie erster Wahl bei Jugendlichen mit einer Störung des Sozialverhaltens
Leading Opinions
Autor:
Dr. med. Bruno Rhiner
Chefarzt<br> Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst<br> Thurgau, Spital Thurgau<br> E-Mail: bruno.rhiner@stgag.ch
30
Min. Lesezeit
01.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens (SSV) bringen unsere klassischen Versorgungssysteme an ihre Grenzen. Gerade diese anspruchsvollen Patienten und deren Familien können mit den üblichen Behandlungsangeboten in der ambulanten, teilstationären oder stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie nur ungenügend erreicht werden. Es braucht für diese anspruchsvollen Fälle zwingend ein hoch dosiertes und spezialisiertes Therapieangebot. Das intensive aufsuchende Therapieangebot der MST schliesst hier wirksam eine Versorgungslücke im System.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Störungen des Sozialverhaltens bei Jugendlichen sind häufig.</li> <li>Unbehandelt hat das Krankheitsbild eine schlechte Prognose.</li> <li>Mit den üblichen Behandlungsangeboten werden die Patienten nur ungenügend erreicht.</li> <li>MST integriert systemisch-familientherapeutische und kognitiv-verhaltenstherapeutische Grundprinzipien in einem stark strukturierten, aufsuchenden und zeitlich begrenzten Therapieverfahren.</li> <li>Hauptwirkfaktoren sind ein gemeinsam verantwortliches Team mit hoher Behandlungsintensität, einem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst und der aufsuchenden Arbeit in den Systemen direkt vor Ort.</li> <li>MST wird in den Leitlinien als eine der wirkungsvollsten Interventionsformen empfohlen.</li> </ul> </div> <h2>Hintergrund</h2> <p>MST wurde von Scott Henggeler vor drei Jahrzehnten mit primärem Fokus auf Störungen des Sozialverhaltens entwickelt.<sup>1, 2</sup> MST integriert systemisch-familientherapeutische und kognitiv-verhaltenstherapeutische Grundprinzipien in einem stark strukturierten, aufsuchenden und zeitlich begrenzten Therapieverfahren. Eine zentrale Grundannahme der MST ist, dass das Problemverhalten der Jugendlichen aus einer systemischen Sicht als multi-determiniert betrachtet wird. Um eine anhaltende Verhaltensänderung in diesen Familien zu erreichen, müssen demnach therapeutisch alle Faktoren aus den Systemen Familie, Schule, Peers und Umgebung miteinbezogen werden. Typische Einflussfaktoren, aufgegliedert in die verschiedenen Systeme für die Störung des Sozialverhaltens<sup>3</sup>, sind in Abbildung 1 dargestellt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Neuro_1804_Weblinks_lo_neuro_1804_s46_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="2009" /></p> <h2>Krankheitsbild</h2> <p>SSV zählen gemeinsam mit anderen externalisierenden Verhaltensstörungen zu den häufigsten Erkrankungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Prävalenzzahlen für Jungen sind 2- bis 4-mal so hoch wie für Mädchen (6–16 % für Jungen und 2–9 % für Mädchen). Jugendliche mit einer SSV leiden oft zusätzlich unter komorbiden Problemen und Risikofaktoren. Besonders häufig ist die Komorbidität mit Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Substanzabhängigkeiten, Angststörungen, Depressionen sowie Persönlichkeitsstörungen. Eine zentrale Problematik am Krankheitsbild ist, dass die vulnerablen Heranwachsenden durch ihr rücksichtsloses Interaktionsverhalten zunehmend aus allen gesellschaftlichen Bezügen fallen und die Systeme sprengen. Diese Exklusion führt nicht selten dazu, dass sich verschiedene Ausgestossene als Subgruppe neu finden und gegenseitig verstärken. Damit sind zentrale Entwicklungsaufgaben auch im Hinblick auf bessere normorientierte Verhaltensweisen in einem Teufelskreis zunehmend verunmöglicht und blockiert. In den sie umgebenden Systemen Familie, Schule und Gesellschaft provozieren die rücksichtslosen Verhaltensweisen den Ruf nach strengen Massnahmen. Eine SSV im Jugendalter ist nicht nur ein grosser Risikofaktor für eine kriminelle Entwicklung, sondern auch für andere psychische Störungen, generell haben Jugendliche mit SSV ohne Behandlung eine schlechte Prognose.</p> <h2>Grundlagen</h2> <p>Ein MST-Team besteht aus vier Therapeuten und einem Teamleiter, der selbst keine Fälle übernimmt. Jeder Therapeut behandelt 4–6 Familien parallel. Die geringe Falllast pro Therapeut ermöglicht eine hochfrequente Behandlung der einzelnen Familien, die allerdings zeitlich begrenzt ist auf 5 Monate. Die Indikation für MST sind Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren mit einer schweren Störung des Sozialverhaltens, evtl. kombiniert mit Substanzmissbrauch. Den Schweregrad ermessen wir unter anderem daran, dass der Verbleib des Jugendlichen in der Familie oder in Schule und Ausbildung stark gefährdet ist.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Zusammen mit den Eltern, dem Jugendlichen und allfälligen Zuweisern wird zu Beginn der Behandlung eine ausführliche Anamnese der Stärken und Schwächen in allen relevanten Systemen (Individuum, Familie, Schule/Arbeit, Peers, Umfeld) gemacht und gemeinsam übergeordnete Behandlungsziele definiert. Danach erstellt der Therapeut gemeinsam mit der Familie und dem Jugendlichen für alle übergeordneten Behandlungsziele sogenannte Fit- Analysen. Dabei werden für jedes Problemverhalten die Einflussfaktoren aus allen Systemen gesucht, überprüft und daraus entsprechende Interventionen abgeleitet. Auf dieser Grundlage können in der Folge die Einflussfaktoren und Interventionen priorisiert werden. Die therapeutische Herausforderung besteht darin, die kräftigsten Einflussfaktoren zu erkennen und daraus wirksame Interventionen abzuleiten. Bevorzugt werden Wirkfaktoren mit einem möglichst grossen Einfluss, wenn möglich auf mehrere Problemverhalten. Die entwickelten Interventionen sollten sich auch einfach und zeitnah realisieren lassen. Die wöchentlichen Interventionen zielen darauf ab, möglichst viele der Einflussfaktoren, die zum problematischen Verhalten führen, zu neutralisieren. Der Effekt der wöchentlich neu evaluierten Interventionen auf das Problemverhalten wird nicht nur mit der Familie, sondern regelmässig auch im Team gemeinsam reflektiert. Dieses Vorgehen, die Fit-Analysen und das Ableiten von Interventionen mit ständiger Evaluation bleibt wegweisend über den gesamten Therapieverlauf und nennt sich MST analytischer Prozess (Abb. 2). Fälle können dann abgeschlossen werden, wenn die vereinbarten Behandlungsziele über vier Wochen hinweg stabil erreicht wurden. In der Abschlussphase der Therapie werden mit allen Familien sogenannte positive Fits erstellt, die aufzeigen, welche Faktoren hauptsächlich zur Entwicklung beigetragen haben, und diese werden dann in einer Art Rezept für den nachhaltigen Erfolg für die Familien zusammengefasst.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Neuro_1804_Weblinks_lo_neuro_1804_s47_abb2.jpg" alt="" width="1417" height="1207" /></p> <h2>Forschung</h2> <p>Aktuell gibt es zur MST über 130 in Peer-Review-Verfahren begutachtete Artikel und 25 RCT-Studien zur Wirksamkeit. Die Anzahl der Publikationen steigt weiterhin stetig an. MST wurde auch in mehreren Metaanalysen<sup>4, 5</sup> und in zahlreichen Leitlinien, zum Beispiel in den S3 Leitlinien der deutschsprachigen AWMF, als eine der wirkungsvollsten Interventionsformen bei delinquenten Jugendlichen empfohlen. Wenn man die Ergebnisse aller Outcomeund Längsschnittstudien zusammenfasst, zeigen sich folgende Effekte der MST<sup>6</sup>:</p> <p><strong>Langfristige Wirkungen</strong></p> <ul> <li>75 % weniger Wiederverurteilungen aufgrund von Gewaltdelikten</li> <li>54 % weniger Fremdplatzierungen</li> <li>deutliche Kosteneinsparungen für die Allgemeinheit</li> </ul> <p><strong>Unmittelbare Wirkungen</strong></p> <ul> <li>Funktionsniveau der Familie verbesserte sich</li> <li>Substanzkonsum der Jugendlichen reduzierte sich</li> <li>Psychische Belastung der Jugendlichen verringerte sich</li> <li>hohe Zufriedenheit der Familien und der Zuweiser mit dem MST-Programm</li> <li>gesteigerte schulische und berufliche Leistungsfähigkeit/Integration</li> <li>weniger Suizidversuche</li> </ul> <p>Die Wirksamkeit von MST konnte auch in langfristigen Katamnesen nachgewiesen werden. Selbst nach 21,9 Jahren blieb die Verhaftungsrate der MST-Gruppe aufgrund von schweren Straftaten um 36 % und die Verhaftungsrate aufgrund von Gewaltdelikten sogar um 75 % tiefer als die der Kontrollgruppe.<sup>7</sup> Obwohl die Therapieabbruchraten bei Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens normalerweise hoch sind, erreicht MST, dass 98 % der Jugendlichen die Therapie regulär beenden.<sup>8</sup></p> <p>Die langjährige Forschung zur MST und die standardisierte Qualitätskontrolle garantieren, dass die erwarteten klinischen Ergebnisse und finanziellen Einsparungen sich auch tatsächlich realisieren lassen. Von MST-Services wird daher im therapeutischen Alltag in einem sehr arbeitsaufwendigen System überprüft, wie gut sich die Therapeuten und Supervisoren an das Manual halten. Je besser sich der Therapeut an das Manual hält, umso höher die erzielte Effektstärke.<sup>9, 10</sup> Alle Therapieteams weltweit stehen in einem ständigen Benchmark bezüglich der Therapiergebnisse und der Qualitätskontrollwerte.</p> <h2>Erfahrungen</h2> <p>Die klaren Behandlungskonzepte, das Arbeiten im Team, die engmaschige Supervision und die ständige Prozesskontrolle schützen die Therapeuten davor, in komplexen Fällen die Übersicht zu verlieren, und geben den Rückhalt und die Überzeugung, in hochkomplexen und belastenden Fällen die therapeutische Wirksamkeit nicht zu verlieren.<sup>3</sup> Um ein MSTBehandlungsteam zu verwirklichen, ist multisystemisches Denken und Handeln auch auf übergeordneter politischer Ebene nötig. Die Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln der Systeme Gesundheit, Sozialwesen, Erziehung und Justiz zeigt sich unter anderem in einer gemeinsamen Finanzierungsgrundlage, schafft aber im Gegenzug auch eine gemeinsame Haltung in den oberen Hierarchiestufen dieser Systeme, die erfolgreiches Arbeiten an der MST-Basis erst ermöglicht. MST als Spezialform der aufsuchenden Arbeit ist in den kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungsstrukturen in den Schweizer Kantonen Thurgau, Aargau und Basel zu einem unverzichtbaren Behandlungsangebot geworden. Die Finanzierung wird hier je zu 50 % durch die medizinischen Kostenträger (Krankenkassen) und die öffentliche Hand (Kantone) getragen. Aktuell entstehen erste MST-Teams auch in Deutschland (Mainz, Heilbronn und Hamburg). Es ist erstaunlich, dass sich dieses hochwirksame und kosteneinsparende Behandlungsmodell im deutschsprachigen Europa bis anhin nicht weiter hat durchsetzen können. Möglicherweise haben die föderalen Strukturen und die komplexen Finanzierungsmodalitäten einen bremsenden Effekt.</p> <p>Die Einbettung von MST in das medizinische System der Jugendpsychiatrie erhöht die Wirksamkeit. Speziell wegen der häufigen Komorbiditäten von SSV mit anderen Krankheitsbildern ist eine integrierte Behandlung wichtig.</p> <p>Die überzeugende Wirkung erzielt MST über ein gemeinsam verantwortliches Team mit hoher Behandlungsintensität, einem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst und der aufsuchenden Arbeit in den Systemen direkt vor Ort. MST ist damit sozusagen eine jugendpsychiatrische Intensivstation zu Hause bei den Familien und kann die Probleme dort behandeln, wo sie entstehen, in der Familie, in der Gleichaltrigen- Gruppe, in der Schule und am Arbeitsplatz.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Henggeler SW et al.: Multisystemic treatment of juvenile offenders: Effects on adolescent behavior and family interaction. Developmental Psychology 1986; 22(1): 132-41 <strong>2</strong> Henggeler SW et al.: Multisystemische Therapie bei dissozialem Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Deutsche Bearbeitung durch Bachmann, C. Springer Verlag, 2012 <strong>3</strong> Eigenheer R et al.: Störung des Sozialverhaltens bei Jugendlichen. Die Multisystemische Therapie in der Praxis. Göttingen: Hogrefe, 2016 <strong>4</strong> Fonagy P et al.: What works for whom? New York: Guilford 2002 <strong>5</strong> Bachmann CJ et al.: Evidenzbasierte psychotherapeutische Interventionen für Kinder und Jugendliche mit aggressivem Verhalten. Kindheit und Entwicklung 2010; 19(4): 245-54 <strong>6</strong> MST Services 2018; Online-Zugriff: http://mstservices.com/ <strong>7</strong> Sawyer AM, Borduin CM: Effects of multisystemic therapy through midlife: A 21.9-year follow-up to a randomized clinical trial with serious and violent juvenile offenders. J Consult Clin Psychol 2011; 79(5): 643-52 <strong>8</strong> Henggeler SW et al.: Eliminating (almost) treatment dropout of substance abusing or dependent delinquents through home-based multisystemic therapy. Am J Psychiatry 1996; 153(3): 427-8 <strong>9</strong> Schoenwald SK et al.: Client-level predictors of adherence to MST in community service settings. Family Process 2003; 42(3): 345-59 <strong>10</strong> Schoenwald SK et al.: Therapist adherence and organizational effects on change in youth behavior problems one year after multisystemic therapy. Adm Policy Ment Health 2008; 35(5): 379-94</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...
Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie
Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...
Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen
Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...


