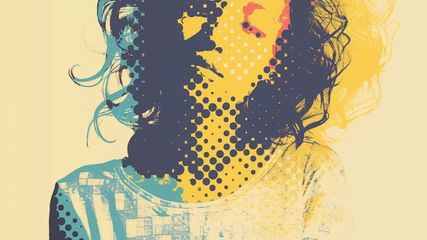Highlights vom CINP-Kongress 2025
Unsere Gesprächspartnerin:
Priv.-Doz. DDr. Lucie Bartova
Klinische Abteilung für Allgemeine Psychiatrie
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Medizinische Universität Wien
E-Mail: lucie.bartova@meduniwien.ac.at
Das Interview führte Dr. Nicole Leitner
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Vom 15. bis 18. Juni 2025 fand der diesjährige CINP-Kongress in Melbourne statt, der sich auf neue Erkenntnisse in der Psychiatrie und der Neurowissenschaft fokussiert. Wir sprachen mit Priv.-Doz. DDr. Lucie Bartova, Medizinische Universität Wien, über ihre Eindrücke vom Kongress und darüber, welche Erkenntnisse sie nach Wien mitgenommen hat.
Frau Doz. Bartova, was waren Ihre Highlights beim vergangenen CINP-Kongress?
L. Bartova: Für mich war der gesamte Kongress ein Highlight! Die CINP ist eine internationale Fachgesellschaft, die schon seit mehreren Jahrzehnten existiert. Seit meinem vierten Studienjahr habe ich versucht, jeden CINP-Kongress zu besuchen. Die Fachgesellschaft verbindet die neurobiologische Basisforschung mit der Relevanz in der klinischen Praxis. Demnach ist der Kongress sowohl für Ärzt:innen, die hauptsächlich klinisch tätig sind, als auch Neurowissenschafter:innen, die vordergründig in der Forschung arbeiten, sehr interessant und relevant, weil der Fokus auf der Translation liegt. Ich schätze diese Balance von hochkarätiger Wissenschaft und einer sehr klaren Praxisorientierung sehr. Es wurden auch Guidelines präsentiert, die besonders für junge Kolleg:innen wichtig sind.
Generell war das Programm auch dieses Jahr so gestaltet, dass die breite Palette an Gehirnerkrankungen abgehandelt wurde: von Depression über psychotische Erkrankungen, v.a. die Schizophrenie, bipolare Erkrankungen, Angsterkrankungen, Suchterkrankungen Traumafolgeerkrankungen, bis zu neurodegenerativen bzw. demenziellen Entwicklungen und den sog. „organischen“ Erkrankungen wie z.B. den Autoimmunenzephalitiden.
Der Vorstand der CINP-Fachgesellschaft ist sowohl geografisch als auch gendermäßig balanced. Es wird auch sorgfältig gewählt, wo die Kongresse stattfinden, damit Kolleg:innen aus der ganzen Welt die Möglichkeit haben, die Kongresse zu besuchen. So war zum Beispiel 2024 der Kongress in Tokio, dieses Jahr eben in Melbourne, nächstes Jahr ist der Kongress in Glasgow und 2027 wird er in Abu Dhabi stattfinden.
Die CINP fördert aktiv die Teilnahme am Kongress. Man kann sich schon im Vorfeld für Preise bewerben. Für junge Kolleg:innen gibt es z.B. den „Rafaelsen Award for Young Researchers“.
Diesen Preis haben Sie selbst 2021 erhalten ...
L. Bartova: Ja, genau ... und nicht nur ich, sondern einige Kolleg:innen von unserer Klinik haben diesen Preis schon entgegennehmen dürfen. Aber es gibt auch andere Preise. Für erfahrene Kolleg:innen, die schon sehr viel für die Psychiatrie und Gehirngesundheit geleistet haben, gibt es den Pioneer Award, der dieses Jahr an Herrn Prof. Siegfried Kasper überreicht wurde. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, weil Prof. Kasper zu meinen wichtigsten Mentoren zählt.
Beim CINP-Kongress wird auch ein großer Wert auf Austausch gelegt und auf nachhaltige Kooperationen, die ich erfreulicherweise auch Jahr für Jahr in einer sehr konstruktiven, bereichernden und inspirierenden Art und Weise miterleben darf. Und was besonders wichtig ist, ist der Austausch zwischen den Young Researchers und den erfahreneren Expert:innen.
Depression, vor allem die therapieresistente Depression (TRD), ist eines Ihrer Spezialgebiete. Welche Vorträge zu diesem Thema fanden Sie am Kongress besonders spannend?
L. Bartova: Depression zählt tatsächlich seit vielen Jahren zu meinem Hauptforschungsgebiet und meiner klinischen Orientierung. Das Thema Depression war am Kongress sehr stark vertreten, sowohl in den Plenarvorträgen als auch in den anderen Symposien und Expert Talks. Zum Beispiel gab Prof. Guy Goodwin, UK, im ersten Plenarvortrag einen Überblick über den derzeit sehr großen „Hype“, die Psychedelika. Er sprach nicht nur über die Evidenzlage, sondern auch darüber, wie man sie wissenschaftlich bestmöglich interpretieren sollte. Außerdem regte Prof. Goodwin eine sehr spannende und klinisch relevante Diskussion über das Thema an, die sich nicht nur in den offiziellen Symposien fortgeführt hat, sondern z.B. auch bei den Networking Receptions. Die CINP hat bewusst weitere Talks im Programm konzipiert, bei denen das Thema vertieft wurde. Auch Prof. Gabriella Gobbi aus Kanada hat zu diesem Thema und dessen Praxisrelevanz gesprochen sowie auch Prof. Siegfried Kasper aus Wien.
Das Thema Psychedelika erhält schon seit einiger Zeit große mediale Aufmerksamkeit. So wie vor ein paar Jahren das Ketamin, das jetzt als intranasales Esketamin eine unverzichtbare Rolle im zugelassenen Bereich der Depressionsbehandlung spielt. In unserer Spezialambulanz für therapieresistente Depressionen wenden wir routinemäßig Esketamin intranasal an, das seit 2019 zugelassen ist. Die Patient:innen kommen jedoch mit den verschiedensten Informationen und haben häufig beispielsweise das Gefühl, dass ihnen „nur das Ketamin“ helfen kann. Oder sie fragen in demselben Sinne nach, ob bei uns Psychedelika wie Psilocybin eingesetzt werden. Umso wichtiger finde ich, dass wir als Expert:innen unseren Patient:innen in den individuellen Situationen bestmöglich helfen und somit evidenzbasierte Medizin vertreten. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass wir unsere Patient:innen hinsichtlich der Effektivität und Verträglichkeit dieser Behandlungen sowie deren empfohlener bzw. leitliniengerechter Anwendung bestmöglich informieren. Und ebenso dahin gehend, dass es auch Limitationen und Gefahren gibt. Es ist wichtig, dies in Balance zu sehen. Schließlich handelt es sich bei den Psychedelika um eine noch nicht zugelassene Therapie. Die bisherigen Daten sind vielversprechend, keine Frage, aber man sollte keine unrealistischen Erwartungen bei den Patient:innen wecken.
Eine Frage bei dieser Therapie ist auch, wie man die „Nebenwirkung“ des halluzinatorischen Erlebnisses versteht. Einige Forscher promoten sehr stark, dass dies die erwünschte Wirkung ist. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Dissoziation bei Ketamin oder Esketamin, von der wir klar wissen: Sie hat nicht unbedingt eine Assoziation mit der antidepressiven Wirksamkeit. Das haben viele Studien gezeigt. Und so ist es wichtig, auch unseren Patient:innen zu sagen: Die Intensität und auch die Länge der Dissoziation sind nicht entscheidend für den erwünschten antidepressiven Therapieeffekt. Das ist ein bisschen ähnlich dem halluzinatorischen Erleben bei Psychedelika. Wir wissen es nicht, ob jenes notwendig ist, damit es den Patient:innen letztendlich besser geht und die Therapie eine antidepressive Wirksamkeit zeigt. Und daher wollen wir uns das auch kritisch ansehen. So hat Frau Doz. Marie Spies in unserer Klinik auch eine Studie konzipiert, die bald beginnen wird und in der sie dieses halluzinatorische Erleben bei Psychedelika „blockieren“ wird. Dann wird sich weisen, ob die Substanzen trotzdem wirken. Solche Studien sind aus meiner Sicht unglaublich wichtig, damit wir dann unseren Patient:innen eine präzise Empfehlung geben können.
Wurden zur Diagnostik von Depressionen Daten am CINP-Kongress präsentiert?
L. Bartova: Ja, eine präzise Diagnostik betrachte ich in Hinblick auf die klinische Routine als enorm wichtig und relevant. Sehr gerne möchte ich hierbei besonders ein Symposium hervorheben, bei dem Prof. Pierre Blier aus Kanada, ein ehemaliger CINP-Präsident, den Vorsitz hatte. Den ersten Vortrag hielt Prof. Kasper, auch ein ehemaliger CINP-Präsident, und im Anschluss hielt unser Klinik-Vorstand Prof. Dan Rujescu, der auch unser CINP Vice President ist, einen Vortrag. Das Thema war, wie man bei der Depressionsdiagnostik und -behandlung prognostisch optimal vorgehen kann. Die Entwicklung in den Technologien war in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten enorm und es gibt sehr viele vielversprechende Daten aus dem Bereich des modernen Neuroimagings sowie der genetischen und epigenetischen Studien, besonders der genomweiten Assoziationsstudien (GWAS). Es wurde ein sehr schöner Überblick über die Diagnostik aus der klinischen Perspektive präsentiert und darüber, wie man die Genetik schon gezielt routinemäßig einsetzen kann.
Wenn ich zusammenfassen darf, dann gibt es für uns sehr gute Nachrichten. Man braucht nicht unbedingt aufwendige Untersuchungen wie Neuroimaging und Genetik. Wir können bereits initial wichtige und auch evidenzbasierte robuste klinische Marker in jedem klinischen Setting schnell und einfach definieren, die uns essenziell helfen können, die individuell optimale Therapie zu wählen und auch die Prognose einzuschätzen. Wenn man sich auf gewisse Faktoren konzentriert, diese gezielt abfragt oder beobachtet, dann kann man sich entweder für eine Therapie gezielt entscheiden oder auch das Therapieansprechen gut voraussagen. Und da hat die Klinik immer noch die robustesten Ergebnisse. Je nachdem, welche führenden Symptome der/die Patient:in zeigt: Wenn das zum Beispiel Anhedonie und Antriebslosigkeit sind, muss man nicht sofort mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) beginnen. Man kann dann auch die Gabe des vordergründig dopaminerg wirkenden Bupropions überlegen. Oder wenn der/die Patient:in unter Appetitlosigkeit leidet, Gewicht verloren hat und nicht schlafen kann – dann könnte man zum Beispiel Mirtazapin am Abend als First-Line-Therapie erwägen. Oder wenn man sieht, dass der/die Patient:in zum Beispiel im Rahmen der Depression zusätzliche psychotische Merkmale zeigt, dann sollten wir von Anfang an mit einem Antipsychotikum augmentieren und eventuell eine stationäre Aufnahme überlegen. Da wissen wir zum Beispiel auch, dass die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) sehr hilfreich ist, sollte man mit der medikamentösen Behandlung nicht schnell vorankommen. Wenn der/die Patient:in zusätzlich psychotische Symptome hat, weiß man, dass er/sie auch ein erhöhtes Risiko hat, eine therapieresistente Depression zu entwickeln.
Wenn man sich das von der genetischen Perspektive ansieht, dann muss man sagen, dass es viele vielversprechende Befunde gibt, die enorm spannend sind. Es werden monatlich sehr hochkarätige Publikationen veröffentlicht, aber wir sind noch nicht so weit, dass man es so in der breiten Routine weltweit integrieren könnte. Was allerdings schon in der Routine funktioniert, ist die sogenannte Pharmakogenetik.
Wenn man nämlich über Therapieresistenz spricht, dann ist da ein sehr wichtiger Begriff: die Pseudoresistenz. Das heißt, dass Patient:innen aufgrund von vermeidbaren Faktoren nicht auf ihre Therapien ansprechen. Und da kann zum Beispiel die Pharmakogenetik sehr wertvoll sein. Angenommen, wir behandeln Patient:innen sehr gut, sie werden entlang einer guten psychotherapeutischen Therapiestrategie therapiert, erhalten eine gute medikamentöse Behandlung und sie sind auch therapieadhärent, aber die Therapie wirkt einfach nicht. Der erste Schritt sollte dann die Bestimmung der medikamentösen Plasmaspiegel sein. Wenn diese zum Beispiel zu niedrig sind und der/die Patient:in eine adäquate Dosis des Medikaments einnimmt und therapieadhärent ist, dann wäre es naheliegend, sich zu überlegen, ob er/sie vielleicht die Medikamente zu schnell verstoffwechselt. Und da könnte man die Aktivität der Cytochrom-P450(CYP450)- Enzyme durch eine pharmakogenetische Untersuchung überprüfen und bestätigen, ob es sich um einen „Ultra-Rapid-Metabolizer“-Status handelt. Diese Patient:innen würden dann höhere Dosen von dem Medikament benötigen oder man würde ein anderes Medikament wählen, das diese CYP450-Verstoffwechselung umgeht, wie zum Beispiel der Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) Milnacipran. Umgekehrt gibt es Patient:innen, die auf niedrige Dosierungen von Medikamenten ganz viele Nebenwirkungen entwickeln. Wenn man die Bestimmung der medikamentösen Plasmaspiegel durchführt und dann höhere Spiegel des Medikaments angezeigt werden, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass dieser Mensch ein sogenannter „poor metabolizer“ ist. Der/die Patient:in würde dann von einer niedrigeren Dosierung profitieren oder von Medikamenten, die anders verstoffwechselt werden.
Gab es in anderen Bereichen relevante neue Daten, die Sie mitgenommen haben?
L. Bartova: Spannend fand ich zum Thema Craving im Rahmen der Nikotinabhängigkeit den Plenary Talk von Prof. Paul Kenny aus New York. Er präsentierte Daten, wie man dieses Craving diagnostisch und therapeutisch angehen kann. Dann wurden auch rezente Entwicklungen in der Suchtforschung besprochen: therapeutische Ansätze und überhaupt das Verständnis, beginnend bei der Forschung in Tiermodellen und auch an Menschen. In Neuroimaging-Studien konnte gezeigt werden, welche Neurotransmitter bei verschiedenen Suchterkrankungen eine Rolle spielen. Seien es Stimulanzien, Alkohol, Cannabis, Nikotin oder auch nichtsubstanzgebundene Süchte, die in der zunehmenden Digitalisierung eine immer größere Rolle spielen. Dazu gab es im Programm sehr schöne Symposien, wie man auch therapeutisch den Betroffenen helfen kann, wo man jetzt auch immer die zugrunde liegende Neurobiologie mitberücksichtigt. Dass Dopamin ein wichtiger Botenstoff ist, dass Opioide und Endocannabinoide eine wichtige Rolle spielen und natürlich auch Monoamine ist auch der Grund, warum man häufig versteckte Suchterkrankungen zum Beispiel im Rahmen der Depressions- oder Angstbehandlung entdeckt. Es ist wichtig, differenzialdiagnostisch die jeweiligen Motivationen, die jeweiligen Muster zu erkennen und was primär da war: beispielsweise die Suchterkrankung und dann die Depression – oder erst die Depression und danach eine Suchterkrankung.
Wie sieht es mit Komorbiditäten aus – was wurde dazu am Kongress präsentiert?
L. Bartova: Nicht nur in der Psychiatrie, sondern in der ganzen Medizin sind Komorbiditäten viel mehr die Regel als die Ausnahme. Das ist auch sehr stark auf dem CINP-Kongress betont worden – mit der positiven Nachricht, dass man, wenn man korrekt auf die Diagnostik und Therapie eingeht, alles sehr gut behandeln kann. So ist zum Beispiel eine sehr häufige Komorbidität bei Suchterkrankungen, aber auch bei Angststörungen, Depression oder Schizophrenie die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). In den Symposien wurden dazu die Diagnostik und die Therapie beleuchtet.
Wenn man über ADHS spricht, stellt man sich häufig den kleinen, zappeligen Jungen vor, der nicht zur Ruhe kommt. Und das ist auch sehr klar durchgekommen in den Symposien, dass man immer breit denken und sich nicht nur auf die führenden Symptome konzentrieren sollte. Auch wenn ADHS eine gewisse „Modediagnose“ geworden ist, so ist sie doch sehr häufig und oft versteckt. Zum Beispiel können Menschen mit ADHS sehr intelligente Menschen sein, die Leitungspositionen innehaben, die tolle Schulnoten hatten und Universitätsabsolvent:innen sind. Also Menschen, die sehr erfolgreich sind und die mithilfe ihres Intellekts schon früh gelernt haben, wie sie die Symptome bestmöglich kompensieren können. Diese Menschen werden häufig in der Mitte ihres Lebens erstdiagnostiziert, z.B. durch die Behandlung einer Depression, von Angststörungen oder eines Suchtverhaltens. Und häufig ist es ein Indiz für ADHS, wenn die Behandlung der Grunderkrankung nicht zum erwünschten Erfolg führt. Dann ist es oft sinnvoll, an ADHS zu denken, vor allem wenn die kognitiven Beschwerden anhalten.
Welche Symposien fanden Sie sonst noch interessant?
L. Bartova: Es gab einige Grundlagenforschungs-orientierte Symposien und dort wurde u.a. festgehalten, dass die Neuroimmunmodulation bei Gehirnerkrankungen eine große Rolle spielt. Und wir sehen auch bei konventionellen Antidepressiva und der Phytotherapie, dass diese Substanzen auch eine immunmodulatorische Komponente haben. Also nicht nur, wie wir das von Esketamin kennen. Auch Phytotherapeutika wie zum Beispiel Lavendelölextrakt (Silexan) oder Ginkgo (Cerebokan) haben nachweislich eine immunmodulatorische Komponente und auch eine Wirkung auf die Neuroplastizität.
Das ergibt schließlich einen schönen Bogen. Von den ganz leichten Therapeutika, wie man sie bei milder oder subsyndromaler Symptomatik anwendet, eben evidenzbasierte Phytotherapie, über die konventionellen Substanzen, Antidepressiva, Augmentationen mit atypischen Antipsychotika, Lithium bis zu den Therapien, die wir derzeit bei therapieresistenten Depressionen anwenden, zum Beispiel Esketamin. Lithium war am Kongress auch vertreten, wobei man bei Lithium immer mehr von einer „disease-modifying“ Therapie spricht. Es handelt sich also nicht nur um eine symptomatische Therapie, sondern auch um eine kausale Therapie, bei der auch antidementive Effekte berichtet wurden.
Wird Lithium häufig angewendet, weil es doch eher aufwendig bei der Einstellung ist und es auch das Risiko für Toxizität bei Langzeitgabe gibt?
L. Bartova: Lithium ist bei den bipolaren Erkrankungen sehr wertvoll in der Behandlung der akuten Manie und natürlich auch in der Phasenprophylaxe. Wichtig ist dabei, dass man in der Prophylaxe anders dosiert als bei der akuten Manie; man orientiert sich an den Plasmaspiegeln, die man sehr engmaschig kontrolliert. Bei der Einstellung der Manie kann ein Plasmaspiegel von 0,9–1,2mmol/l Lithium angestrebt werden. Bei der Phasenprophylaxe benötigen wir nicht so hohe Spiegel, da können sie niedriger sein. Man verwendet Lithium auch als Augmentationstherapie bei der Depression, da sollen sie sogar noch niedriger sein, es reicht, wenn die Lithiumspiegel zwischen 0,6 und 0,8mmol/l sind. Bei älteren Patient:innen reichen oft schon Spiegel zwischen 0,4 und 0,5mmol/l. Lithium kann man auch bei der sogenannten Glückspsychose einsetzen. Man soll aber natürlich kritisch sein, auch wenn Lithium ein unglaublich gutes Medikament ist – es wirkt auch unabhängig von der Grunderkrankung antisuizidal sehr gut –, aber trotzdem gibt es auch andere sehr wertvolle Alternativen. Lithium sollte besonders bei jungen Menschen sehr behutsam erwogen werden. Wenn man diese Therapie bei jungen Menschen beginnt und über Jahrzehnte verabreicht, dann sollte man auf jeden Fall regelmäßig die Nierenwerte und die Schilddrüsenwerte kontrollieren, weil sie sich im Langzeitverlauf tatsächlich toxisch auswirken können.
Sie waren Chair in der Session „Modulating the brain with light, sound and electric fields – the futureof non-invasive brain stimulation in psychiatry?“. Gibt es bei diesem Thema besondere Fortschritte?
L. Bartova: Die Gehirnstimulation spielt eine große Rolle bei der Behandlung von Gehirnerkrankungen und in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es neue, vielversprechende Ergebnisse, was auch der Fokus dieser Session war. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich das Symposium leiten durfte und dass auch die CINP das Symposium als relevant angesehen und unterstützt hat. Wenn ich mich zurückerinnere: Als ich 2019 meine ersten Vorträge zu diesem Thema konzipiert hatte, war die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) der transkraniellen Magnetstimulation (TMS) klar überlegen. So ist es immer noch, aber in den letzten Jahren gab es viele technologische Entwicklungen, sodass wir bei der TMS von einer viel besseren Wirksamkeit bei der Depression und darüber hinaus ausgehen können. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich als Co-Chair Prof. Georg Kranz gewinnen konnte, wobei er auch Speaker zum Thema TMS bei depressiven Erkrankungen war. Er hat die aktuellen Entwicklungen in der TMS im Rahmen der Depression sehr kompakt präsentiert. Er fasste zusammen, dass man jetzt wirklich von einer sehr guten Wirksamkeit der TMS ausgehen kann. Nicht nur bei der therapieresistenten Depression, bei der zum Beispiel die EKT weiterhin führend ist. Die TMS hat inzwischen auch eine Relevanz in der Behandlung von psychotischen Erkrankungen, zum Beispiel bei akustischen Halluzinationen im Bereich der Schizophrenie. Prof. Libor Ustohal aus Tschechien hat die Indikationen für TMS bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung und bei der Schizophrenie vorgestellt. Abschließend hat Frau Doz. Maria Teresa Ferretti ein sehr viel versprechendes Modell vorgestellt, bei dem sie die Verwendung von intermittierendem Licht mit einer Frequenz von 60 Hz untersucht.
Es gab eine Diskussionsrunde zum Thema Frauen in der Neuropsychopharmakologie, an der Sie teilnahmen. Was wurde hier diskutiert? Wie wichtig ist Ihnen das Thema Frauen in der Forschung?
L. Bartova: Ich finde, dass das Thema sehr wichtig ist. Wenn man Kongresse besucht, dann ist es immer noch so, dass die Chairs und Co-Chairs oder die Vortragenden vor allem bei den Industrie-Symposien meistens Männer sind. Ich bin eine große Befürworterin des Prinzips, dass man immer nach der Leistung evaluiert. Ich bin dagegen, dass beispielsweise bei einer Stellenbesetzung eine Frau bevorzugt wird, nur weil sie eine Frau ist. Die Leistung zählt!
Gleichzeitig finde ich, dass wir dieses Thema auch wirklich sichtbar machen sollen. Und somit freue ich mich über Assoziationen wie die Ärztinnen Österreichs oder dass es so ein Symposium wie bei der CINP gibt. Prof. Gabriella Gobbi hat zum Thema „Frauen in der Neuropsychopharmakologie“ eine Podiumsdiskussion ermöglicht. Das Panel hat sie hierfür sorgfältig ausgesucht und es bestand hauptsächlich aus Ärztinnen und Forscherinnen aus dem asiatischen Raum. Die Speakerin war Prof. Lianne Schmaal aus Melbourne, die einen Vortrag zum Thema Neuroimaging gehalten hat, wobei sie ihre eigenen Findings präsentieren konnte und uns daran teilhaben ließ, wie ihr Verständnis gewachsen ist und wie man dies schließlich vermehrt in der klinischen Routine implementieren konnte.
Ich habe ihren hochkarätigen Vortrag sowie die Diskussionsrunde danach, die sich auch über das offizielle Symposium hinaus ergeben hat, sehr genossen. Daraus sind auch neue Kooperationen entstanden.
Sie waren auch an der Session „Early Career Researchers Round Table“ beteiligt. Wie wichtig ist für Sie die Förderung des Nachwuchses?
L. Bartova: Die Förderung des Nachwuchses ist mir sehr wichtig. In dieser Session ist es gezielt darum gegangen, dass man einen Raum für junge Kolleg:innen eröffnet, für all die Themen, die sie derzeit bewegen. In der Faculty waren neben mir Prof. Gabriella Gobbi, Prof. Diego Pizzagalli, Doz. Maria Teresa Ferretti und Prof. Pornjira Pariwatcharakul vertreten. Wir haben uns am Anfang kurz vorgestellt, damit die jungen Kolleg:innen einen Überblick bekommen, wie unterschiedlich die Karrieren auf unterschiedlichen Kontinenten aussehen können. Die Teilnehmenden konnten dann gezielt Fragen an jene Personen richten, bei denen sie das Gefühl hatten, dass diese sie in der jeweiligen Individualsituation am besten unterstützen können. Und es hat sich eine sehr fruchtbare Diskussion ergeben. Themen waren zum Beispiel, wie man vorgeht, wenn eine hochkarätige Arbeit nicht gleich bei einem Journal angenommen wird. Oder wie wichtig es ist, dass man einen guten Mentor bzw. eine gute Mentorin hat, der/die Nachwuchsforscher:innen auch außerhalb der eigenen Arbeitsgruppe auf ihrem Weg begleitet und fördert. Und dass man auch international mit anderen Expert:innen in Verbindung kommt.
Vielen Dank für das Gespräch!
Quelle:
36th World Congress of Neuropsychopharmacology, 15.–18. Juni 2025, Melbourne, Australien
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...
«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...