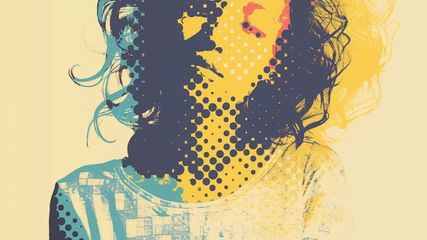©
Getty Images/iStockphoto
Demenz: Überforderung, Naht- und Bruchstellen
Jatros
Autor:
Prim.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Asita Sepandj
GerontoPsychiatrisches Zentrum (PSD Wien), Wien<br> E-Mail: asita.sepandj@psd-wien.at
30
Min. Lesezeit
10.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Demenz führt bei Betroffenen, Behandelnden, Betreuenden und Pflegenden häufig zu Überforderung. Das erweiterte sozialpsychiatrische Achsenmodell ist ein mögliches Gesamtbehandlungskonzept, welches versucht, das Risiko für Überforderung durch koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten zu minimieren.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Demenzbehandlung erfordert ein Gesamtbehandlungskonzept.</li> <li>Zeit, Kompetenz, Bereitschaft zur Kommunikation, Koordination und ausreichende Angebote sind Voraussetzungen für die Behandlung und Betreuung.</li> <li>Angehörige müssen im Gesamtbehandlungskonzept mitberücksichtigt werden.</li> <li>Betroffene brauchen eine Begleitung durch den gesamten Krankheitsverlauf.</li> <li>Demenz ist nicht heilbar, aber behandelbar.</li> </ul> </div> <p>Demenz ist prinzipiell ein Syndrom, welches aus einer „ABC-Abfolge“ besteht (Abb. 1): A für „activities of daily living“ (Alltagsschwierigkeiten), B für „behavior“ (Verhaltensveränderungen) und C für „cognition“ (Merkfähigkeit, Orientierung etc.). Weitere für die Diagnose notwendige Kriterien sind Bestehen der Symptomatik über mindestens 6 Monate und chronisch progredienter Verlauf. Die verschiedenen Demenzerkrankungen (Abb. 2) sind die Verursacher des Demenzsyndroms und verlaufen, was die zeitliche Abfolge betrifft, im Hinblick auf die Symptomcluster A, B, C in unterschiedlicher Weise.</p> <p>Bei den meisten Demenzerkrankungen sind anfänglich vor allem die Merkfähigkeit und Orientierung beeinträchtigt. Im weiteren Verlauf sind neben weiteren kognitiven Fähigkeiten die Alltagsfertigkeiten beeinträchtigt, das Erleben, Befinden und Verhalten der Betroffenen verändert sich. Demenzerkrankungen verlaufen in mehreren Stadien, deren Übergänge fließend sind. Im leichten Stadium ist die selbstständige Lebensführung geringfügig eingeschränkt, Unterstützungsbedarf besteht bei anspruchsvollen Tätigkeiten. Im mittelschweren Stadium braucht es bereits bei einfachen Tätigkeiten Unterstützung, die selbstständige Lebensführung ist deutlich eingeschränkt. Im schweren Stadium ist die selbstständige Lebensführung nicht möglich und der Unterstützungsbedarf bei allen Tätigkeiten erforderlich.</p> <p>Für eine adäquate Behandlung und Betreuung braucht es eine möglichst frühzeitige Diagnose und ein therapeutisches Gesamtkonzept, welches die Betroffenen und Beteiligten durch den Prozess der Erkrankung begleitet. Einem therapeutischen Gesamtkonzept liegt eine wichtige Frage zugrunde: Was lässt Betroffene länger gut zu Hause leben bzw. was verzögert den Heimeintritt? Die wesentlichen Faktoren dafür sind eine gute medizinische Versorgung, die Unterstützung der pflegenden Angehörigen und das Angebot gemeindenaher Dienste (Luppa et al., 2008, 2010; Riedel-Heller 2014). Therapieziele sind die Stabilisierung der Kognition und der Befindlichkeit, der Erhalt und die Verbesserung der Alltagsfertigkeiten und Lebensqualität durch soziale Teilhabe, Aktivitäten und Beziehungen.</p> <p>Daher erfordert ein therapeutisches Gesamtkonzept die Berücksichtigung aller betroffenen Bereiche und das Zusammenwirken verschiedenster Berufsgruppen. Das erweiterte sozialpsychiatrische Achsenmodell (Kalousek und Psota, 1999) (Abb. 3) ist ein solches Gesamtbehandlungskonzept.<br /> Im Folgenden wird dieses Modell dargestellt, die Anforderungen und die sich daraus ergebenden Naht- und Bruchstellen bei der Behandlung und Betreuung von Menschen mit Demenz werden hier aufgezeigt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1802_Weblinks_jatros_neuro_1802_s35_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1061" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1802_Weblinks_jatros_neuro_1802_s36_abb2.jpg" alt="" width="2153" height="1039" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1802_Weblinks_jatros_neuro_1802_s36_abb3.jpg" alt="" width="1417" height="1091" /></p> <h2>Das erweiterte sozialpsychiatrische Achsenmodell (Kalousek und Psota, 1999)</h2> <p><strong>Achse 1: psychisches & somatisches Zustandsbild</strong><br /> Die frühzeitige und sorgfältige Diagnostik (inkl. Differenzialdiagnostik) unter Berücksichtigung der somatischen Erkrankungen und der Gesamtmedikation ist die Grundlage für das weitere Prozedere. Ohne Diagnose erhalten Betroffene selten die entsprechenden Hilfsangebote, wie Behandlung, Betreuung, Pflege und Unterstützung, die erforderlich wären, um ein Leben in Würde und mit entsprechender Lebensqualität zu leben. Zur ersten Achse zählt auch die medikamentöse Behandlung der Demenzerkrankung und ihrer Begleitsymptomatik. Hier ist ganz besonders auf die Vermeidung anticholinerg wirksamer Medikamente zu achten (cave: Delir!). Erfordernisse sind ausreichende niederschwellige ambulante Angebote, leichte Erreichbarkeit, entsprechende Kompetenz, Vernetzungsmöglichkeiten und Bereitschaft zur Koordination und Kooperation mit anderen erforderlichen medizinischen und nicht medizinischen Diensten.</p> <p><strong>Achse 2: Wohnen</strong><br /> Die Mehrzahl der Betroffenen wünscht sich, zu Hause wohnen zu können. Erfordernisse für einen Verbleib zu Hause sind die Gewährleistung von Sicherheit, die Kontinuität in der Betreuung, das Vorhandensein mobiler medizinischer Angebote und mobiler Betreuungsangebote.</p> <p>Wenn ein Verbleib zu Hause nicht möglich ist, so braucht es demenzgerechte Alternativen (Wohngemeinschaften, stationäre Pflege) mit entsprechender Kompetenz in Therapie und Pflege.</p> <p><strong>Achse 3: Tagesstruktur/Tagesinhalt</strong><br /> Für Menschen mit Demenz sind ein strukturierter Tagesablauf, strukturierte Betreuungseinheiten und differenzierte Angebote je nach Stadium der Demenzerkrankung in Tageseinrichtungen erforderlich. Erfordernisse sind ein ausreichendes und leistbares Angebot, zeitliche und personelle Kontinuität, leichte Erreichbarkeit und der niederschwellige Zugang.</p> <p><strong>Achse 4: Angehörige</strong><br /> Ca. 80 % aller Menschen mit Demenz werden von ihren Angehörigen betreut und gepflegt. Daher braucht es auch ein entsprechendes Angebot für betreuende Angehörige. Es ist bekannt, dass die verringerte Belastung der pflegenden Angehörigen eine verringerte Hospitalisierung und Institutionalisierung der von Demenz Betroffenen zur Folge hat. Die Schwierigkeit für Betreuende besteht darin, dass sie Hilfe und Unterstützung für Menschen leisten, die sich selbst nur selten als hilfsbedürftig erleben. Erfordernisse sind ausreichende begleitende kompetente Angebote zur Information, Beratung und Intervention.</p> <p><strong>Achse 5: professionelle Helfer</strong><br /> Auch hier gilt, dass die Schwierigkeit für Betreuende darin besteht, dass sie Hilfe und Unterstützung für Menschen leisten, die sich selbst nur selten als hilfsbedürftig erleben. Erfordernisse sind ausreichende Kompetenz durch Ausbildung, Information, Beratung, Supervision und die Bereitschaft zur Vernetzung, Kooperation und Koordination mit anderen medizinischen und nicht medizinischen Diensten.</p> <p><strong>Achse 6: rechtliche und ethische Aspekte</strong><br /> Menschen mit Demenz sollten das Recht auf Begleitung/Assistenz und eine faire Pflegegeldeinstufung haben. Sie haben das Recht auf gesetzliche Vertretung (Vertretungsbefugnis, Vorsorgevollmacht, Sachwalterschaft, Erwachsenenschutz …). Es gilt die Fremd- und Selbstgefährdung zu berücksichtigen. Umgang, Kommunikation, Behandlung, Pflege und Betreuung sollen immer unter Berücksichtigung des Autonomiebedürfnisses, des mangelnden Krankheitsgefühls und der damit mangelnden Krankheitseinsicht erfolgen. Selbstverständlich sollten alle Beteiligten den Menschen mit Demenz mit Respekt, Achtsamkeit und Flexibilität begegnen.</p> <p>Zusammengefasst sind die Grundlage für das Gelingen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes zum einen das Vorhandensein des erforderlichen Angebots, ausgestattet mit entsprechender Kompetenz, zum anderen die Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation mit den Betroffenen selbst, mit ihren Angehörigen und mit allen beteiligten Berufsgruppen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...
«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...