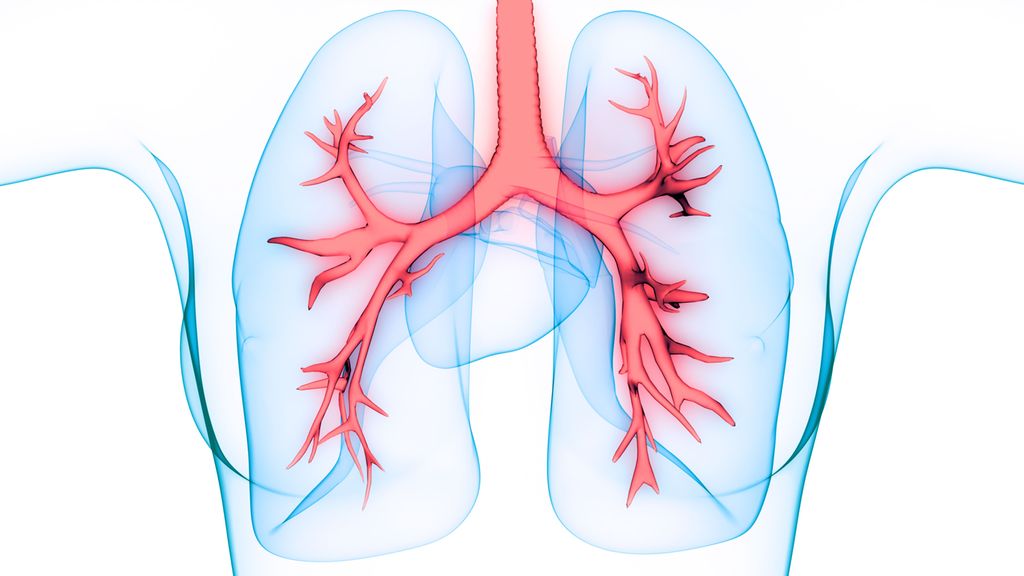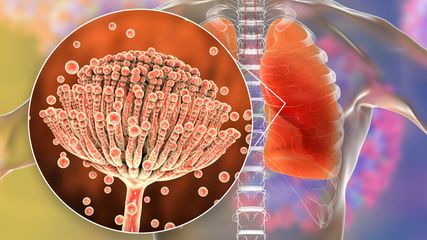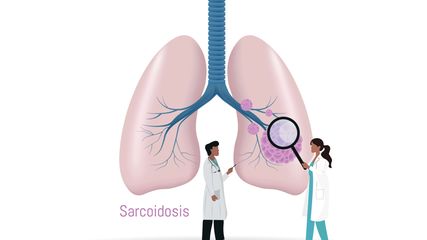<p class="article-intro">Schweißen ist nicht gleich Schweißen! Abhängig von den verwendeten Werkstoffen und Zusatzwerkstoffen ist die gesundheitliche Gefährdung der Atemwege und der Lunge durch die unterschiedlichen Schadstoffbelastungen zu beurteilen. Aber auch die arbeitshygienischen Rahmenbedingungen und etwaige Confounder wie z. B. Tabakkonsum spielen eine Rolle in der Entstehung respiratorischer Erkrankungen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Es gibt über 100 verschiedene schweißtechnische Verfahren, zu denen neben dem Verbindungs- und dem Auftragschweißen u. a. auch das thermische Schneiden (z. B. Brenn- oder Plasmaschneiden) und Spritzen (z. B. Flammspritzen) sowie das Löten gehören. Gemeinsam ist diesen Verfahren ein von außen zugeführter Energieeintrag, der den Grundwerkstoff und/oder den Zusatzwerkstoff (z. B. eine Elektrode, ein Lot) aufschmilzt. Als Energieträger können zum Beispiel die Gasflamme, der elektrische Lichtbogen, der elektrische Spannungsabfall (z. B. beim Widerstandsschweißen), mechanische Energie (z. B. beim Rührreibschweißen), Heißelemente (z. B. beim Kolbenlöten), exotherme chemische Reaktionen (z. B. beim Thermitschweißen), Ultraschall, kohärente optische Strahlung (bei allen Laserverfahren) und Elektronenstrahlen dienen. Als Werkstoffe werden überwiegend Metalle, vor allem Stähle, aber auch Nickelbasiswerkstoffe und Nichteisenmetalle wie Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze und andere Kupfer-basierte Legierungen (z. B. in Lötzusatzwerkstoffen) sowie Kunststoffe (Polymere) bearbeitet bzw. eingesetzt. Bereits in dieser kurzen Übersicht wird deutlich, dass es keine einheitliche Gesundheitsgefährdung für den Schweißer gibt und dass stets eine Beurteilung im Einzelfall erforderlich ist.</p>
<p class="article-intro">Schweißen ist nicht gleich Schweißen! Abhängig von den verwendeten Werkstoffen und Zusatzwerkstoffen ist die gesundheitliche Gefährdung der Atemwege und der Lunge durch die unterschiedlichen Schadstoffbelastungen zu beurteilen. Aber auch die arbeitshygienischen Rahmenbedingungen und etwaige Confounder wie z. B. Tabakkonsum spielen eine Rolle in der Entstehung respiratorischer Erkrankungen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Es gibt über 100 verschiedene schweißtechnische Verfahren, zu denen neben dem Verbindungs- und dem Auftragschweißen u. a. auch das thermische Schneiden (z. B. Brenn- oder Plasmaschneiden) und Spritzen (z. B. Flammspritzen) sowie das Löten gehören. Gemeinsam ist diesen Verfahren ein von außen zugeführter Energieeintrag, der den Grundwerkstoff und/oder den Zusatzwerkstoff (z. B. eine Elektrode, ein Lot) aufschmilzt. Als Energieträger können zum Beispiel die Gasflamme, der elektrische Lichtbogen, der elektrische Spannungsabfall (z. B. beim Widerstandsschweißen), mechanische Energie (z. B. beim Rührreibschweißen), Heißelemente (z. B. beim Kolbenlöten), exotherme chemische Reaktionen (z. B. beim Thermitschweißen), Ultraschall, kohärente optische Strahlung (bei allen Laserverfahren) und Elektronenstrahlen dienen. Als Werkstoffe werden überwiegend Metalle, vor allem Stähle, aber auch Nickelbasiswerkstoffe und Nichteisenmetalle wie Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze und andere Kupfer-basierte Legierungen (z. B. in Lötzusatzwerkstoffen) sowie Kunststoffe (Polymere) bearbeitet bzw. eingesetzt. Bereits in dieser kurzen Übersicht wird deutlich, dass es keine einheitliche Gesundheitsgefährdung für den Schweißer gibt und dass stets eine Beurteilung im Einzelfall erforderlich ist.</p> <h2>Gesundheitliche Gefährdungen</h2> <p>Personen, die schweißtechnische Arbeiten durchführen, können einer Vielzahl gesundheitsgefährdender Einwirkungen unterliegen. Neben inhalativen Belastungen gehören hierzu v. a. optische Strahlung, Lärm, klimatische Einwirkungen, ungünstige ergonomische Arbeitshaltungen, niederfrequente elektromagnetische Felder und unter besonderen Bedingungen auch eine erhöhte elektrische Gefährdung.</p> <h2>Gesundheitsgefahren aus pneumologischer und HNO-ärztlicher Sicht</h2> <p><strong>Asthma</strong><br /> Dieses wird bei Schweißern vergleichsweise selten beobachtet, sofern nicht aus anderen Gründen bereits eine unspezifische bronchiale Hyperreaktivität vorliegt. Es wird vereinzelt nach Exposition gegenüber chrom- oder nickelhaltigem Schweißrauch beobachtet, wobei teilweise eine Sensibilisierung angenommen wird. Beim Schweißen oder thermischen Schneiden von Werkstoffen mit organischen Beschichtungen (z. B. Primern, Lacken, Farben) können u. U. Isocyanate oder Karbonsäureanhydride freigesetzt werden, die Asthma auslösen können. Dies gilt auch beim thermischen Schneiden (z. B. mit dem Laser) von Kunststoffen auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis. Beim Weichlöten mit Flussmitteln, die Kolophonium, andere Harze oder organische Säuren enthalten, wird ebenfalls vereinzelt Asthma, möglicherweise infolge einer Sensibilisierung, beschrieben.</p> <p>Die nachfolgend dargestellten Symptome sind konzentrations- bzw. dosisabhängig; daher sind hierbei auch immer die im Einzelfall vorgelegenen arbeitshygienischen Randbedingungen (Absaugung, Lüftung, persönlicher Atemschutz) zu berücksichtigen.</p> <p><strong>Metallrauchfieber</strong><br /> Hierbei handelt es sich um eine systemische Entzündungsreaktion, die v. a. nach Inhalation von Zinkoxid, das z. B. beim Schweißen von verzinkten Werkstoffen oder zinkhaltigen Legierungen wie Messing entsteht, auftritt. Auch kupferhaltiger Rauch kann die Erkrankung auslösen. Charakteristisch sind Allgemeinsymptome wie Fieber, Schüttelfrost, Dyspnoe und metallischer Geschmack, beginnend mehrere Stunden nach der Exposition. In der Regel tritt innerhalb weniger Tage eine <em>Restitutio ad integrum</em> ein.</p> <p><strong>Toxisches Lungenödem</strong><br /> Die Inhalation hoher Konzentrationen von Reizgasen, insbesondere Stickstoffoxiden (nitrose Gase), kann toxische Lungenödeme verursachen. Stickstoffoxide werden bei allen Verfahren mit einer Gasflamme (Autogenverfahren) und bei Plasmaverfahren mit Luft oder Stickstoff als Plasmagas gebildet. Lungenödeme wurden v. a. nach Arbeiten mit großen Gasflammen, wie z. B. beim Flammrichten, in engen Räumen ohne ausreichende Belüftung beobachtet. Typisch ist die lange Latenzzeit von bis zu 48 Stunden zwischen Exposition und Erkrankungsbeginn.</p> <p><strong>Chemisch-irritative Wirkungen auf die oberen und unteren Atemwege, COPD</strong><br /> Schweißrauch kann je nach seiner Zusammensetzung auch Stoffe enthalten, die chemisch-irritativ und in hohen Konzentrationen auch toxisch auf die Schleimhäute der Atemwege wirken können. Beispielhaft seien an dieser Stelle genannt: Alkalichromate beim Schweißen mit hochlegierten, chromhaltigen, umhüllten Stabelektroden und Fülldrähten; andere irritativ wirkende Stoffe aus den Umhüllungen von Stabelektroden wie z. B. Fluoride und Kalziumkarbonat mit Bildung von Ca-Hydroxid an der feuchten Luft; Oxide von Metallen wie Mangan, Nickel, Kobalt, Vanadium, Kadmium (v. a. in der Vergangenheit bei Verwendung kadmiumhaltiger Lote beim Hartlöten); Flussmittel beim Hartlöten wie z. B. Zinkchlorid und Amine; Aldehyde und andere Irritanzien beim Weichlöten mit organischen Flussmitteln sowie beim Schweißen und thermischen Schneiden von Werkstoffen mit organischen Beschichtungen und von Kunststoffen. Ozon, das v. a. beim Schweißen von Aluminiumlegierungen und beim Wolframinertgasschweißen von Edelstahl gebildet wird, ist ein Reizgas für die Atemwege, das sowohl die oberen als auch die tiefen Atemwege betrifft. Stickstoffoxide sind in diesem Kontext ebenfalls zu berücksichtigen.<br /> In Abhängigkeit von den im Atembereich auftretenden Konzentrationen können diese Gefahrstoffe zu entsprechenden Symptomen wie Husten, Brennen der Schleimhäute, Pharyngitis/Laryngitis und Dyspnoe, teils in engerem, teils in weiterem Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit, führen. Häufig wird auch von einer Zunahme der Symptome im Verlauf einer Arbeitswoche mit Beschwerderückgang oder -freiheit an arbeitsfreien Wochenenden oder im Urlaub etc. berichtet. Langfristig kann daraus auch eine COPD resultieren.<br /> Schweißrauch ist nahezu vollständig alveolengängig; auch beim thermischen Schneiden und Spritzen ist ein Großteil der Partikel alveolengängig. Daher ist bei schweißtechnischen Tätigkeiten mit langfristigen, höhergradigen Expositionen auch beim Fehlen von chemisch-irritativ wirksamen Einzelstoffen bei Überschreitung der bronchialen und der pulmonalen Clearance- Kapazität aufgrund einer Partikeldeposition im Lungenparenchym mit der Entwicklung einer COPD zu rechnen. Erste Symptome treten dann häufig ohne erkennbaren Bezug zur Arbeitstätigkeit, oft bei körperlicher Belastung und z. T. auch nach Ende der beruflichen Exposition auf. Angesichts der langsamen Entwicklung einer COPD einerseits und des häufig vorliegenden Tabakrauchens als konkurrierenden Faktors andererseits ist die Kausalitätsbeurteilung im Einzelfall oft schwierig.</p> <p><strong>Lungenfibrosen</strong><br /> In seltenen Fällen werden nach langjährigen Schweißarbeiten an Stählen oder Aluminiumlegierungen mit hochgradigen Schweißrauchexpositionen Lungenfibrosen im Sinne einer sogenannten Siderofibrose bzw. einer Aluminose beobachtet.</p> <p><strong>Lungenkarzinom</strong><br /> Lichtbogenschweißer unterliegen einem im statistischen Mittel leicht erhöhten Lungenkrebsrisiko. Im Einzelfall sind für die berufskrankheitsrechtliche Bewertung kanzerogene Inhaltsstoffe wie Chrom(VI)-Verbindungen und Nickeloxid im Schweißrauch zu berücksichtigen. Allerdings gibt es keine Unterschiede beim Lungenkrebsrisiko zwischen Schweißern, die hochlegierte, chrombzw. nickelhaltige Werkstoffe bearbeiten, und jenen, die nur unlegierte Stähle bearbeiten. Die International Agency for Research on Cancer (IARC) hat 2018 Schweißrauch, ungeachtet seiner Zusammensetzung und des eingesetzten schweißtechnischen Verfahrens, als humankanzerogen (Gruppe 1) eingestuft. Eine entsprechende Legaleinstufung besteht in der EU derzeit jedoch nicht.</p> <p><strong>Pneumokokkenerkrankungen</strong><br /> Schweißer weisen für den Zeitraum ihrer beruflichen Exposition ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Pneumokokkenerkrankungen auf. Die Risikoerhöhung ist nach Beendigung dieser Tätigkeit rasch wieder rückläufig. In Österreich wie auch in Deutschland besteht deshalb eine entsprechende Impfempfehlung für diese Berufsgruppe.</p> <p><strong>Asbestbedingte Erkrankungen</strong><br /> Schweißer waren in der Vergangenheit häufig gegenüber Asbestfasern exponiert. Daher treten aufgrund der z. T. sehr langen Latenzzeiten auch heute noch asbestbedingte Erkrankungen wie Lungenkarzinome und Mesotheliome in dieser Berufsgruppe auf.</p> <p><strong>Lärmschwerhörigkeit</strong><br /> Etliche schweißtechnische Verfahren, insbesondere das Gasschweißen, thermisches Trennen, Spritzen und Fugen sowie einige Schutzgasverfahren können zu Schallpegelemissionen von 90 dB(A) und höher führen. Hinzu kommt, dass in Betrieben der Metallindustrie und auf Baustellen häufig auch durch andere Lärmquellen hohe Schallpegel entstehen. Lärmschwerhörigkeit ist deshalb eine der häufigsten Berufskrankheiten bei Schweißern.</p> <h2>Neuere Technologien</h2> <p><strong>Additive Fertigungsverfahren –„3D-Druck“</strong><br /> Durch schichtweise Auftragung (additive Fertigung) werden heute sowohl Metalle als auch Kunststoffe bearbeitet. Als Energieträger kommt hierbei häufig ein Laser zum Einsatz. Bei der Verwendung von Metallpulvern (Pulverbettverfahren) entstehen Gefährdungen der Atemwege, v. a. bei der Öffnung von Gebinden und Schüttvorgängen sowie der Abreinigung von überschüssigem Pulver. Kunststoffe (meist in Granulatform) werden nur bei Temperaturen bis etwa 250° C aufgeschmolzen. Gleichwohl sind hierbei z. T. Emissionen von ultrafeinen Partikeln und bei Einsatz bestimmter Polymere auch von irritativ wirksamen Stoffen wie insbesondere Aldehyden nachgewiesen worden.</p> <p><strong>Laserbearbeitung von Kunststoffen</strong><br /> Beim Schweißen und insbesondere beim Schneiden von Kunststoffen mit Lasern können hohe Emissionen von thermischen Zersetzungsprodukten entstehen. Nahezu obligat ist mit der Freisetzung von Aldehyden zu rechnen. In Abhängigkeit von der Art der Kunststoffe können auch andere chemisch-irritativ wirksame Pyrolyseprodukte wie Acrylate (z. B. aus Polymethylmethacrylat, „Plexiglas“) und Salzsäuredämpfe (z. B. aus Polyvinylchlorid, PVC) emittiert werden. Zudem können sensibilisierende Isocyanate (aus Polyurethanen, PU) und Karbonsäureanhydride (z. B. aus Epoxiden) emittiert werden. Der Laserbediener ist vor hohen Konzentrationen gegenüber diesen Stoffen allerdings meist durch eine, zum Schutz vor optischer Strahlung bestehende, Einhausung oder Abschirmung des Laserbereiches geschützt.</p> <p><strong>Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen</strong><br /> In jüngerer Zeit werden häufig auch faserverstärkte Polymere mit Lasern bearbeitet. Hierbei ist die Freisetzung von langen dünnen Fasern (WHO-Fasern) insbesondere aus Karbonfaser- verstärkten Kunststoffen möglich, die ein kanzerogenes Potenzial aufweisen können. Eine abschließende Beurteilung ist aufgrund derzeit noch laufender Untersuchungen dazu nicht möglich.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <ul> <li>Schweißtechnische Verfahren umfassen ein weites Spektrum von Technologien und eingesetzten bzw. bearbeiteten Werkstoffen.</li> <li>Sowohl qualitativ als auch quantitativ können höchst unterschiedliche Gefahrstoffemissionen entstehen, die Erkrankungen der oberen und der tiefen Atemwege sowie der Lunge verursachen können.</li> <li>Schweißer können darüber hinaus hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sein.</li> <li>Zur Beurteilung der Expositionen und Gesundheitsgefährdungen im Einzelfall spielen darüber hinaus die jeweils vorliegenden arbeitshygienischen Randbedingungen wie z. B. Einhausung/Abschirmung von Arbeitsbereichen, Absaugung von Gefahrstoffen, Lüftungsverhältnisse und die sachgerechte Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz, Gehörschutz) eine wichtige Rolle.</li> <li>Für den Fall einer Kausalitätsbeurteilung von Erkrankungen sind deshalb gute Kenntnisse von den Schweißtechnologien, den jeweils verwendeten Werkstoffen und Zusatzwerkstoffen (z. B. Elektroden) und den zu erwartenden Gefahrstofffreisetzungen erforderlich. Zudem müssen die konkreten Arbeitsbedingungen im Einzelfall und Confounder wie z. B. frühere Asbestfaserexpositionen und das Tabakrauchen berücksichtigt werden.</li> </ul> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>