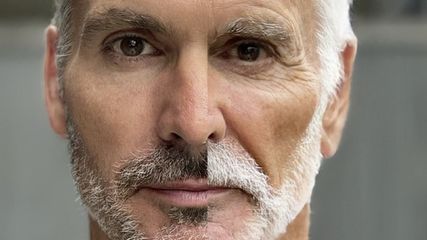Dermatochirurgie der Nasenregion
Leiter der Dermatochirurgie der Uniklinik PMU<br>Salzburg<br>E-Mail: a.hintersteininger@salk.at
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Aufgrund der Häufigkeit sowohl von nichtmelanozytären als auch von melanozytären Hauttumoren im zentrofazialen Bereich ist die Kenntnis der Anatomie sowie der ästhetischen Einheiten des Gesichtes und der Nase für jeden Hautchirurgen eminent wichtig.
Keypoints
-
Defekte im Bereich der Nasenwurzel und infranasal unterhalb des Nasenflügels können Per-secundam-
Heilung ausheilen. -
Bei Vollhauttransplantaten
ist auf die Wahl der Hautentnahmestelle besonders zu achten. Die transplantierte Haut sollte der Nasenhaut in Farbe und Textur möglichst ähnlich sein. -
Regionallappenplastiken sind eine elegante Lösung zur Deckung größerer Defekte. Die Wahl des geeigneten
Lappens hängt stark von der betroffenen Nasenregion ab. -
Primäres Ziel ist die Tumorresektion, die über allem
stehen muss. Die nachfolgende Defektdeckung soll das bestmögliche funktionelle und ästhetische Ergebnis
liefern.
Das Nasengerüst besteht aus einem knöchernen und einem knorpeligen Anteil. Der Knorpel bildet den größeren Teil der Nase. Er ist im Gegensatz zum Knochen beweglich und schützt das Nasengerüst damit vor Verletzungen. Dem Os nasale anschließend finden sich die Dreiecksknorpel, welche den Nasenrücken bilden. Auch Nasenspitze und Nasensteg bestehen aus Knorpeln sowie die Nasenflügel aus den Nasenflügelknorpeln, die den Nasenlöchern ihre Kontur geben.
Die Herausforderung der Tumorchirurgie der äußeren Nase besteht erstens in der R0-Resektion des jeweiligen Tumors, die je nach Tumorentität mit den jeweiligen, leitliniengerechten Sicherheitsabständen zu erfolgen hat. Die zweite Schwierigkeit liegt in der nachfolgenden Defektdeckung, die das bestmögliche funktionelle und ästhetische Ergebnis liefern muss.
Einfache Defektdeckung
Die einfachste Möglichkeit, eine Operationswunde nach Tumorexzision abheilen zu lassen, ist die Per-secundam-Heilung. An der Nase eignet sich diese erfahrungsgemäß nur an 2 Stellen, einerseits im Bereich der Nasenwurzel zum medialen Augenwinkel hin und andererseits infranasal unterhalb des Nasenflügels zur Oberlippe hin, wo mitunter große Defekte lediglich durch fett-feuchte Verbände, die alle paar Tage gewechselt werden, zur Abheilung gebracht werden können. Die Per-secundam-Heilung an anderen Nasenregionen sollte nicht in Erwägung gezogen werden, da es durch die Schrumpfungstendenz im Rahmen der Selbstheilung der Wunden zu unschönen ästhetisch und vor allem auch funktionell störenden Narbenzügen kommen kann. Primärverschlüsse im Sinne einer Dehnungsplastik eignen sich vor allem im Bereich des Nasenrückens, wo vor allem bei betagteren Patienten oft genug Gewebe vorhanden ist, sodass durch eine Wundrandmobilisation streng oberhalb des Perichondriums und des Periosts nach schiffchenförmiger Tumorexzision eine Wunde primär verschlossen werden kann.
Vorgehen bei großen Defekten
Bei mitunter großen Defekten und intaktem Nasengerüst sollte der Einsatz
von Vollhauttransplantaten zur Defektdeckung nicht unterschätzt werden. Wesentlich ist die Wahl der Hautentnahmestelle, weil empfehlenswert ist, dass die transplantierte Haut der Nasenhaut in der Farbe und der Textur ähnelt. Postoperativ sind die Patienten angehalten, das abgeheilte Transplantat rückzufetten und zu massieren, um einem Lymphödem vorzubeugen, sowie intensive UV-Exposition zu meiden, welche zu einer Hyperpigmentierung des Transplantates führen könnte. Ein Vorteil der Eigenhauttransplantation gegenüber der Regionallappenplastik ist die frühzeitige Erkennung eines Tumorrezidivs.
Regionallappenplastik je nach Nasenregion wählen
Oft gewählte und elegantere Lösungen zur Defektdeckung größerer Wunden nach Tumorresektion sind die Regionallappenplastiken. Es gilt, zwischen den „random pattern flaps“, welche diffus durch den subdermalen Gefäßplexus versorgt werden, und den „axial pattern flaps“, welche durch ein definiertes Blutgefäß versorgt werden, zu unterscheiden. Bei intaktem Nasenskelett kommen „random pattern flaps“ zur Defektdeckung zum Einsatz. Je nach Nasenregion können Verschiebelappen-, Rotationslappen- oder Doppeltranspositionslappenplastiken zum Einsatz kommen. Die Wahl des jeweiligen Lappens ist stark abhängig von der Nasenregion. So können z.B. Defekte an der Nasenspitze mit einem myokutan gestielten Verschiebelappen von kranial mit Backcut im Glabellabereich gedeckt werden. Defekte am Nasenflügel können mittels Transpositionslappens von nasolabial oder Doppeltranspositionslappens verschlossen werden. Transpositionslappen neigen postoperativ zur „trapdoor deformity“, weswegen intraoperativ eine ausgiebige Wundrandmobilisation und postoperativ eine Lappenmassage nach erfolgter Einheilung empfehlenswert sind. Die Compliance des Patienten (Nikotinkarenz) sowie die Wahl des richtigen Nahtmaterials (schnell resorbierbare Intrakutannähte sowie monofile feine Hautnähte, welche nach 5 bis 7 Tagen gezogen werden) sind ganz wesentlich für ein optimales ästhetisches postoperatives Ergebnis.
Abb. 1: Intraoperativer Situs bei Zustand nach Basaliomexzision an der Nase, im Gesunden entfernt und Defektdeckung mit myokutanem Verschiebelappen von kranial (l). Patient zwei Wochen postoperativ (r).
Stirnlappenplastik bei knorpelinfiltrierenden Tumoren
Nicht selten sind dermatochirurgisch und plastisch-chirurgisch tätige Ärzte mit knorpelinfiltrierenden Tumoren im Nasenbereich konfrontiert. Vor allem immunsupprimierte Patienten neigen zu tief infiltrativ wachsenden, teilweise auch perineural wachsenden Spinaliomen. Über allem steht die Tumorresektion, die im Gesunden erfolgen muss. Auch um den Preis von teilweise großen Defekten, die Teile oder auch das gesamte Nasenskelett miterfassen können. Insbesondere bei allschichtig penetrierenden Nasendefekten ist die Stirnlappenplastik, welche zu den axialen temporär gestielten Lappenplastiken zählt, die einzige Methode, um eine epithetische Versorgung zu umgehen. Beim medianen Stirnlappen bieten die Vasa supratrochleares die axiale Gefäßversorgung. Präoperativ empfiehlt sich das Einzeichnen der Gefäßverläufe mithilfe des Ultraschall-Dopplers oder des Duplexverfahrens. Der Lappen besitzt eine sehr gute und ausreichende axiale Gefäßversorgung und kann um 180° gedreht werden. Die operative Vorgehensweise kann in einer oder in mehreren Sitzungen erfolgen. Die erste Sitzung ist fakultativ und kann bei unsicherer Vaskularisation oder einem sehr großen Längen-Breiten-Verhältnis durchgeführt werden. Sie beinhaltet die Hebung des Stirnlappens, ohne dass er in den Defekt verlagert wird. Durch die Umschneidung erfolgt eine gewisse Konditionierung der vaskulären Versorgung. Im Falle von notwendigen Innenauskleidungen zur allschichtigen Rekonstruktion von Nasendefekten wird ein Spalt- oder Vollhauttransplantat an der Innenseite der Lappenspitze oder am Restknorpel appliziert. In weiterer Folge wird der Lappen dann um 180° gedreht und in den zentrofazialen Defekt hineingelegt. Der Hebedefekt an der Stirn wird mit temporären Wundabdeckungen versorgt oder aber primär vernäht.
Nach 2 bis 4 Wochen ist die Lappenspitze durch Neueinsprießen von Gefäßen aus dem Wundgrund und dem Wundrand eingeheilt. Danach erfolgen die Durchtrennung des Lappenstiels und die endgültige Einpassung der Lappenspitze. Der verbleibende Lappenstiel wird in den Hebedefekt rückverlagert oder aber exzidiert und verworfen.
Eventuell verbleibende Restdefekte aus der Entnahmeregion können mit Transplantaten oder lokalen Lappenplastiken versorgt werden. Durch das Fehlen der knorpeligen Strukturen kann es postoperativ zu einer erschwerten Nasenatmung und zu unschönen Kerben am betroffenen Nasenflügel kommen. Dem kann mit autologer Knorpeltransplantation von z.B. der Ohrhelix entgegengewirkt werden. Gerade bei älteren und für größere operative Eingriffe nicht belastbaren Patienten kann bei allschichtig penetrierenden Nasendefekten auch eine epithetische Versorgung in Erwägung gezogen werden.
Literatur:
beim Verfasser
Das könnte Sie auch interessieren:
„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“
Mit dem diesjährigen Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) in Salzburg hat Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller ...
Minimalinvasive Gesichtsrejuvenation
Die minimalinvasive Gesichtsverjüngung hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Patienten wünschen sich zunehmend effektive, aber zugleich schonende Methoden, die ohne ...
Neue Wege in der Versorgung grosser Wunden im Kalottenbereich
Grosse Defekte im Bereich der Kopfhaut können dank gesteuerter Geweberegeneration mittels alloplastischer, resorbierbarer Matrix mit dem GREAT-Konzept (Guided Tissue REgeneration by ...