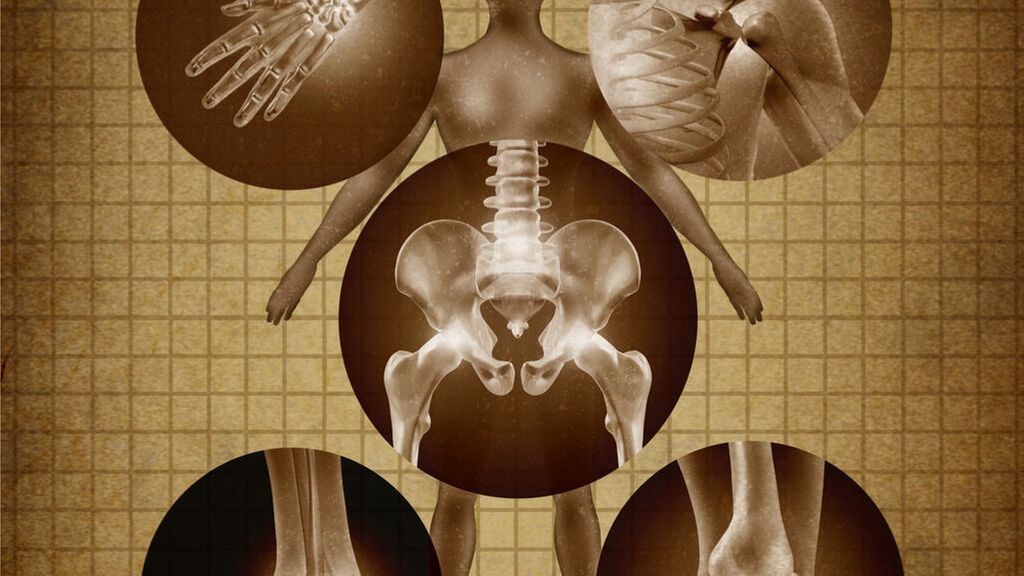
Kanisterlose Unterdruck-Wundtherapie in der Fusschirurgie
Leading Opinions
Autor:
Dr. med. Martin Wiewiorski
Klinik für Orthopädie und Traumatologie<br> Kantonsspital Winterthur<br> E-Mail: wiewiorskim@gmail.com
30
Min. Lesezeit
16.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Wundheilungsstörungen und Infektionen nach Eingriffen an Fuss- und Sprunggelenk haben schwerwiegende Folgen für den Patienten und kreieren weitreichende Folgekosten für das Gesundheitssystem. Einige Studien aus dem chirurgischen Bereich konnten zeigen, dass eine Niederdruck-Wundtherapie das Risiko für solche Komplikationen senken kann. Ich berichte über die ersten Erfahrungen, welche bei elektiven und postakuten Eingriffen an Fuss- und Sprunggelenk mit einem kanisterlosen Unterdruck-Therapie-System (PICO<sup>®</sup>) gesammelt wurden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Trotz präoperativer Antibiotikagabe, zunehmenden technischen Fortschritts bei Operationstechniken und verbesserter Nachbehandlungsschemen sind Wunddehiszenzen und Wundinfektionen bei Eingriffen an Fuss- und Sprunggelenk gefürchtete Komplikationen.<sup>1</sup> Dies liegt einerseits an anatomischen Gegebenheiten, wie dem dünnen Weichteilmantel mit meist minimaler subkutaner Fettschicht, fragilen Faszien und dem kompromittierenden Einfluss der Sehnen auf die Wundintegrität (Bogensehneneffekt). Andererseits kann vor allem bei älteren Patienten eine reduzierte Perfusion des Fusses vorliegen. Zudem ist auch bei konsequenter präoperativer Desinfektion eine residuelle mikrobiologische Besiedlung der Zehenzwischenräume nachweisbar. Im Komplikationsfall sind grosszügige Wundausschneidungen häufig nicht möglich und der Einsatz lokaler Verschiebelappen sehr limitiert. Der Einsatz freier Lappenplastiken ist möglich, geht aber mit einer erheblichen Belastung für den Patienten und langem stationärem Aufenthalt einher. Als Konsequenz muss alles getan werden, um Wundheilungsstörungen und tiefe Infekte zu vermeiden.<br /> Essenziell für eine adäquate Wundheilung am Fuss sind neben der präoperativen Abklärung (Duplex-Sonografie bei Risikopatienten, ggf. Intervention) und Vorbereitung der Weichteile (Nagelpflege, antimykotische Therapie, Reinigung mit desinfizierender Seife, Lymphdrainage) vor allem das intraoperative Handling der Weichteile und ein korrekter spannungsfreier Wundverschluss. Zusätzlich zeigt die Unterdrucktherapie (auch Vakuumtherapie, «vacuum assisted closure») als etablierte Methode zur Abdeckung von Operationswunden einen positiven Einfluss auf die Rate der Wundheilungsstörungen und Infektionen. Seit einiger Zeit ist eine batteriebetriebene, kanisterlose Variante verfügbar (PICO<sup>®</sup>, Smith & Nephew, Baar, Schweiz), welche wesentliche Vorteile – vor allem hinsichtlich Patientenkomfort – bietet. Das Ziel dieses Artikels ist es, die Handhabung des Systems zu beschreiben, die eigenen Erfahrungen zu schildern und diese anhand aktueller wissenschaftlicher Artikel zu diskutieren.</p> <h2>Grundprinzipien einer Niederdruck- Wundtherapie</h2> <p>Die Prinzipien der Niederdruck-Wundtherapie wurden vor allem an offenen Wunden im Rahmen von Tierversuchen ermittelt. Die Hauptaspekte dieser Therapie sind: Stimulation der Angiogenese, vermehrte Bildung von Granulationsgewebe, Reduktion von Ödemen, Kontrahieren der Wundränder.<br /> Bei kanisterlosen Systemen wie dem PICO<sup>®</sup> spielt der Wegtransport der Wundflüssigkeit keine wesentliche Rolle, da die Anwendung nur bei geschlossenen, wenig exsudierenden Wunden Sinn macht. Einer der wesentlichen Aspekte ist hier sicherlich die Reduktion der Spannung auf den Wundrändern (um 45–70 % ). Auch die Verbesserung des Lymphabflusses spielt eine wichtige Rolle. Experimentelle Studien konnten zeigen, dass die Anwendung einer kanisterlosen Niederdruck-Wundtherapie zu einer Reduktion von Serom/Hämatom in der Wunde führt, ohne dass Flüssigkeit durch die Inzision abgesogen wird.</p> <h2>Technische Aspekte von PICO<sup>®</sup></h2> <p>PICO<sup>®</sup> ist ein mobiles Unterdruck- Wundtherapiesystem zur Einmalanwendung (Abb. 1). Es besteht aus einem selbstklebenden Wundverband, welcher über einen Schlauch mit einer Pumpe konnektiert ist. Diese wird von zwei AA-Batterien betrieben und baut für eine Woche einen voreingestellten Unterdruck von 80mmHg auf. Verschiedene Längen und Breiten sind erhältlich.</p> <h2>Installation</h2> <p>Vor dem Wundverschluss ist auf trockene Wundverhältnisse zu achten. Das Einlegen von Drainagen schliesst eine PICO<sup>®</sup>-Anwendung nicht aus. Es ist in solch einem Fall jedoch darauf zu achten, dass die Drainageschläuche ausserhalb des abgeklebten Bereichs ausgeleitet werden, um eine Entfernung ohne Kompromittierung des PICO<sup>®</sup>-Verbandes zu ermöglichen. Der eigentliche Verband wird zusätzlich an den Rändern mit der beigelegten Folie abgedichtet. Jedoch sollte nicht der komplette Verband überklebt werden, da ca. 80 % des Wundexsudats über die Oberfläche des Verbandes verdunsten. Die Dichtigkeit kann geprüft werden, indem der Schlauch des OP-Saugers kurz an den Konnektor gehalten wird. Ist der Verband dicht, wird die angeschaltete Pumpe angeschlossen. Weitere Kompressen/Verbände sind nicht notwendig. Der Fuss kann locker elastisch gewickelt werden.</p> <h2>Kontrolle und Entfernung</h2> <p>Im Rahmen eines stationären Aufenthaltes erfolgt eine tägliche Kontrolle der Dichtigkeit und der angesaugten Sekretmenge. Ein Schema für das postoperative Regime findet sich in der Abbildung 2. Dieses bildet die Erfahrungswerte des Autors ab und weicht zum Teil von der vom Hersteller beschriebenen Anwendung ab. Vom Hersteller wird eine Deinstallation des PICO<sup>®</sup> bei abgelaufener Energieversorgung nach einer Woche empfohlen. Wenn medizinisch notwendig, kann ein neuer PICO<sup>®</sup> für weitere 7 Tage oder bei Bedarf auch kürzer angelegt werden. Die funktionslosen Pumpen werden gesammelt und zum Recycling an den Hersteller zurückgeschickt.</p> <h2>Eigene Erfahrungen</h2> <p>Der Autor setzt PICO<sup>®</sup> bei folgenden Zugängen am Rückfuss ein: anteriore Zugänge (OSG-Prothese/-Arthrodese, Tibialis- anterior-Rekonstruktion) und posteriore Zugänge (OSG-Arthrodese, Achillessehnenrekonstruktion) (Abb. 3).<br /> Zwischen April 2017 und März 2018 wurden insgesamt 24 Patienten (16 männlich, 8 weiblich, mittleres Alter 58 [min. 26, max. 81] mit dem PICO<sup>®</sup> versorgt. Folgende chirurgische Interventionen erfolgten: Achillessehneneingriff (12), OSGProthesen (6), Rekonstruktionen des Tibialis anterior (2), andere (4). Der ASAScore war bei 2 Patienten 1, bei 14 Patienten 2 und bei 8 Patienten 3.</p> <p>Die Behandlung erfolgte gemäss Abbildung 2. Nach Abnahme des PICO<sup>®</sup> nach zwei und sechs Wochen erfolgte eine Beurteilung der Wunde gemäss den Kriterien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).<sup>2</sup> Vier Patienten stellten sich vorzeitig vor, weil sie nach einer Woche befürchtet hatten, dass das PICO<sup>®</sup>- Gerät nicht mehr funktioniert. Der Verband wurde kontrolliert, war in allen Fällen unauffällig und wurde erst regulär am 2-Wochen-Termin entfernt.</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Der Autor konnte anhand einer Fallserie zeigen, dass die Anwendung des PICO<sup>®</sup> bei fusschirurgischen Eingriffen sicher war und keine unerwünschten Effekte auftraten. 23 von 24 Patienten zeigten nach der Abnahme des PICO<sup>®</sup> reizlose, geschlossene Wundverhältnisse. Eine Wundrandnekrose (OSG-Prothese) trat bei einem Patienten auf und konnte unter konservativer Therapie folgenlos abheilen. Ein Wundinfekt gemäss den CDC-Kriterien wurde nicht verzeichnet. Die Patienten tolerierten die PICO<sup>®</sup>-Therapie gut. Mehrere Patienten zeigten sich allerdings beunruhigt, weil sich das PICO<sup>®</sup>-Gerät nach ca. einer Woche abschaltet. Als Konsequenz wurde ein Informationsblatt erstellt, welches die Funktionsweise und eigenständige Dekonnektion des abgeschalteten PICO<sup>®</sup> erklärt und allen Patienten bei der Entlassung gegeben wird.<br /> Die Ergebnisse dieser Fallserie decken sich mit den Erfahrungen anderer Autoren. Dem Autor ist nur eine «Peerreviewed »-Publikation bekannt, die die Anwendung des PICO<sup>®</sup> in der Fusschirurgie untersucht. Matsumoto und Parekh haben 74 Patienten nach OSG-Prothese evaluiert. Davon wurden 37 Patienten postoperativ mit dem PICO<sup>®</sup> behandelt, die anderen erhielten konventionelle Verbände mit nicht klebender, absorbierender Wundauflage (Telfa, Medtronic, Minneapolis, USA).<sup>3</sup> Die Patienten tolerierten den PICO<sup>®</sup> problemlos. Wundheilungsstörungen traten bei einem Patienten in der PICO<sup>®</sup>- Gruppe auf, bei 9 Patienten in der Kontrollgruppe. PICO<sup>®</sup> reduzierte Wundheilungsstörungen signifikant (Risikoverhältnis 0,10). In einer vergleichenden retrospektiven Studie untersuchten Adogwa et al. 160 Patienten, welche einer langstreckigen thorakolumbalen Spondylodese unterzogen wurden.<sup>4</sup> Bei 46 Patienten wurde nach Wundverschluss ein PICO<sup>®</sup> für 3 Tage angelegt. In dieser Gruppe wurden 50 % weniger Wunddehiszenzen beobachtet. Die Inzidenz von Wundinfektionen war signifikant kleiner (10,6 % ) im Vergleich zur Gruppe ohne PICO<sup>®</sup> (14,9 % ; p=0,04).<br /> Strugala et al. führten eine Metaanalyse von 16 Studien durch, bei denen ein PICO<sup>®</sup> nach Wundverschluss benutzt wurde.<sup>5</sup> Es konnte gezeigt werden, dass nach PICO<sup>®</sup>-Anwendung die Rate der Wunddehiszenzen, die Inzidenz von Wundinfekten und die Zeit des Aufenthalts des Patienten im Spital signifikant reduziert werden konnten.</p> <h2>Konklusion</h2> <p>Die Anwendung des PICO<sup>®</sup>-Unterdrucktherapiesystems ist sicher und kann die Inzidenz von Wundheilungsstörungen und Infektionen in der Fusschirurgie reduzieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1802_Weblinks_lo_ortho_1802_s29_abb1+2.jpg" alt="" width="2134" height="1770" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1802_Weblinks_lo_ortho_1802_s30_abb3+tab1.jpg" alt="" width="2150" height="1889" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Wiewiorski M et al.: Risk factors for wound complications in patients after elective orthopedic foot and ankle surgery. Foot Ankle Int 2015; 36(5): 479-87 <strong>2</strong> Horan TC et al.: CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Am J Infect Control 1992; 20(5): 271-4 <strong>3</strong> Matsumoto T, Parekh S: Use of negative pressure wound therapy on closed surgical incision after total ankle arthroplasty. Foot Ankle Int 2015; 36(7): 787-94 <strong>4</strong> Adogwa O et al.: Negative pressure wound therapy reduces incidence of postoperative wound infection and dehiscence after long-segment thoracolumbar spinal fusion: a single institutional experience. Spine J 2014; 14(12): 2911-7 <strong>5</strong> Strugala V, Martin R: Meta-analysis of comparative trials evaluating a prophylactic single-use negative pressure wound therapy system for the prevention of surgical site complications. Surg Infect (Larchmt) 2017; 18(7): 810-9</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität
Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...
Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen
Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...
Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems
Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...


