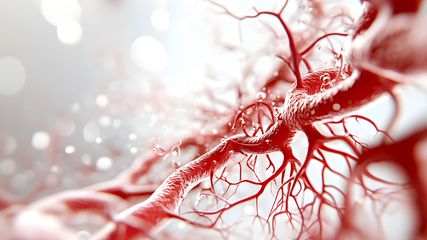Endoskopisch assistierte Operationstechniken in der Wirbelsäulentraumatologie
Autor:
Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Kambiz Sarahrudi
Abteilung für Unfallchirurgie
Landesklinikum Wiener Neustadt
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Endoskopische Operationstechniken sind wesentliche Stützen der minimal invasiven Chirurgie. Die endoskopische Bandscheibenchirurgie ist stark im Kommen. Dieser Artikel befasst sich mit der Anwendung von endoskopischen Techniken in der Wirbelsäulentraumatologie.
Keypoint
-
Die einzige bereits etablierte endoskopische Technik der videoassistierten thorakoskopischen thorakolumbalen Fusionstechnik findet immer weniger Anwendung in der Behandlung von thorakolumbalen Frakturen und wird von der Mini-open-Technik verdrängt.
Die minimal invasive Wirbelsäulenchirurgie ist eine schnell wachsende Domäne. Verglichen mit der konventionellen Technik – mit großen Zugängen und weitgehender Ablösung der Muskulatur – bietet sie deutliche Vorteile in der Behandlung von Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen.
Unterschiedliche Wirbelsäulenverletzungen wurden in den letzten Jahrzehnten mithilfe der konventionellen Technik behandelt. Obwohl diese bislang als Standard galt, war das funktionelle Ergebnis nicht immer optimal. Die Ursachen für die schlechten Ergebnisse lagen nicht selten im iatrogen verursachten Weichteiltrauma durch die exzessive Ablösung der Muskulatur und in der postoperativen Narbenbildung. Konventionelle Verfahren zur Stabilisierung, Versteifung und Dekompression der Brust- und Lendenwirbelsäule waren daher mit einer hohen zugangsbedingten Morbidität vergesellschaftet. So sind große anteriore transthorakale oder transdiaphragmale Zugänge häufig mit starken postoperativen Schmerzen, einer Dysfunktion des Schultergürtels oder einer komprimierten Atmung assoziiert. Der posteriore Zugang verursacht eine erhebliche Denervation und Ischämie der Muskulatur. Daraus resultieren eine paraspinale Muskelatrophie, Narbenbildung sowie der Kraft- und Funktionsverlust der Muskulatur mit nachfolgenden Schmerzen. Auch ist hinlänglich bekannt, dass polytraumatisierte Patienten und geriatrische Patienten stark anfällig sind für einen erhöhten intraoperativen Blutverlust und Infektionen, wie sie etwa bei großen Zugängen auftreten können.
Die Bemühungen um die Reduktion der zugangsbedingten Morbidität beim konventionellen Vorgehen führten letztlich zur Entwicklung der minimal invasiven Techniken in der Wirbelsäulenchirurgie. So sind Techniken der perkutanen Pedikelschraubeninstrumentation sowie der perkutanen Zementaugmentation aus der täglichen Routine nicht mehr wegzudenken. Allerdings begann der Siegeszug der minimal invasiven Wirbelsäulenchirurgie ursprünglich mit der Entwicklung einer endoskopischen Technik. Die videoassistierte thorakoskopische ventrale Fusion der thorakolumbalen Wirbelsäule war Ende der 1990er-Jahre der Vorreiter der minimal invasiven Techniken an der Wirbelsäule. Die endoskopische Technik ermöglichte die Erreichbarkeit der thorakolumbalen Regionen wie beim offenen Zugang und hatte gleichzeitig den Vorteil niedrigerer Raten an pulmonalen Komplikationen, Interkostalneuralgien und Schulterbeschwerden.
Für viele Jahre blieb dies die einzige endoskopische Technik im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie. In den letzten Jahren kam es zu weiteren Entwicklungen der Endoskopie im Bereich der Bandscheibenchirurgie. Die endoskopische Dekompressionstechnik ist im Moment sehr en vogue und wird zunehmend mehr angeboten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaß die endoskopischen Techniken in der Wirbelsäulentraumatologie angewendet werden können.
Videoassistierte thorakoskopische Technik
Wie schon erwähnt hat sich die videoassistierte thorakoskopische Technik zur Korpektomie und anterioren Fusion von Th4 bis L1 seit Jahren bewährt. Bei dieser Methode wird der Patient in Rechts- oder Linksseitenlage positioniert. Für den Zugang zu Th4 bis Th8 wird der rechtsseitige und für Th9 bis L1 (manchmal auch L2) der linksseitige Zugang verwendet. Je nach Zugang muss entweder die rechte oder linke Lunge kollabiert sein. Daher ist die Intubation mit einem Doppellumen-Tubus obligatorisch. Nach Lagerung des Patienten wird die Frakturhöhe unter Bildwandler bestimmt. Der Zugang erfolgt über ein etwas größeres Arbeitsportal (Hauptzugang) sowie drei kleinere Zugänge für die Optik, den Spülsauger und den Retraktor. Nach erfolgter Minithorakotomie wird der Doppellumen-Tubus blockiert und die Lunge wird auf der zu operierenden Seite kollabiert.
Die Minithorakotomie wird als Arbeitsportal benützt. Die weiteren Portale werden unter endoskopischer Sicht gesetzt. Die Optik beleuchtet und visualisiert über ein eigens dafür vorgesehenes Portal, welches sich kranial vom Arbeitsportal befindet, das Operationsfeld auf einem Monitor. Über ein weiteres Portal wird der Retraktor eingebracht, um das Zwerchfell bzw. die Lunge von der Wirbelsäule wegzuhalten. Das vierte Portal ermöglicht den Einsatz eines Spülsaugers. Die Korporektomie findet über das Arbeitsportal statt (Abb. 1). Die hier in aller Kürze beschriebene thorakoskopische Technik hat jedoch Limitationen, wie die extrem flache Lernkurve und die lange Operationszeit.
Abb. 1: a) Thorakoskopische ventrale Fusion; Blicke des Operateurs und der Assistenten auf den Monitor gerichtet, b) thorakoskopische Sicht auf dem Monitor
Diese Einschränkungen der thorakoskopischen Fusionsstechnik und der weiterhin bestehende Wunsch nach Minimierung der Zugangsmorbidität führten in den letzten Jahren zur Entwicklung von neuen tubulären Retraktoren, die an vielen Abteilungen inklusive der eigenen Abteilung zu einem Schwenk von der thorakoskopischen Fusionstechnik hin zur sogenannten Mini-open-Technik geführt haben.
Mini-open-Technik
Abb. 2: Mini-open-Zugang mit einem einzigen Schnitt und Retraktor; direkter Blick auf das Operationsfeld von oben
Bei der Mini-open-Technik wird im Gegensatz zur thorakoskopischen Technik ein einziger kleiner Zugang anstatt insgesamt 4 Zugängen verwendet. Hier wird nach Durchführung einer Minithorakotomie in der Länge von ca. 3–4cm ein Kirschner-Draht in den gebrochenen Wirbelkörper eingebracht. Die Lage des Kirschner-Drahtes wird unter Bildwandlersicht gewählt. Über diesen Draht werden nun die tubulären Retraktoren eingeführt und vorsichtig expandiert. Zusätzlich werden Kaltlichtquellen an den Retraktoren angebracht, die das Operationsfeld optimal ausleuchten. Somit ist eine optimale direkte Visualisierung von oben auf das Operationsfeld gegeben, ohne die Notwendigkeit einer Kamera und eines Monitors. Die direkte Sicht auf das Operationsfeld erleichtert deutlich die visuelle Verarbeitung und beschleunigt die Operationsschritte. Darüber hinaus ist ein ständiges Reinigen der angelaufenen Optik bei der Mini-open-Technik nicht notwendig, was wiederum zu einer Erleichterung der Abläufe führt. Studien, die beide Methoden miteinander vergleichen, fehlen allerdings bis dato.
Endoskopische Dekompression
Eine weitere bereits erwähnte endoskopische Technik ist die Dekompressionstechnik, die aus der degenerativen Wirbelsäulenchirurgie und hier hauptsächlich aus der Bandscheibenchirurgie stammt. Die Anwendung der endoskopischen Diskektomie und Foraminotomie über mehrere Millimeter große Schnitte, Optik und Fräse ist im Anmarsch und gehört zunehmend zum Repertoire vieler Wirbelsäulenchirurgen. Aus traumatologischer Sicht steckt jedoch diese Technik noch in den Anfangsstadien und wird nach ausgiebiger Literaturrecherche nur in einer einzigen Studie gefunden: Yang H et al. beschreiben die endoskopische Flavektomie in Kombination mit einer Laminektomie oder Hemilaminektomie nach einer perkutanen dorsalen Stabilisierung bei thorakolumbalen Frakturen. Die Autoren berichten über den Einsatz der Endoskopie zur Dekompression bei 32 Patienten mit A3-, A4- und B2-Frakturen nach erfolgter perkutaner Stabilisierung der Fraktur. Dabei wurde über eine Nadel unter Bildwandlerkontrolle ein Endoskop eingeführt. Die Endoskopie erfolgt unter Einführung von Wasser (150ccm H2O) und der Verwendung von endoskopischen Fräsen und Stanzen. Anteile von Ligamentum flavum und Knochenfragmente konnten so endoskopisch minimal invasiv entfernt werden. Die Autoren beschreiben diese Methode als eine sichere Alternative zur herkömmlichen offenen Dekompression.
Ein weitere Publikation berichtet über eine weitaus exotischere Methode der endoskopischen Wirbelsäulenbehandlung: Vit K et al. schreiben in einem Case-Report über die Versorgung von Anderson-II-Densfrakturen bei 4 Patienten. Die ventrale Densverschraubung wurde endoskopisch assistiert durchgeführt. Die Vorteile dieser Versorgung werden mit besserer Visualisierung des Eintrittspunktes für die Schrauben begründet.
Fazit
Berichte und Studien über weitere Anwendungen der endoskopischen Technik in der Versorgung von Wirbelkörperfrakturen konnten nicht gefunden werden. Letztendlich scheint der Siegeszug der endoskopischen Dekompressionstechnik in der spinalen Traumatologie derzeit auf sich warten zu lassen. Die einzige bereits etablierte endoskopische Technik der videoassistierten thorakoskopischen thorakolumbalen Fusionstechnik findet zunehmend weniger Anwendung in der Behandlung von thorakolumbalen Frakturen und wird von der Mini-open-Technik verdrängt.
Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass die Endoskopie in der Versorgung von Wirbelkörperfrakturen zum aktuellen Zeitpunkt einen geringen Stellenwert hat. Ob sie in der Zukunft das Wirbelsäulentrauma beeinflussen wird, bleibt vorerst abzuwarten.
Literatur:
beim Verfasser
Das könnte Sie auch interessieren:
Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?
Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...
Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus
Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...
Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III
Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...