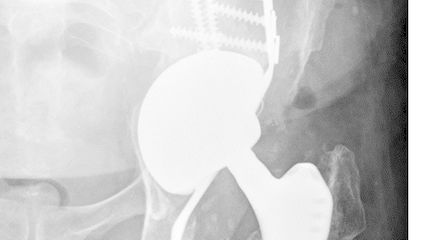<p class="article-intro">Um eine gute klinische Funktion nach einer proximalen Humerusfraktur, versorgt mit einer inversen Schulterprothese, zu erreichen, ist die suffiziente Refixation der Tubercula mit einer konsekutiven Einheilung entscheidend. Ziel dieser Arbeit war es, die Festigkeit der mittels nicht resorbierbarer Fäden oder Titan/Aluminium-Kabeln in einer Cerclage-ähnlichen Technik refixierten Tubercula anhand eines biomechanischen Test-Set-ups zu evaluieren.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Mit Kabel-Cerclagen refixierte Tubercula tendierten zu einer geringen Rotation und wiesen eine höhere Stabilität auf als mit Faden-Cerclagen refixierte Tubercula.</li> <li>Im Vergleich zu Faden-Cerclagen könnten Kabel-Cerclagen zu einer verbesserten knöchernen Einheilung der Tubercula führen.</li> <li>Die Entstehung von Hohlräumen zwischen den Tubercula und der Epiphyse/des Schaftes der Prothese sollte vermieden werden, da es zu einer Schwächung der Fixationsfestigkeit der Tubercula kommen könnte.</li> </ul> </div> <p>Proximale Humerusfrakturen betragen in etwa 5 % aller Frakturen und zählen zu den dritthäufigsten osteoporotisch bedingten Frakturen.<sup>1</sup> Zur operativen Behandlung komplexer und nicht rekonstruierbarer proximaler Humerusfrakturen wurde lange Zeit auch beim älteren Patienten die Fraktur-Hemiprothese verwendet. Aufgrund der hohen Versagensrate in Bezug auf die Tubercula-Einheilung und des damit einhergehenden schlechten klinischen Ergebnisses bei der Fraktur-Hemiprothese gewann die inverse Schulterprothese auch in der Frakturversorgung vor allem beim älteren Patienten mehr und mehr an Bedeutung.<sup>2, 3</sup><br /> Rezente Arbeiten konnten bereits ein besseres klinisches/funktionelles Ergebnis der inversen Schulterprothese verglichen zur Fraktur-Hemiprothese mit einer höheren Einheilungsrate der Tubercula vorweisen.<sup>4–6</sup> Trotz alledem wurde eine Fehlverheilung bzw. Nichteinheilung der Tubercula im Rahmen der inversen Schulterendoprothetik zur Behandlung proximaler Humerusfrakturen in bis zu 50 % der Fälle beobachtet.<sup>7, 8</sup> Neben der insuffizienten Refixation könnten bezüglich des Versagens der knöchernen Einheilung auch eine kompromittierte Blutversorgung oder eine Überreposition der Tubercula eine Rolle spielen.</p> <p>Diverse Techniken für die Refixation der Tubercula, welche bei der inversen Schulterprothese Anwendung finden, sind meist auf die Fraktur-Hemiprothese zurückzuführen und sind auf ihre biomechanischen Eigenschaften in Bezug auf die inverse Frakturendoprothetik bislang nicht untersucht.<sup>9</sup></p> <h2>Methodik</h2> <p>Es wurden 8 humane Humeruspaare von 5 Frauen und 3 Männern mit einem mittleren Alter von 71 ± 7 Jahren in die Studie eingeschlossen. Zu Lebzeiten war von allen Spendern ein schriftlicher Konsens zur wissenschaftlichen Verwendung ihrer Körper nach dem Tod erteilt worden.<sup>10</sup> Vor der Präparation und Testung der Humeri wurde eine CT-Untersuchung zum Ausschluss von pathologischen Veränderungen sowie zur Messung der Knochendichte mittels EFP-Modell durchgeführt.<sup>11</sup> Die Zuteilung der einzelnen Humeri eines Paares in die Faden- oder Kabel-Gruppe erfolgte per Zufall.</p> <p><strong>Präparation und Prothesenimplantation</strong><br />Mit einer oszillierenden Säge wurde in Anlehnung an die Frakturbeschreibung von Hertel eine standardisierte 4-Teile- Oberarmkopffraktur an allen Humeri kreiert.<sup>12</sup> Die Frakturlinien wurden zwischen dem Tuberculum minus und dem Tuberculum majus lateral des Sulcus intertubercularis gesetzt, wobei das Tuberculum majus v-förmig osteotomiert wurde. Die Supraspinatussehne wurde abgelöst und reseziert; die Infraspinatus- und die Subscapularissehne wurden mittels Mason-Allen-Nähten und zusätzlicher transossärer Fixierung angeschlungen. Um den Anpressdruck des M. deltoideus zu simulieren, wurde im Ansatzbereich des Muskels (Tuberositas deltoidea) ein Faden transossär fixiert, an welchen eine passive Muskelkraft von 10N angebracht wurde.<br />Eine Monoblockkomponente der Delta- Xtend-Prothese (DePuy Synthes) wurde entsprechend der Operationsanleitung des Herstellers implantiert und zementiert. In weiterer Folge wurden die Tubercula reponiert und entweder mit zwei Ethibondexcel- 6-Fäden (Ethicon Inc.) oder zwei 1mm-Titan/Aluminium-Kabeln (DePuy Synthes) in einer Cerclage-ähnlichen Technik um die Epiphyse/den Schaft der Prothese refixiert. Die Fäden bzw. Kabel wurden jeweils am Übergang des Sehnenansatzes der Subscapularis- und Infraspinatussehne an den Tubercula transossär vorgelegt. Die Fäden wurden gedoppelt und mittels „nice knot“ geknotet.<sup>13</sup> Die Kabel wurden mit dem entsprechenden Spanngerät gespannt und jeweils mittels einer Öse verblockt.</p> <p><strong>Test-Set-up</strong><br /> In 30° abduzierter Position wurden die in PMMA eingebetteten Humeri in den Testaufbau der Material-Prüfmaschine (MTS) eingespannt. Durch ein Kugellager wurden Rotations- und Translationsbewegungen mit einer maximalen Rotation von 7,5° je Seite ermöglicht. Die Glenosphäre wurde am Testaufbau fixiert, um eine Rotations-/Gleitbewegung zu ermöglichen. Die Infraspinatus- und Subscapularissehnen wurden mit den vorgelegten Fäden mit dem Aktuator der MTS, welcher über dem Rotationszentrum der Prothese platziert wurde, verbunden und mit 10N vorgespannt (Abb. 1).<br /> Ein zyklisches Lastprotokoll beginnend mit 1Nm und einer schrittweisen Steigerung um 0,25Nm nach jedem 100. Zyklus wurde angewendet.<br /> Die Rotationsmessung der Tubercula erfolgte mit einem 3D-Ultraschall-basierten Bewegungsanalysesystem anhand einer x-, y- und z-Achse. Dabei spiegelte die z-Achse die Rotation der Tubercula um die Humerusschaftachse wider, die x-Achse eine Kranialisierung der Tubercula und die y-Achse eine Öffnung des intertuberkularen Frakturspaltes. Das Versagen der Refixation wurde ab einer Rotation der Tubercula von >15° festgelegt.</p> <h2>Resultate</h2> <p>Insgesamt wurden 7 Paare für die statistische Auswertung herangezogen, da ein getestetes Humeruspaar in beiden Fixationsgruppen aufgrund der schlechten Knochenqualität bereits nach 100 Zyklen versagte. Im Allgemeinen lag die mittlere gemessene Knochendichte in der Faden- Gruppe bei 110 ± 15mg/cm<sup>3</sup> und in der Kabel-Gruppe bei 115 ± 15mg/cm<sup>3</sup>. Die Kabel-Gruppe erreichte 1414 ± 372 Zyklen und die Faden-Gruppe 1257 ± 230 Zyklen bis zum Versagenskriterium (p=0,313). Alle Präparate erreichten 900 Zyklen, bevor die ersten Versager beobachtet wurden. Die Hauptbewegung wurde um die Humerusschaftachse (z-Achse) detektiert. Die Rotation des Tuberculum minus um die z-Achse war in der Kabelgruppe nach 200, 400 und 600 Zyklen signifikant niedriger, verglichen mit der Fadengruppe (p=0,018–0,043). Bezogen auf das Tuberculum majus zeigte sich an der z-Achse kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Nach 900 Zyklen wies die Kabel-Gruppe signifikant weniger Rotation beider Tubercula an der x- und y-Achse auf (p=0,028) (Abb. 2–4).</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Eine adäquate Refixation der Tubercula im Rahmen der Schulterendoprothetik bei komplexen proximalen Humerusfrakturen führt zu einer besseren knöchernen Einheilung, gefolgt von einer verbesserten klinischen Schulterfunktion.<sup>7, 8, 14–16</sup><br /> In dieser biomechanischen Studie konnte eine niedrigere Rotation der Tubercula in der Kabel-Gruppe verglichen mit der Faden-Gruppe an allen 3 gemessenen Achsen beobachtet werden. Es lässt sich daher die Tendenz zu einer höheren Stabilität der mit Titan/Aluminium-Kabeln refixierten Tubercula ableiten.<br /> Von klinischer Seite betrachtet erwies sich die auf die frakturierten Tubercula einwirkende Kraft als gering und nicht vergleichbar mit an intakten Humeri applizierten Kräften aus In-vivo-Untersuchungen.<sup>17</sup> Ziel dieser biomechanischen Testung war es jedoch, Kräfte, welche während der initialen postoperativen passiven Mobilisierung entstehen, anzuwenden. Hierfür wurde eine dynamische Testung mit einem zyklischen Lastprotokoll und einer schrittweisen Lasterhöhung erarbeitet und angewendet, um ein Versagen der refixierten Tubercula zu provozieren.<br /> Der Fokus der in dieser Studie verwendeten Cerclage-ähnlichen Refixationstechnik der Tubercula für beide Gruppen lag auf einer praktikablen Handhabung bei ausreichender Fixationsfestigkeit. Die Technik lehnt sich an die bereits von Hertel beschriebene Technik mit Titan/Aluminium- Kabeln bei der anatomischen Frakturprothese an, welche in einer klinischen Studie deutlich bessere Ergebnisse in Bezug auf die Einheilung der Tubercula sowie die daraus resultierende Schulterfunktion gegenüber einer Fadenrefixation nach Rockwood aufzeigte.<sup>18</sup><br /> Auf eine Einbindung der Finnen der Prothese wurde in dieser Arbeit verzichtet, da es nach unserer klinischen Erfahrung zu einer Fehlreposition der Tubercula kommen könnte. Eine biomechanische Untersuchung, bezogen auf eine anatomische versus nicht anatomische Reposition der Tubercula an eine anteriore oder laterale Finne der Prothese, zeigte einen 8-fach erhöhten Wiederstand bei der Außenrotation in der nicht anatomischen Gruppe.<sup>19</sup> Daten über einen biomechanischen Vorteil bei der Verwendung der Finnen zur Refixation der Tubercula existieren derzeit nicht.<br /> Unabhängig von der Verwendung von Kabeln oder Fäden kam es vor allem im hohen Lastbereich zu einer Lockerung der refixierten Tubercula während der zyklischen Testung. Eine mögliche Ursache könnte die Entstehung eines Hohlraums zwischen den refixierten Tubercula und der Epiphyse/des Schaftes der Prothese gewesen sein. Um dies zu vermeiden, kann eine nicht anatomische Reposition der Tubercula durchgeführt werden, welche jedoch aufgrund der veränderten Muskelfunktion der Rotatorenmanschette und einer potenziell resultierenden Bewegungseinschränkung vermieden werden sollte.<sup>19, 20</sup><br /> Eine andere Alternative stellt die Unterfütterung mit autologem Knochen dar. Klinische Arbeiten konnten bereits eine verbesserte Einheilung der Tubercula und damit verbunden eine bessere klinische Funktion unter der Anwendung einer autologen Knochenunterfütterung der refixierten Tubercula aufweisen.<sup>21, 22</sup> Die kleine Fallzahl der Studie stellt eine Limitation dar. Auch stellt das einheitlich kreierte 4-Teile-Oberarmkopffrakturmodell in Hinblick auf die große Variationsbreite und die Individualität proximaler Humerusfrakturen, welche im klinischen Alltag auftreten, eine weitere Limitation dieser biomechanischen Arbeit dar. Es sollte jedoch bedacht werden, dass alle Testungen und Präparationen unter kontrollierten und standardisierten Laborbedingungen durchgeführt wurden und daher diverse Einflussfaktoren, welche in klinischen Studien vorkommen können, ausgeschlossen waren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1806_Weblinks_jatros_ortho_1806_s25_abb1+2-4.jpg" alt="" width="2150" height="2763" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Khatib O et al.: J Shoulder Elbow Surg 2014; 23: 1356-62 <strong>2</strong> Boileau P et al.: J Shoulder Elbow Surg 2002; 11: 401-12 <strong>3</strong> Kralinger F et al.: J Bone Joint Surg Br 2004; 86: 217-9 <strong>4</strong> Ferrel J et al.: J Orthop Trauma 2015; 29: 60-8 <strong>5</strong> Mata- Fink A et al.: J Shoulder Elbow Surg 2013; 22: 1737-48 <strong>6</strong> Sebastia-Forcada E et al.: J Shoulder Elbow Surg 2014; 23: 1419-26 <strong>7</strong> Bufquin T et al.: J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 516-20 <strong>8</strong> Ross M et al.: J Shoulder Elbow Surg 2015; 24: 215-22 <strong>9</strong> Baumgartner D et al.: J Orthop Surg Res 2011; 6: 6-36 <strong>10</strong> Riederer B et al.: Eur J Anat 2012; 16: 1-21 <strong>11</strong> Krappinger D et al.: Skeletal Radiol 2012; 41: 299-304 <strong>12</strong> Hertel R: Osteoporos Int 2005; 16: 30 <strong>13</strong> Boileau P et al.: Orthopedics 2016; 8: 1-5 <strong>14</strong> Gallinet D et al.: J Shoulder Elbow Surg 2013; 22: 38-44 <strong>15</strong> Grubhofer F et al.: J Shoulder Elbow Surg 2016; 25: 1690-8 <strong>16</strong> Jorge-Mora A et al.: J Shoulder Elbow Surg 2018. doi: 10.1016/j. jse.2018.05.036 <strong>17</strong> Westerhoff P et al.: J Biomech 2009; 42: 1840-9 <strong>18</strong> Krause FG et al.: J Orthop Trauma 2007; 21: 682-6 <strong>19</strong> Frankle MA et al.: J Shoulder Elbow Surg 2001; 10: 321-6 <strong>20</strong> Ackland DC et al.: J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 1221-30 <strong>21</strong> Levy C, Badman B: J Orthop Trauma 2011; 25: 318-24 <strong>22</strong> Uzer G et al.: J Shoulder Elbow Surg 2017; 26: 36-41</p>
</div>
</p>