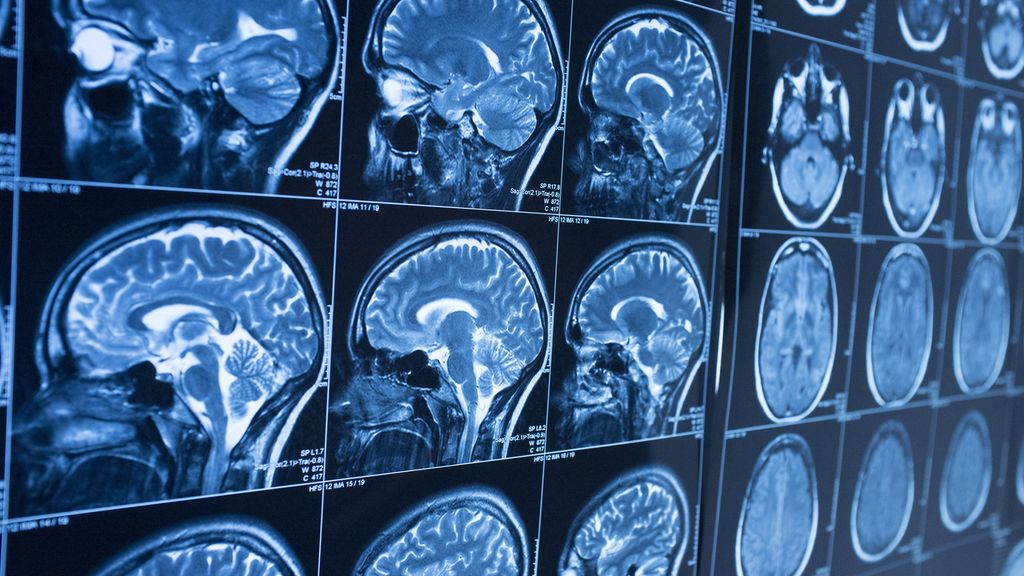
©
Getty Images/iStockphoto
Zielgerichtete Therapie mit Anti-CGRP-Antikörpern
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
19.10.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Für Patienten mit chronischer Migräne könnten Antikörper gegen CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) möglicherweise bald eine neue wirksame und gut verträgliche Form der Prophylaxe darstellen. Auf der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) wurden die Charakteristika der neuen Wirkstoffe diskutiert. Insbesondere die hohe und schnelle Wirksamkeit sowie die gute Verträglichkeit auf Placeboniveau wecken grosse Hoffnungen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>CGRP ist ein bekanntes Target bei der Migränebehandlung. Small Molecules wie die oralen CGRP-Rezeptor-Antagonisten erwiesen sich in Studien als hochwirksam bei der Behandlung akuter Migräneattacken. Allerdings musste die weitere Entwicklung von oralen CGRP-Antagonisten aufgrund von hepatotoxischen Nebenwirkungen eingestellt werden. Ein neuer Ansatz war die Entwicklung monoklonaler Antikörper gegen CGRP zur Prophylaxe von Migräneattacken mittels einer andauernden Blockade von CGRP bzw. seines Rezeptors.<br /> Die Antikörper beeinflussen über die CGRP-Hemmung zentral sowie in der Peripherie an drei Pathomechanismen der Migräne: Vasodilatation, neurogene Inflammation und Schmerztransmission.<sup>1</sup></p> <h2>Vier Kandidaten in klinischen Studien</h2> <p>Derzeit werden vier verschiedene monoklonale Antikörper, drei humanisierte Antikörper gegen CGRP (Eptinezumab, Fremanezumab, Galcanezumab) und ein vollhumaner Antikörper gegen den CGRPRezeptor (Erenumab) in Phase-II-/-III-Studien zur Prophylaxe der chronischen Migräne untersucht. Erenumab 70 bzw. 140mg werden einmal monatlich subkutan appliziert. Eptinezumab (ALD403) wird im Abstand von drei Monaten infundiert. Untersucht werden die Dosierungen 10, 30, 100, 300mg. Galcanezumab (LY2951742) wird einmal im Monat subkutan injiziert. Fremanezumab (TEV-48125) wird in zwei Dosierungen (Loading-Dosis 675mg, danach 225mg bzw. 900mg) einmal monatlich subkutan appliziert. Positiv auf die Adhärenz wirkt sich der schnelle Wirkeintritt nach 1–4 Wochen aus.<br /> Der Fortschritt wird besonders beim Vergleich der Sicherheit und Verträglichkeit der Anti-CGRP-Antikörper deutlich. Beide Parameter liegen auf Placeboniveau. Dies gilt umso mehr, als die neue Substanzklasse aufgrund des nebenwirkungsbedingten Scheiterns der oralen CGRP-Rezeptor-Antagonisten hier besonders unter Beobachtung steht, hob Dr. Peter Goadsby, UCSF Medical Center, bei der Präsentation der Phase-III-Studie STRIVE hervor. Erenumab führte nach sechs Monaten zu einer signifikanten Reduktion der monatlichen Migränetage (primärer Endpunkt: 70mg: –3,2 Tage; 140mg: –3,7 Tage) vs. Placebo (–1,8 Tage). Neben den klassischen Migräne-Endpunkten erleichterte Erenumab auch die Alltagsaktivitäten.<sup>2</sup> Goadsby wies darauf hin, dass in der Migränetherapie die Messung des Funktionsstatus als patientenbezogener Outcome-Parameter immer wichtiger wird.</p> <h2>Zukunft und offene Fragen</h2> <p>Zu den offenen Fragen zum Einsatz von Anti-CGRP-Antikörpern gehört die Präzisierung des Wirkmechanismus, also der Beteiligung von CGRP an der Pathogenese der Migräne sowie – insbesondere unter Sicherheitsaspekten – auch in anderen Körperregionen ausserhalb des Gehirns, beispielsweise bei kardialen bzw. fokalen zerebralen Ischämien und Vasospasmen. Und ist die Blockade des Liganden oder des Rezeptors effektiver bzw. sicherer? Klinisch von Bedeutung wären auch die Identifikation von «Superrespondern » sowie die Entwicklung von Antikörpern. Darüber hinaus liegen für alle Anti-CGRP-Antikörper noch keine Langzeitstudien vor.<br /> Möglicherweise können die neuen Wirkstoffe auch breiter eingesetzt werden. Sie werden inzwischen in klinischen Studien auch in anderen Kopfschmerz- Indikationen wie episodischer Migräne (Erenumab, Galcanezumab), dem Clusterkopfschmerz (Galcanezumab), posttraumatischen Kopfschmerzen sowie Kopfschmerzen bei Medikamenten-Abusus untersucht.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 69. Jahrestagung der American Academy of Neurology
(AAN), vom 22. bis 28. April 2017, Boston
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Starling A: AAN 2017, Contemporary Clinical Issues<br /><strong>2</strong> Goadsby P et al: AAN 2017, Clinical Trials Plenary Session</p>
</div>
</p>