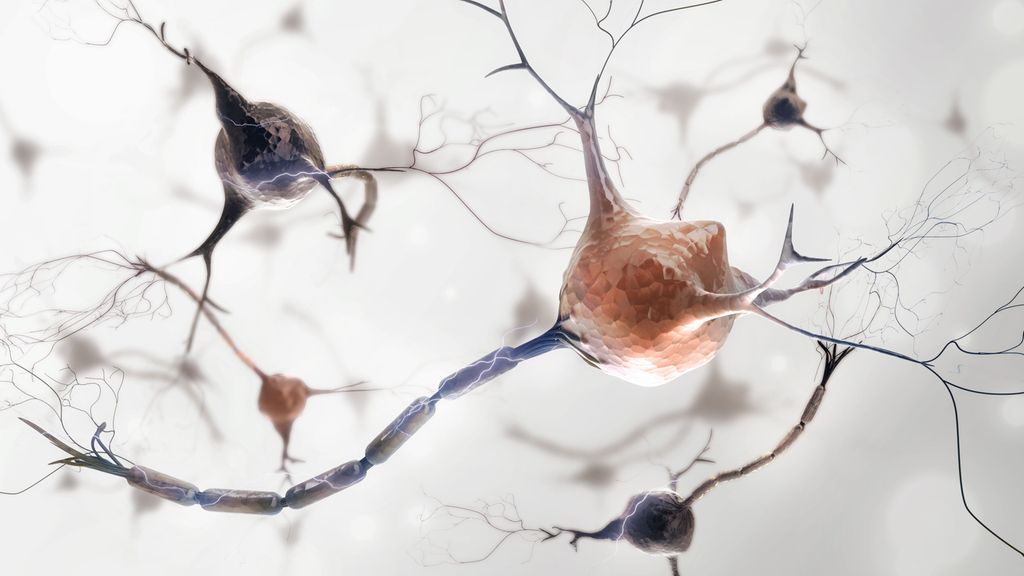
©
Getty Images/iStockphoto
Komplexes regionales Schmerzsyndrom
Jatros
Autor:
OÄ Dr. Michaela Mödlin
Institut für Physikalische Medizin und<br> Rehabilitation, Wilhelminenspital, Wien<br> E-Mail: michaela.moedlin@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
22.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Eine Fraktur, eine Operation oder ein anderes Trauma – und trotz Heilung von Knochen und Weichteilen bleiben Schmerzen, Schwellung und Bewegungseinschränkungen bestehen. Dahinter könnte sich ein komplexes regionales Schmerzsyndrom verbergen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Das komplexe regionale Schmerzsyndrom („complex regional pain syndrome“, CRPS) ist eine schmerzhafte Komplikation einer Fraktur, Operation oder anderen Verletzung einer Extremität. In seltenen Fällen ist kein vorangegangenes Trauma eruierbar. Vielen besser als M. Sudeck, Reflexdystrophie, Algodystrophie oder Kausalgie bekannt, tritt es mit variabler zeitlicher Latenz nach dem auslösenden Ereignis auf. Bei gleichzeitigem Vorliegen einer nachweisbaren Nervenläsion spricht man von einem CRPS II, in allen anderen Fällen von einem CRPS I. Werden nicht alle diagnostischen Kriterien erfüllt, kann von einem CRPS-NOS („not otherwise specified“) gesprochen werden.</p> <h2>Symptomatik</h2> <p>Leitsymptom des CRPS ist üblicherweise ein ausgeprägter Ruhe- und Nachtschmerz, der durch Belastung verstärkt wird und durch das auslösende Trauma nicht mehr erklärbar ist.<br /> Dieser Schmerz wird vom Patienten meist als Brennen, Stechen oder Ziehen im Sinne eines neuropathischen Schmerzes beschrieben. Die weiteren Symptome lassen sich für diagnostische Zwecke in vier Gruppen zusammenfassen:</p> <ol> <li>Sensorische Symptome: Hyperästhesie, Hyperalgesie und Allodynie, die nicht auf bestimmte Nervenversorgungsgebiete beschränkt sind.</li> <li>Vasomotorische Symptome: Eine Störung der Vasomotorik bewirkt eine Verfärbung der Haut (anfangs Rötung, später livide Verfärbung) und eine Veränderung der Hauttemperatur (anfangs meist Hyperthermie, später Hypothermie). Im Gegensatz zu diesem primär „warmen CRPS“ gibt es auch ein primär „kaltes CRPS“, bei dem sich von Anfang an Hypothermie und livide Verfärbung zeigen.</li> <li>Sudomotorische Symptome: Dazu zählen das oft ausgeprägte Ödem sowie häufig eine Hyperhidrose im Bereich der betroffenen Hand oder des betroffenen Fußes (Abb. 1).</li> <li>Motorische und trophische Symptome: Die motorischen Symptome sind, neben einer Bewegungseinschränkung und Schwäche in der betroffenen Extremität, Tremor, Dystonien und manchmal auch Spasmen. Die Störung der Trophik kann Glanzhaut, Hypertrichose, eine Störung des Nagelwachstums und eine Demineralisierung des Knochens bewirken (Abb. 2).</li> </ol> <p>Charakteristisch ist, dass sich die angeführten Symptome – wie auch der Schmerz – nicht durch die vorangegangene Verletzung oder Operation erklären lassen.<br /><br /> Bei zunehmender Dauer der Erkrankung können neglectartige Körperwahrnehmungsstörungen auftreten. Bei chronischen Verläufen, die bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung selten sind, kommt es zu zunehmenden Gelenkskontrakturen, trophischen Störungen und Atrophien, was zu ausgeprägten Behinderungen und Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen kann (Abb. 3).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb1.jpg" alt="" width="685" height="946" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb2.jpg" alt="" width="685" height="571" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb3.jpg" alt="" width="685" height="946" /></p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Die Diagnostik erfolgt im internationalen Konsens ausschließlich klinisch nach den sogenannten Budapest-Kriterien der International Association for the Study of Pain (IASP) von 2005 (Tab. 1). In einer multizentrischen Validierungsstudie wurden dafür die Sensitivität mit 0,99 und die Spezifität mit 0,68 angegeben.<br /> Die Symptome dürfen nicht durch eine andere Pathologie erklärbar sein. Schwierig kann die Abgrenzung von „normalen“ posttraumatischen oder postoperativen Beschwerden zu einem CRPS sein. Für ein CRPS sprechen Schmerzen mit neuropathischer Komponente sowie die Generalisierung der Symptome in der betroffenen Extremität. Auch die Differenzierung zwischen einem CRPS und dem „Non-use“ einer Extremität kann problematisch sein.<br /> Es gibt kein apparatives Untersuchungsverfahren, das ein CRPS beweist. Verschiedene Methoden können aber die Diagnose erhärten und die Abgrenzung zu den unterschiedlichen Differenzialdiagnosen erleichtern:</p> <ul> <li>Im konventionellen Röntgen lassen sich in ca. 50 % der Fälle nach 4–8 Wochen kleinfleckige osteoporotische Veränderungen in Gelenksnähe erkennen (Abb. 4).</li> <li>Eine MR-Untersuchung stellt zusätzlich das Ödem dar und kann für den Ausschluss von Differenzialdiagnosen sinnvoll sein.</li> <li>In der 3-Phasen-Szintigrafie können sich am Anfang der Erkrankung gelenksnahe Anreicherungen in den Aufnahmen der Knochenphase zeigen. Allerdings sind nur Areale bewertbar, die nicht z.B. unfallbedingt mehr Tracer anreichern.</li> <li>Bei der Thermografie mehrmals gemessene, diffuse, einen größeren Extremitätenabschnitt betreffende Temperaturunterschiede =1°C unterstützen die Diagnose.</li> <li>Ein „quantitative sensory testing“ kann die sensorischen Störungen genauer beschreiben.</li> <li>Beim CRPS II können NLG- und EMGUntersuchung die Nervenläsion genauer eingrenzen.</li> </ul> <p>Differenzialdiagnostisch muss eine Reihe von Erkrankungen in Betracht gezogen werden: lokale Infekte oder Entzündungen (Tendovaginitis, reaktive Arthritis, Osteomyelitis, Gichtarthritis), Knochenmarködem anderer Genese, Thromboembolie, Kompartmentsyndrom, Nervenkompressionssyndrome, Polyneuropathien, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Tumoren, aseptische Knochennekrose, Stressfrakturen sowie psychiatrische Erkrankungen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="860" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb4.jpg" alt="" width="685" height="1412" /></p> <h2>Pathogenese</h2> <p>Die Ursachen für ein CRPS sind nach wie vor nicht restlos geklärt. Diskutiert werden zurzeit die folgenden – peripheren und zentralen – Prozesse:<br /><br /> Bei jedem Trauma kommt es zur Freisetzung von Zytokinen. Bei Patienten mit CRPS werden proinflammatorische Zytokine wie Tumornekrosefaktor(TNF)-a sowie Interleukin(IL)-2 und IL-8 jedoch vermehrt produziert. Zusätzlich besteht bei diesen Patienten ein deutliches Defizit an antiinflammatorischen Zytokinen wie „transforming growth factor“ (TGF), IL-4 und IL-10. Die Folge dieser Imbalance ist eine starke Sensibilisierung von Nozizeptoren, die daraufhin Neuropeptide wie Substanz P (SP) und „calcitonin gene-related peptide“ (CGRP) ins Gewebe freisetzen. Diese verursachen Vasodilatation und Hyperämie, Erythem, Hyperthermie, Plasmaextravasation und Ödem. Dieser Prozess wird als neurogene Entzündung bezeichnet.<br /><br /> Auf der Ebene des Zentralnervensystems kommt es zu neuroplastischen Prozessen, die zu Veränderungen in somatosensorischen und motorischen Netzwerken, einer Körperwahrnehmungsstörung sowie einer veränderten zentralen Schmerzverarbeitung führen. Diese neuroplastischen Veränderungen, aber auch zentrale Perfusionsveränderungen lassen sich mit verschiedenen funktionellen bildgebenden Verfahren und Mapping-Techniken nachweisen. Dabei korrelieren Größe und Ausmaß der Veränderungen mit der Schwere der motorischen und sensorischen Störungen und der Intensität der Schmerzen und sind bei erfolgreicher Therapie reversibel.<br /><br /> Eine Beteiligung des vegetativen Nervensystems zeigt sich in den häufig auftretenden autonomen Störungen. Beim warmen CRPS dürfte dabei eine verminderte Vasokonstriktion bei Stimulation des sympathischen Nervensystems durch eine Inhibition von kutanen Vasokonstriktorneuronen eine Rolle spielen. Beim kalten CRPS scheinen eine Überreagibilität auf Katecholamine und eine Überexpression von a-Adrenorezeptoren vorzuliegen. Eine sympathisch-afferente Koppelung und damit der sympathisch mediierte Schmerz könnten dadurch bedingt sein, dass Nozizeptoren Noradrenalinrezeptoren exprimieren. Das würde die Schmerzzunahme bei manchen Patienten bei Aktivierung des sympathischen Nervensystems erklären.<br /><br /> Weiters gibt es Hinweise auf eine Beteiligung immunologischer und genetischer Prozesse, die zurzeit Gegenstand intensiver Forschung sind. Und schließlich werden immer wieder auch psychische Faktoren in der Pathogenese des CRPS vermutet. Möglicherweise dürfte Angst, insbesondere wenn sie präoperativ auftritt, eine Rolle in der Entwicklung eines CRPS spielen. Depressionen als Komorbidität treten ähnlich oft auf wie bei Patienten mit chronischen Schmerzen.<br /><br /> Mögliche Risikofaktoren sind die Postmenopause, eine Migräneanamnese, Osteoporose, Asthma bronchiale und die Einnahme von ACE-Hemmern. Als Prädiktoren für die Entwicklung eines CRPS konnten lokale Schmerzen im Gips oder anderen Fixationsverbänden identifiziert werden. Ebenso als Warnsignal zeigt sich in einer Studie ein erhöhter Schmerzlevel (>5/10) in den ersten 2 Wochen nach dem Trauma.</p> <h2>Epidemiologie</h2> <p>Die Inzidenz des CRPS liegt je nach Autor zwischen 5 und 26/100 000 pro Jahr. Frauen sind doppelt bis dreimal so oft betroffen wie Männer. Die Häufigkeit ist in der 4. bis 6. Lebensdekade etwas höher, aber auch Kinder und alte Menschen sind betroffen.<br /> Viele Arbeiten beschreiben ein bis zu zweimal häufigeres Vorkommen an den oberen Extremitäten. In unserer Ambulanz ist das Verhältnis von oberen zu unteren Extremitäten 1:1.<br /> Mit ca. 45 % ist eine Fraktur, insbesondere eine Radiusfraktur, der häufigste Auslöser.</p> <h2>Prognose</h2> <p>Mit der in den letzten Jahren zunehmend besseren Wahrnehmung des Krankheitsbildes und dadurch früheren adäquaten Therapie hat sich die Prognose deutlich verbessert. Fallweise kommt es aber trotzdem zu chronischen Verläufen mit funktionellen Beeinträchtigungen, die sich erheblich auf Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit auswirken. In der Literatur gibt es bisher nur wenig valide Daten. Es finden sich Hinweise, dass ein kaltes CRPS mit Dysästhesien eher zur Chronifizierung neigt als ein warmes CRPS.</p> <h2>Therapie</h2> <p>In den verschiedenen Guidelines werden die unterschiedlichsten Therapien gut evaluiert.<br /> Alle empfehlen übereinstimmend, dass die Therapie des CRPS so früh wie möglich begonnen und symptomorientiert, multimodal und interdisziplinär durchgeführt werden muss.<br /> Erster Schritt ist die genaue Aufklärung des Patienten über seine Erkrankung und die Wichtigkeit einer konsequenten Therapie. Dies insbesondere deshalb, weil viele Maßnahmen vom Patienten zu Hause selbstständig weitergeführt werden sollen. Er muss dazu angeleitet werden, die betroffene Extremität so oft wie möglich zu gebrauchen, da ein ängstliches Vermeidungsverhalten den Therapieprozess verzögert.<br /><br /> Gegen Schmerzen kommen sämtliche Analgetika des WHO-Schemas zum Einsatz. Bei ausgeprägten neuropathischen Schmerzen sollten frühzeitig Antikonvulsiva und Antidepressiva verwendet werden. Steht die (neurogene) Entzündung im Vordergrund, ist eine Kortisontherapie meist sehr erfolgreich. Parallel dazu ist eine antiosteoporotische Therapie mit Bisphosphonaten, die auch analgetisch wirken können (cave: off-label use!), Kalzium und Vitamin D<sub>3</sub> sinnvoll.<br /><br /> Zur Reduktion des Ödems werden abschwellende Maßnahmen wie Lagerung, Lymphdrainage, Ausstreichen und Bewegungsübungen eingesetzt. Eine Kompressionsbehandlung wird von CRPS-Patienten oft nicht toleriert.<br /><br /> Um Bewegungseinschränkungen, motorische Störungen und Vermeidungsverhalten zu behandeln, muss von Anfang an eine intensive Bewegungstherapie unter physiooder ergotherapeutischer Anleitung durchgeführt werden (Abb. 5, 6). Diese muss vom Patienten auch selbstständig zu Hause gemacht werden. Hier kann durchaus auch eine gewisse Schmerzzunahme in Kauf genommen werden, wenn dadurch Funktionsverbesserungen erzielt werden können. Dies wurde bereits vor vielen Jahren mit den sogenannten „Scrub and carry“-Programmen gemacht und wird zuletzt in sehr ausgeprägter Form, aber mit großem Erfolg, bei der „pain exposure physical therapy“ (PEPT) eingesetzt.<br /><br /> Eine Therapieform, die sich beim CRPS sehr bewährt hat, ist die Spiegeltherapie (Abb. 7, 8). Dabei wird mit einem Spiegel, der die betroffene Extremität verdeckt, möglichst jede Stunde ein kurz dauerndes, einfaches Übungsprogramm durchgeführt. Die schmerzende Seite wird je nach Schmerzintensität mitbewegt oder ruhig gehalten. So kann die beim CRPS desorganisierte kortikale Repräsentation wieder korrigiert und eine deutliche Schmerzreduktion und Verbesserung der Beweglichkeit erreicht werden. Eine Erweiterung der Spiegeltherapie findet man bei der „Graded motor imagery“-Therapie. Auch hier wird an der veränderten Körperwahrnehmung gearbeitet, indem vor der Spiegeltherapie noch Trainingsphasen mit Links/rechts-Erkennen und Bewegungsvorstellung durchgeführt werden.<br /><br /> Für die Therapie der sensorischen Störungen wird ein Desensibilisierungstraining gemacht. Mit sanftem Streichen, Bürsten oder Massieren, z.B. mit Linsenbädern (Abb. 9), kann der Patient langsam wieder an das Ertragen alltäglicher Reize herangeführt werden.<br /><br /> Eine Anwendung von Topika, wie z.B. Dimethylsulfoxid (DMSO), das in Form einer Creme fünfmal täglich auf die betroffene Extremität aufgetragen wird, gehört in vielen Zentren zur Standardtherapie. Die Empfehlungen in den verschiedenen Guidelines sind allerdings uneinheitlich. Weitere Therapiemöglichkeiten sind CO2-Bäder, die aber bei ausgeprägter Allodynie eventuell nicht vertragen werden, und eine TENS-Therapie, die in einer Studie signifikante positive Effekte zeigte.<br /><br /> Wenn oben genannte Therapieansätze erfolglos bleiben, können invasive Maßnahmen durchgeführt werden. Dazu zählen die Sympathikusblockade, bei der mit verschiedenen Methoden das regionale sympathische Nervensystem vorübergehend oder dauerhaft ausgeschaltet wird, und die Rückenmarkstimulation (SCS), bei der über implantierte Elektroden mit einem Generator das Rückenmark elektrisch stimuliert wird, um die Schmerzen zu lindern.<br /><br /> Eine ergänzende psychologische Betreuung, die vor allem bei protrahierten Verläufen sinnvoll ist, kann die Krankheitsbewältigung unterstützen, die Körperwahrnehmung normalisieren und die Überwindung der Bewegungsangst trainieren.<br /><br /> Bei chronischen Verläufen gilt es insbesondere, Gelenkskontrakturen mit intensiver Bewegungstherapie (Physio- oder Ergotherapie) zu verhindern oder gering zu halten. Bestehen starke funktionelle Defizite, kann mit einer Versorgung mit unterschiedlichen Hilfsmitteln und Adaptationen versucht werden, eine möglichst gute Partizipation zu erreichen.<br /><br /> Die bisher einzige in Studien nachgewiesene präventive Maßnahme ist die Einnahme von 500–1000mg/tgl. Vitamin C, entweder vor einem geplanten Eingriff oder z.B. nach einer Radiusfraktur. Die Einnahme erfolgte dabei meist über 50 Tage. Dies wäre daher präoperativ bei Patienten zu erwägen, die in der Anamnese bereits ein CRPS haben. Ist eine Operation bei noch bestehendem CRPS nötig, sollte sie in Leitungsanästhesie durchgeführt werden und der Patient in den ersten postoperativen Tagen mit einem Schmerzkatheter versorgt werden.<br /><br /></p> <div id="fazit">Für ihren wertvollen Input bedanke ich mich bei meinen Kolleg(inn)en OÄ Dr. Sabine Pfalzer, OÄ Dr. Gerda Reichel-Vacariu und Prof. Dr. Othmar Schuhfried, die gemeinsam mit mir den harten Kern der CRPS-Arbeitsgruppe PMR bilden.</div> <div> </div> <div><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb5.jpg" alt="" width="685" height="1089" /></div> <div><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb6.jpg" alt="" width="685" height="671" /></div> <div><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb7.jpg" alt="" width="685" height="724" /></div> <div><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb8.jpg" alt="" width="685" height="1032" /></div> <div><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s46_abb9.jpg" alt="" width="685" height="1033" /></div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Parkinson: Früherkennung – der nächste Meilenstein für Forschung und Therapie
Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Schätzungsweise 30000 Menschen sind in der Schweiz betroffen. Dr. med. Ines Debove ist stellvertetende Leiterin des ...
Epilepsie: «Wir können heute die Therapie viel mehr individualisieren»
Jahrhundertelang versuchte man, Epilepsiekranken mit Exorzismus ihre angeblichen «Dämonen» auszutreiben. Heute gibt es mehr als 30 wirksame Medikamente, präzisere Diagnostik und neue ...
Migräne: «Wir können alle dazu beitragen, dass die Gesundheitsausgaben nicht ins Unermessliche steigen»
Vor 25 Jahren gab es nur eine Handvoll Medikamente zur Migräneprophylaxe. Heute stehen mit CGRP-basierten Medikamenten in der Schweiz sechs weitere zur Verfügung, sodass mehr Patienten ...


