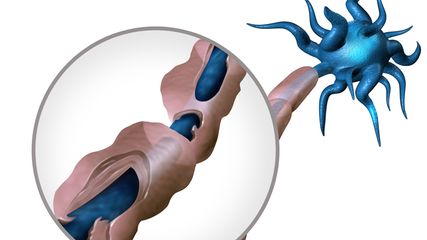©
Getty Images/iStockphoto
Die Auswirkungen medikamentöser MS-Therapien auf Schwangerschaft und Geburt
Jatros
Autor:
Dr. Gabriele Senti
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Beim 69. Kongress der American Academy of Neurology (AAN) in Boston wurden rezente Ergebnisse zum Thema „MS-Therapien vor und während der Schwangerschaft“ präsentiert. Berichtet wurde unter anderem über die Effekte der verschiedenen Therapien auf Säuglinge und die Auswirkungen einer Therapiepause auf die Rückfallraten.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Schwangerschaft nach Behandlung mit Interferonen oder Glatirameracetat</h2> <p>Ein israelisches Team führte mithilfe der Methode der AAN zur Bestimmung der Kausalität eine systematische Analyse von Schwangerschaften bei Frauen mit Multipler Sklerose (MS) durch. Verglichen wurden Frauen, die während der Schwangerschaft einer Behandlung mit Interferonen oder Glatirameracetat (GA) ausgesetzt waren, mit schwangeren MS-Patientinnen, die sich keiner medikamentösen Behandlung unterzogen hatten. Ausgangspunkt für die Analyse war eine Literatursuche in den Datenbanken PubMed, Cochrane und Embase. Die Kriterien für den Einschluss einer Studie in die anschließende Analyse waren: mindestens 100 Probandinnen und Vorliegen von Ergebnissen einer Vergleichsgruppe mit unbehandelten Schwangeren mit MS. Sie wurden von acht Studien erfüllt.<br />In der Kohorte mit GA-Exposition fand man keinen Unterschied in Geburtsgewicht und Geburtsgröße zwischen den Gruppen. In der Kohorte mit Interferon-Exposition hingegen unterschieden sich diese Datenpunkte für die exponierte Gruppe in vier von fünf anwendbaren Studien signifikant von der Kontrollgruppe – die Konfidenzintervalle waren allerdings im Allgemeinen groß. Für die jeweils sechs Studien, die über Geburtsanomalien berichteten, war die Exposition mit GA oder Interferon in allen außer einer Studie mit einer Risikominderung von 10 bis 75 % verbunden. Die Konfidenz­intervalle waren hier ebenfalls groß. Die Autoren empfehlen daher, weitere Studien mit einer größeren Anzahl an Teilnehmerinnen durchzuführen, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu verbessern (P1.360).</p> <h2>Auswirkung von Natalizumab-Exposition während der Schwangerschaft</h2> <p>Die Verschreibungsinformation zu Natalizumab indiziert dessen Verwendung während der Schwangerschaft nur, wenn der potenzielle Nutzen das mögliche Risiko für den Fötus rechtfertigt. Bisherige Analysen von Daten zu Schwangerschaftsverlauf und Geburt aus dem Tysabri® Pregnancy Exposure Registry basierten daher auf einer sehr kleinen Anzahl an Patientinnen, die Natalizumab über das erste Trimester hinaus erhalten hatten. Eine beim AAN-Kongress vorgestellte Studie untersuchte nun Daten aus Schwangerschaften von Frauen mit RMS oder Morbus Crohn, die durchgängig mit Natalizumab behandelt worden waren.<br />Im Zeitraum vom 24. November 2004 bis 7. August 2016 wurden aus der Natalizumab Global Safety Database 24 prospektiv gemeldete Schwangerschaften (21 Patientinnen mit RMS, 3 Patientinnen mit Morbus Crohn) gefiltert, bei denen die Frauen die Natalizumab-Therapie ohne Unterbrechung weiterführten. Alle diese Schwangerschaften resultierten in Lebendgeburten und es wurden keine Geburtsdefekte aufgezeichnet. Das mittlere Gestationsalter lag bei 38,4 Wochen (31–40,5 Wochen; Daten von 14 Schwangerschaften), das mittlere Geburtsgewicht bei 3040g (1787–4400g; Daten von 11 Schwangerschaften). Es wurden zwei Fälle von niedrigem Geburtsgewicht gemeldet (eine Frühgeburt und eine Zwillingsgeburt); hämatologische Anomalien wurden bei fünf Säuglingen beobachtet (leichte Panzytopenie, isolierte Thrombozytopenie, Neutropenie und Anämie), aber in allen Fällen gelöst (P1.362).</p> <h2>Rückfallraten während der Schwangerschaft und post partum</h2> <h2>Retrospektive Analyse der US Claims Database</h2> <p>US-Daten über MS-Rückfallraten vor, während und nach der Schwangerschaft sind begrenzt. Ziel dieser retrospektiven Studie war die Bewertung der Rezidivraten vor, während und nach der Schwangerschaft bei Frauen mit MS. Hierzu wurden Daten aus der US-Datenbank IMS Health Real World Data Adjudicated Claims herangezogen.<br />Einschlusskriterien waren eine Lebendgeburt und eine mindestens einjährige kontinuierliche Registrierung vor/nach der Schwangerschaft in IMS Health Real World Data Adjudicated Claims. Als Rückfälle wurden MS-bezogene Krankenhausaufenthalte, MS-bezogene Besuche in der Notfallambulanz oder MS-bezogener ambulanter Besuch mit Kortikosteroidrezept gewertet. Die Zeiträume für einen Rückfall wurden wie folgt unterteilt: in das Jahr vor der Schwangerschaft (in 3-Monats-Intervallen), in die drei Trimester der Schwangerschaft, in das Puerperium (6 Wochen nach der Schwangerschaft) und in das 1. Jahr nach der Schwangerschaft (6–12 Wochen sowie 3–6, 6–9 und 9–12 Monate post Schwangerschaft). Die Rückfallraten wurden dann in monatliche Raten umgerechnet, um Vergleiche im Verlauf der Zeit zu ermöglichen.<br />Von 190 475 Frauen mit MS erfüllten 2158 die Einschlusskriterien. Das mittlere Alter betrug 30,26 (SD 4,68) Jahre. Vor der Schwangerschaft lag die monatliche Rate eines MS-Rückfalls zwischen 1,36 und 1,67 % . Während der Schwangerschaft sank die monatliche Rückfallrate auf 0,87–1,00 % und erhöhte sich während des Wochenbettes auf 2,56 % . Danach sank die Rückfallrate wieder auf 1,95 % 6–12 Wochen post partum und auf 2,04 % 3–6 Monate post partum, bevor sie im Zeitraum 6–9 Monate (1,73 % ) und 9–12 Monate post partum (1,76 % ) noch weiter abfiel. Dieses Muster der Rückfallraten war ähnlich, wenn die Patientinnen basierend auf der Häufigkeit der Rückfälle vor der Schwangerschaft stratifiziert wurden (P1.361).</p> <h2>Analyse des nationalen Kuwait MS-Registers</h2> <p>Obwohl die Rezidivraten bei MS während der Schwangerschaft im Allgemeinen sinken, ist das Thema der Reaktivierung der Krankheit nach Absetzen der krankheitsmodifizierenden Therapie (DMT) vor oder zum Zeitpunkt der Schwangerschaftsbestätigung für Arzt und Patientinnen von großer Bedeutung. Um das Risiko eines MS-Rückfalls während der Schwangerschaft und post partum zu beurteilen, wurde eine retrospektive Querschnittsstudie durchgeführt. Mithilfe des nationalen Kuwait MS-Registers wurden zwischen 1. Oktober 2011 und 30. September 2016 schwangere Frauen identifiziert und Daten zu Demografie, klinischen Merkmalen einschließlich Rückfällen, vorheriger Anwendung von DMT und Daten zu Schwangerschaftsverlauf und Geburt erhoben. Primäres Ziel war die Ermittlung der Rückfallrate während der Schwangerschaft und post partum, darüber hinaus wurde auch der Zusammenhang zwischen verschiedenen DMT, deren Auswaschperioden und der Rückfallhäufigkeit untersucht.<br />Insgesamt wurden medizinische Aufzeichnungen von 73 Schwangerschaften (68 Patientinnen) überprüft. Das mittlere Alter betrug 28,2±4,2 Jahre und die mittlere Erkrankungsdauer zum Zeitpunkt der Schwangerschaftsbestätigung 4,11±3,9 Jahre. Die meisten Patientinnen (88,2 % , n=60) waren im Jahr vor der Schwangerschaft mit DMT behandelt worden: Am häufigsten vertreten waren Betainterferone (42,6 % ), Natalizumab (25 % ) und Fingolimod (19,1 % ). Bei 16,2 % der Patientinnen traten während der Schwangerschaft Rückfälle auf, 7 davon im ersten und 5 davon im dritten Trimester. Die Rückfälle im ersten Trimester waren häufig mit einer Natalizumab- oder Fingolimod-Therapie assoziiert. Weitere 10 Rückfälle ereigneten sich post partum in einem Zeitraum von 6,2±5,6 Wochen nach der Geburt.<br />Diese Rückfallraten während der Schwangerschaft waren höher als von den Studienautoren erwartet. Dass die meisten Rückfälle sich im ersten Trimester häuften, deutet für sie darauf hin, dass die Reaktivierung der Krankheit mit dem Entzug von hochwirksamen DMT einhergeht und eng mit der Auswaschperiode vor der Schwangerschaft zusammenhängt (P1.366).</p> <h2>Alemtuzumab-Fallserie aus dem deutschen MS- und Kinderwunschregister</h2> <p>Mehr als 25 % der Frauen mit hochaktiver MS erleiden Rückfälle während der Schwangerschaft. Daten über die Rückfallraten während der Schwangerschaft von Frauen, die mit ALZ behandelt wurden, liegen jedoch kaum vor. Eine deutsche Studie widmete sich nun genau dieser Patientinnenpopulation: 15 Frauen, die sich vor ihrer Schwangerschaft einer ALZ-Therapie unterzogen hatten, wurden prospektiv in das Deutsche Multiple-Sklerose- und Kinderwunschregister aufgenommen. Detaillierte Informationen über den Verlauf der Erkrankung (Rückfälle vor und während der Therapie mit Alemtuzumab während der Schwangerschaft und post partum) und geburtshilfliche Informationen wurden dabei mit einem standardisierten Fragebogen erfasst.<br />7 Schwangerschaften waren ALZ ausgesetzt (letzte ALZ-Aufnahme im Median 42 Tage [1–108 Tage] vor der letzten Menstruation), 8 weitere Schwangerschaften waren dieser Therapie nicht ausgesetzt. Die Frauen wurden nach einem Median von 168 Tagen (129–1074 Tage) schwanger und das mittlere Alter bei der Konzeption betrug 30,0±4,1 Jahre. Zum Zeitpunkt der Präsentation der Daten waren 12 Säuglinge bereits geboren worden. Ein Neugeborener (die Mutter erhielt die letzte ALZ-Therapie 2 Monate vor der letzten Menstruation) kam mit nur einer Niere und Hydronephrose zur Welt und bei einem weiteren Neugeborenen (die Mutter erhielt die letzte ALZ-Therapie einen Tag vor der letzten Menstruation) wurde Hypospadie diagnostiziert. Frühgeburten wurden nicht verzeichnet. Obwohl die mediane Anzahl von Rückfällen im Jahr vor der ALZ-Therapie bei 2 lag (1–5 Rückfälle), blieben alle Frauen während der Schwangerschaft frei von Rückfällen und nur eine Frau erlitt einen postpartalen Rückfall.<br />Laut den Autoren der Studie könnten Antikörper wie ALZ eine interessante Option für Frauen mit hochaktiver MS und Kinderwunsch sein, da das Medikament selbst kurz nach der Verabreichung wieder aus dem Organismus entfernt wird, der biologische Effekt aber bestehen bleibt (P1.367).</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 69. Kongress der American Academy of Neurology (AAN), 22.–28. April 2017, Boston
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS
Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...
Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung
Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...
Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln
Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...