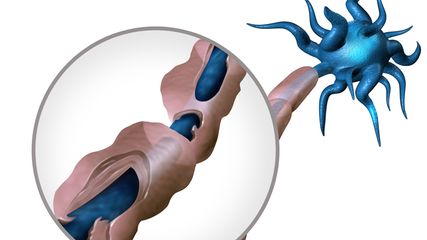©
Getty Images/iStockphoto
Apomorphin bei fortgeschrittenem Parkinsonsyndrom
Jatros
Autor:
Ass. Dr. Lukas Kellermair
Neurologie 2<br> Kepler Universitätsklinikum, Linz<br> E-Mail: lukas.kellermair@kepleruniklinikum.at
30
Min. Lesezeit
14.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Spätkomplikationen wie motorische Fluktuationen sind ein weitverbreitetes Problem nach jahrelanger Levodopa-Therapie. Apomorphin ist als wirksamster Dopaminagonist eine sehr gute und häufig unterschätzte Alternative zur invasiven Therapie in der Symptomkontrolle bei langjähriger Parkinsonerkrankung.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Apomorphin gehört zu den am schnellsten wirkenden Parkinsonmedikamenten (5–15 Minuten).</li> <li>Apomorphin-Injektionen beenden bis zu 95 % aller Off-Phasen.</li> <li>Die Ersteinstellung sollte durch einen erfahrenen Neurologen oder in einem Zentrumsspital erfolgen.</li> </ul> </div> <h2>Einführung und Pharmakologie</h2> <p>Apomorphin ist das älteste Medikament zur Parkinsontherapie und wird bereits seit Jahrhunderten wegen seiner sedativen, emetischen und psychotischen Wirkung verwendet. Allerdings blieb die Wirkung auf das Bewegungssystem bis Mitte des 19. Jahrhunderts unbekannt; erst 1951 erfolgte der erste Nachweis von Rigiditäts- und Bewegungsverbesserung in Tierversuchen. Wegen seiner vielen Nebenwirkungen und des gleichzeitigen Aufschwungs von Levodopa dauerte es allerdings bis 1979, bis die ersten erfolgreichen Behandlungen bei Patienten mit Morbus Parkinson – mit subkutanem Apomorphin in Kombination mit Domperidon – von einer italienischen Arbeitsgruppe publiziert wurden. Seitdem ist Apomorphin ein fixer Bestandteil der fortgeschrittenen medikamentösen Parkinsontherapie.</p> <p>Seine Wirkung entfaltet Apomorphin hauptsächlich durch seine Dopamin-ähnliche Molekularstruktur. Im Gegensatz zu anderen Dopaminagonisten, wie Pramipexol und Ropinirol, welche limitiert über den D2- und D3-Rezeptor wirken, entfaltet Apomorphin seine Wirkung als einziger Dopaminagonist auf alle Dopaminrezeptoren (D1, D2, D3, D4, D5). Durch vergleichbare Affinität zum D1-Rezeptor kombiniert Apomorphin damit die Wirkung auf die motorischen Parkinsonsymptome von Levodopa mit einem Dopaminspeichernden Effekt am nigrostriatalen System aufgrund seiner D2Sh-Wirkung.</p> <p>Apomorphin überbrückt dank seiner lipophilen Struktur rasch die Blut-Hirn- Schranke und entfaltet bereits 5–15 Minuten nach subkutaner Applikation seine Wirkung im Gehirn. Somit wirkt Apomorphin fast dreimal so schnell wie lösliches Madopar – unabhängig vom gastrointestinalen System.</p> <p>Aufgrund der unspezifischen Wirkung und des multilokulären Vorhandenseins von Dopaminrezeptoren im zentralen Nervensystem führt Apomorphin allerdings auch zu Nebenwirkungen, welche ohne medikamentöse Vorbereitung zu einer deutlichen Therapieeinschränkung führen würden. Die gängigste Nebenwirkung ist – wegen der Wirkung auf die Area postrema – sicherlich Übelkeit und Erbrechen. Seltener kann es allerdings auch zu Impuls- Kontroll-Störungen über das limbische System (D3-Rezeptor) führen. Obwohl derzeit noch keine Studien vorliegen, könnte die geringere D3:D2-Ratio eine geringere Impuls-Kontroll-Störung durch Apomorphin im Vergleich zu anderen Dopaminagonisten bedeuten.</p> <p>Durch den ausgeprägten hepatischen First-pass-Effekt von Apomorphin ist eine subkutane oder intravenöse Applikation bis dato unabdingbar. Die damit verbundenen Hautveränderungen (von harmlosen Hautknötchen bis zu Nekrosen und Abszessen) führen, wenn sie auch deutlich seltener geworden sind, zu den höchsten Abbruchraten im Vergleich aller Nebenwirkungen. Die gefährliche hämolytische Anämie ist eine seltene und kaum gesehene Nebenwirkung.</p> <h2>Anwendungsgebiet und Zukunftsaussicht</h2> <p>Wegen des Wirkungsverlusts von Levodopa und des Auftretens von Spätkomplikationen beim fortgeschrittenen Parkinsonsyndrom etablierte sich Apomorphin vor allem als Rescue-Medikation bei morgendlichen Akinesien und Off-Phasen.</p> <p>Dies ist auch in mehreren Open-Label- Studien beschrieben. Die Anwendung in der Pen-Applikationsform kann tägliche Off-Phasen im Durchschnitt bis zu 45 % reduzieren. Der große Vorteil liegt dabei in der rascheren und zuverlässigeren Wirkung im Vergleich zu löslichem Madopar (97 % vs. 45 % Beendigung der Off- Phase). Die Dosistitration des Apomorphin- Pens kann sowohl in der Praxis als auch in einem Zentrum erfolgen. Eine Vortherapie mit Domperidon (10mg für mindestens 2 Tage 2–3x tgl.) und eine zuvor durchgeführte elektrokardiografische Kontrolle zum Ausschluss eines Long-QT-Syndroms sind dabei Voraussetzung. Zur Dosisfindung werden zuerst 2mg appliziert, dann kann alle 15 Minuten bis zu einem zufriedenstellenden Ergebnis hochtitriert werden.</p> <p>Obwohl bereits in vielen Open-Label- Studien die Verringerung der Off-Phasen gezeigt wurde, besteht bezüglich Dyskinesiereduktion eine geteilte Meinung. Vom klinischen Aspekt her werden Patienten, die bereits vor der Apomorphin-Therapie an intermittierenden (Levodopa-induzierten) Dyskinesien leiden, eine leichte Zunahme der Überbeweglichkeit bemerken. Eine gleichzeitige Reduktion der täglichen Levodopa-Dosis kann allerdings in längerer Hinsicht auch zu einem Rückgang der Dyskinesierate führen. Wie die ersten Ergebnisse der Toledo-Trial zeigen, kann durch Apomorphin eine signifikante Reduktion der Off-Phasen ohne vermehrtes Auftreten von behandlungsbedingten Nebenwirkungen (Dyskinesien) erreicht werden. Der Grad der Wirkung auf die „nonmotor symptoms“ (NMS), wie Müdigkeit, Blasenstörung oder Schmerzen, ist ebenfalls in nur wenigen Studien untersucht, in diesen zeigen sich allerdings zumeist positive Ergebnisse. Eine aussagekräftige Empfehlung kann diesbezüglich dennoch nicht abgegeben werden.</p> <p>Trotz aller Vorteile bleibt die subkutane Injektion häufig ein großes Problem für viele Patienten, sei es aus körperlichen (Hautveränderungen) oder psychiatrischen Gründen (demenzielle Entwicklung). Aus diesem Grund scheint eine neue, derzeit in klinischen Studien geprüfte Applikationsform (sublingual) eine zukunftsreiche Alternative darzustellen. Die Tablette wird dabei unter der Zunge appliziert und löst sich innerhalb von 2 Minuten auf. Über die Schleimhäute wird der Wirkstoff aufgenommen. Die ersten Studienergebnisse zeigten dabei eine ähnlich gute Wirkung wie die anderen Applikationsformen. Dennoch muss sich diese Form der Apomorphin-Gabe erst in größeren placebokontrollierten randomisierten Studien beweisen und ist bis dato nur ein Zukunftsgedanke.</p> <p>Insgesamt treten Spätkomplikationen bei ca. 80 % aller Patienten mit idiopathischen Parkinsonsyndromen nach 6-jähriger Levodopa-Therapie auf. Eine kontinuierliche dopaminerge Stimulation stellt dabei oft die einzige Möglichkeit einer Symptomlinderung dar. Dabei gibt es drei Optionen: die kontinuierliche Apomorphin- Pumpe, die jejunale Pumpentherapie mittels Duodopa und die tiefe Hirnstimulation. Obwohl keine randomisierten Vergleichsstudien existieren, stellt die Apomorphin- Pumpe als am wenigsten invasives Verfahren häufig eine geeignete Alternative zu den anderen Verfahren dar. Der finanzielle Aspekt – eine kosteneffiziente Therapie zu etablieren – spielt eine immer größere Rolle in unserer Arbeit. Um aus gesundheitsökonomischer Sicht eine Empfehlung aussprechen zu können, fehlen leider Daten dazu, welche Therapie kostengünstiger ist. Direkte Vergleiche lassen allerdings die Mutmaßung zu, dass zumindest ein ähnlicher kosteneffizienter Aspekt von Apomorphin im Vergleich mit der Standard-Therapie vorliegt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1706_Weblinks_jatros_neuro_1706_s11_bild.jpg" alt="" width="1455" height="503" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1706_Weblinks_jatros_neuro_1706_s12_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="825" /></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Apomorphin kann sowohl als Pen als auch in der kontinuierlichen Injektionsform (Pumpe) bei geeigneten Patienten mit fortgeschrittenem ideopathischem Parkinsonsyndrom mit motorischen Fluktuationen zur Reduktion der täglichen Off- Dauer verwendet werden. Weiters kann die Therapie Off-Dauer und Dyskinesien bei Patienten mit schweren motorischen Komplikationen reduzieren und stellt damit eine Alternative zur Duodopa-Pumpentherapie oder tiefen Hirnstimulation dar. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die richtige Patientenselektion gelegt werden – die Erfolgsrate ist bei selbstständiger Applikation höher. Bei Patienten mit ausgeprägter orthostatischer oder neuropsychiatrischer Komponente und/ oder schwerer Demenz sollte nur in Ausnahmefällen eine Apomorphin-Therapie eingesetzt werden.</p> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>• Chaudhuri KR, Ondo W: Handbook of Movement Disorders, Current Medicine Group, 2009.16. • Deleu D et al.: Drugs Aging 2004; 21: 687-709 • Dewey RB et al.: Arch Neurol 2001; 58: 1385-92 • Drapier S et al.: Parkinsonism Relat Disord, 2012; 18(1): 40-4 • Garcia Ruiz PJ et al.: Mov Disord 2008; 23(8): 1130-6 • Hisahara S et al.: Int J Med Chem 2011; doi: 10.1155/2011/403039 • Hauser RA et al.: Mov Disord 2016; 31(9): 1366-72 • Isaacson SH et al.: Mov Disord Clin Pract 2016; doi: 10.1002/mdc3.12350. • Jenner P, Katzenschlager R: Parkinsonism Relat Disord 2016; 33 Suppl 1: S13-S21 • Kempster PA et al.: J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990; 53(11): 1004-7 • Manson AJ et al.: Mov Disord 2002; 17(6): 1235-41 • Menon R, Stacy M: Expert Opin Pharmacother 2007; 8(12): 1941-50 • Ostergaard L et al.: J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995; 58(6): 681-7 • Pahwa R et al.: J Neurol Sci 2007; 258(1-2): 137-43 • Pietz K et al.: J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998; 65(5): 709-16 • Stibe CM et al.: Lancet 1988; 1(8582): 403-6 • Van Laar T et al.: Clin Neurol Neurosurg, 1993; 95(3): 231-5• Walter E, Odin P: J Med econ 2015; 18(2): 155-65</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS
Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...
Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung
Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...
Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln
Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...