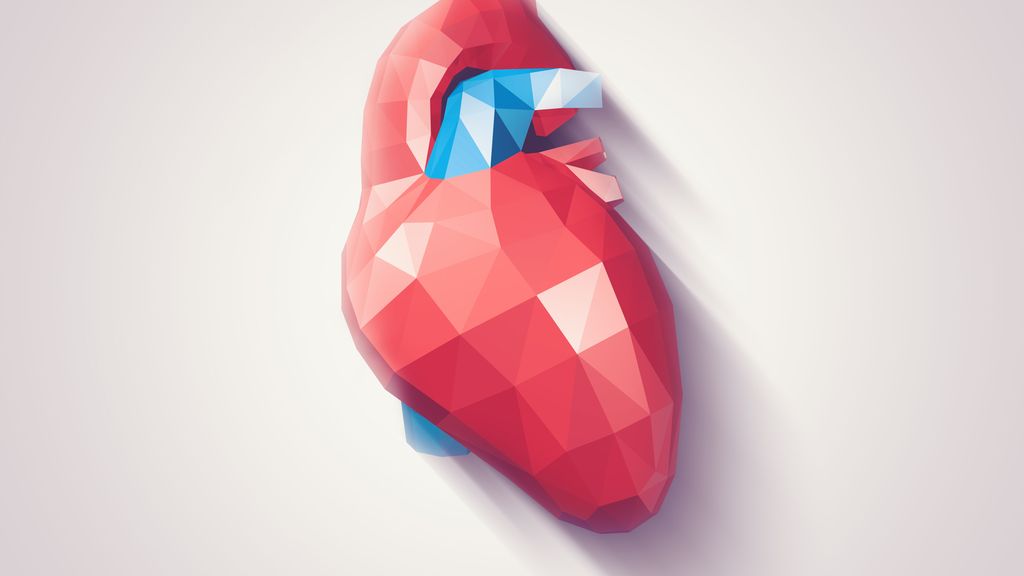
©
Getty Images/iStockphoto
Herztod in Österreich: „Wo wir stehen, was wir brauchen“
Jatros
30
Min. Lesezeit
19.12.2019
Weiterempfehlen
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
<p class="article-intro">Ende November wandte sich die ÖKG an die Öffentlichkeit, um auf die Situation bei kardiovaskulären Erkrankungen in Österreich aufmerksam zu machen. Dies geschah auch im Hinblick auf die Bildung der neuen Bundesregierung und die „Kassenreform“, die eine historische Chance bieten, diese präsentierten Vorschläge umzusetzen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Kardiovaskuläre Erkrankungen sind in Österreich mit einem Anteil an der Mortalität von 39 % Todesursache Nr. 1, was im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek, Präsident der ÖKG, Univ.-Prof. Dr. Thomas Stefenelli, Past-Präsident der ÖKG, und Prim. Priv.-Doz. Dr. Johann Altenberger, Ärztlicher Leiter Rehabilitationszentrum Großgmain, zogen im Rahmen einer Pressekonferenz der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) Bilanz und stellten Forderungen an die Gesundheitspolitik. Unterstützt wurden sie durch Dr. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte.</p> <h2>Mehr Herztote als Krebstote</h2> <p>„Nach einer eindrucksvollen Senkung der Herzinfarktsterblichkeit durch die medizinischen Fortschritte steigt z. B. die Zahl von Herzinsuffizienzpatienten rapide an. Es zeigt sich, dass es außer beim Myokardinfarkt in Österreich nicht gelungen ist, die Zahl kardiovaskulärer Erkrankungen zu senken“, so Siostrzonek.<sup>1</sup> Entscheidend für die Abnahme der Zahl von Herz-Kreislauf- Erkrankungen sind Prävention und Früherkennung. „Die stationäre kardiologische Betreuung in Österreich muss als erstklassig bezeichnet werden. So war es möglich, die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herz- Kreislauf-Erkrankungen vom Jahr 1980 bis zum Jahr 2018 von 49 014 auf 32 684 zu senken – und das, obwohl Österreich um 1,3 Millionen Menschen gewachsen ist“, so Siostrzonek. Dennoch besteht in Österreich ein massiver Nachholbedarf, wie ein Vergleich der Situation in Österreich mit aktuellen Daten der PURE-Studie 2 zeigt. In der Studie wurden zwar keine Daten aus Österreich ausgewertet, dennoch lassen sich Schlüsse ziehen. In der PURE-Studie wurden Länder nach Pro-Kopf-Einkommen stratifiziert und die Todesursachen verglichen. In Ländern, die als „high income countries“ (HIC) klassifiziert wurden, liegt die kardiovaskuläre Mortalität mit 22 % unter jener aufgrund von onkologischen Erkrankungen (55 % ). In „middle income countries“ (MIC) verhält es sich mit 42 % kardiovaskulärer zu 31 % onkologischer Mortalität umgekehrt.<sup>2</sup> Österreich würde in dieser Studie zu den HIC-Ländern zählen. Betrachtet man die Mortälitätsraten hierzulande, so liegen diese mit 38,9 % kardiovaskulärer zu 24,5 % onkologischer Mortalität jedoch im Bereich der MIC-Länder.<sup>1</sup> Für Österreich besteht in der kardiovaskulären Versorgung also Aufholbedarf zu den anderen HIC-Ländern.</p> <p><strong>Verbesserungsbedarf in Österreich</strong><br /> Resultate wie die der PURE-Studie zeigen die Herausforderungen, denen sich die Gesundheitspolitik stellen muss, um die kardiologische Versorgung in Österreich zukunftsfit zu machen:</p> <ul> <li>Bei Früherkennung und Prävention ist noch viel „Luft nach oben“, eine bessere Koordination und Abstimmung der vielfältigen Maßnahmen sind sinnvoll.</li> <li>Die Behandlung muss leitliniengerecht sein und die Kosten müssen von den Krankenkassen übernommen werden – das ist bei Medikamenten nicht immer der Fall.</li> <li>Gesichert sein müssen ausreichend viele Spitalsambulanzen und kardiologische Abteilungen mit fachspezifischen invasiven und nicht invasiven Angeboten, ebenso wie genügend hochwertige Spitalsbetten, z. B. für Katheteruntersuchungen und -interventionen oder Überwachungsbetten.</li> <li>Rehabilitation und Langzeitbetreuung benötigen eine solide Basis unter intensiver Einbeziehung des niedergelassenen ärztlichen Bereichs, inklusive der konsequenten Nutzung telemedizinischer Anwendungen sowie mobiler Pflege- und Betreuungsdienste.</li> <li>Die Kardiologie muss finanziell so ausgestattet werden, dass diese Leistungen erbracht werden können und in Zukunft gesichert sind. Das muss österreichweit auf einem den Entwicklungen entsprechenden Versorgungsniveau geschehen, und es darf zu keinen Abstrichen bei relevanten kardiologischen Leistungen wie Labor, Medikamenten, Telemedizin und mobiler Pflege kommen.</li> </ul> <h2>Volkskrankheit Herzinsuffizienz</h2> <p>„An einem akuten Herzinfarkt starben in Österreich im Jahr 1980 noch 10 569 Menschen, 2018 waren es 4527 – ein Minus von 57 % “, sagte Stefenelli. Er erklärte weiter: „Dieser Erfolg beruht unter anderem auf konsequent aufgebauten Infarktnetzwerken, die im Akutfall rasche und kompetente Interventionen ermöglichen. Für diese sehr positive Entwicklung zahlen wir jedoch einen gewissen gesundheitlichen Preis: Immer mehr Menschen, die einen akuten Herzinfarkt überleben, erkranken an einer Herzinsuffizienz.“</p> <p><strong>Todesfälle „sonstige ischämische Erkrankungen“ vervielfacht</strong><br /> Durch rechtzeitige Intervention an verengten Herzkranzgefäßen und durch rasche Akutversorgung bei Infarkten hat sich, parallel zur steigenden Lebenserwartung, die Zahl der Todesfälle bei Menschen mit „sonstigen ischämischen Erkrankungen“ vervielfacht. Zu dieser Gruppe zählen die Herzinsuffizienz (HI) oder das Vorhofflimmern. Die Zahl der Todesfälle in dieser Krankheitsgruppe stieg von 3747 im Jahr 1980 auf 9250 im Vorjahr; also ein gegenläufiger Trend zur abnehmenden Zahl an Todesfällen wegen Herz-Kreislauf-Krankheiten im Allgemeinen und wegen akuten Herzinfarkten im Besonderen. HI entwickelt sich derzeit zu einer Volkskrankheit. Weltweit sind mehr als 26 Millionen Menschen daran erkrankt, in Europa 1–2 % der Bevölkerung. Bis zu 45 % der Menschen, die wegen HI in ein Krankenhaus aufgenommen werden, sterben innerhalb eines Jahres. In Österreich kommt es zu 25 000 Hospitalisierungen pro Jahr aufgrund von HI,<sup>3</sup> sie ist der häufigste Grund für Hospitalisierungen bei über 65-Jährigen.</p> <p><strong>Zu wenig Wissen und Bewusstsein</strong><br /> Dessen ungeachtet weiß die Bevölkerung trotz jahrelanger konsequenter Aufklärungskampagnen wenig. Nicht einmal einer von zehn Bürgern kennt die drei häufigsten Symptome einer HI – geschwollene Beine, Atemnot und/oder Husten und rapide Gewichtszunahme. Einer von drei hält weitere Symptome einer HI wie verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit und Appetitlosigkeit für normale Alterserscheinungen. 50 % der HI-Patienten wissen bei Diagnosestellung nicht, was Herzschwäche/ HI überhaupt ist,<sup>4</sup> und 50 % nehmen ihre Medikation nicht regemäßig ein.<sup>5</sup> Die Konsequenz ist, dass viele Menschen mit HI erst mit großer Verzögerung eine zielführende Behandlung erhalten und wertvolle Zeit diagnostisch und therapeutisch ungenützt verstreicht. Aufgrund der schlechten Prognose vor allem nach einer Dekompensation bzw. Spitalseinweisung wegen HI bedarf es dringender Initiativen zur Früherkennung, Schulung und Therapieanpassung und der Optimierung von Schnittstellen.</p> <p><strong>Maßnahmen zur besseren Versorgung</strong><br /> Benötigt werden mehr „Heart Failure Units“ und ein optimales Zusammenwirken von Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und spezialisierten Pflegepersonen unter konsequenter Zuhilfenahme von Telemetrie zur Fernüberwachung. Die Bestimmung des Laborparameters NTproBNP wird regional unterschiedlich von den Kassen bezahlt, was in einzelnen Bundesländern die Verlaufskontrolle erschwert. Hier müssen die Kosten österreichweit übernommen werden. „Wesentlich ist auch die flächendeckende Einbindung von mobilen Pflegepersonen, um die positiven Erfahrungen von Aktionen wie KardioMobil Salzburg oder HerzMobil Tirol den Patienten österreichweit zu ermöglichen“, führt Stefenelli aus.</p> <h2>Hohes Potenzial der Prävention</h2> <p>„Sowohl die Primär- als auch die Sekundärprävention haben ein enormes Potenzial. Es ist gut dokumentiert, dass sich atherosklerotische Veränderungen in 9 von 10 Fällen auf Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, Lipidstoffwechselstörungen und Übergewicht zurückführen lassen. Lebensstilmodifikationen mit Verringerung dieser Risikofaktoren führen zu einer geringeren Häufigkeit von Adipositas und bereits kurz- bis mittelfristig zu einer Abnahme von Adipositas mit einer Prognoseverbesserung“, sagte Altenberger.</p> <p><strong>Körperliche Aktivität entscheidend<br /></strong>Auf dem ESC-Kongress in Paris wurde eine Metaanalyse vorgestellt, die Studien mit insgesamt fast 845 000 Probanden einschließt. Sie kommt zum Ergebnis, dass moderate bis hohe körperliche Aktivität in einem Zusammenhang mit einem geringeren Sterberisiko bei akutem Herzinfarkt steht. Das untersctreicht die Bedeutung von Bewegung in der Primärprävention, und dass Menschen, die sich regelmäßig sportlich betätigen, im Falle eines Herzinfarkts bessere Überlebenschancen haben.<sup>6</sup></p> <p><strong>Einfache Maßnahmen zur Prävention<br /></strong>Vier einfache Maßnahmen würden ausreichen, um einen Großteil der Herzinfarkte zu verhindern: Nikotinkarenz, regelmäßige Bewegung (5 x pro Woche zumindest 30 min) gesunde Ernährung (Vermeidung von Übergewicht durch Bewegung und Ernährung) und Vermeidung von chronischem Stress. Ein zweiter wichtiger Punkt ist: Menschen müssen ihre persönlichen Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterinoder Blutzuckerwerte kennen, damit sie bei Bedarf gegensteuern können.</p> <p><strong>Primärprävention bereits im Kindesalter<br /></strong>Effektive Primärprävention setzt bereits bei Kindern an und schließt Schulessen, Wissen über Kalorien sowie tägliche Bewegung ein. Aktuelle Daten zur Situation in Österreich bieten aber wenig Anlass zur Freude. Die WHO fordert für Kinder und Jugendliche eine Stunde Bewegung pro Tag. Eine Studie der WHO zeigt, dass in Österreich 71,2 % der Buben und 84,5 % der Mädchen körperlich nicht aktiv genug sind. Darüber hinaus zeigte sich, dass 30 % der Buben und 22 % der Mädchen zwischen sechs und neun Jahren übergewichtig oder adipös sind.<sup>7</sup></p> <p><strong>Sekundärprävention<br /></strong>Maßnahmen zur Sekundärprävention bringen messbaren Nutzen. Nach einem Herzinfarkt senkt die tägliche Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin die Mortalität um rund 13 % pro Jahr. Statine reduzieren die Sterblichkeit um 25 % . In vergleichbarer Größenordnung liegen die Wirkungen von ACE-Hemmern und Betablocker. Nichtrauchen, Gewichtreduktion, gesunde Ernährung und regelmäßiges körperliches Training erzielen Effekte in der Höhe von mindestens 20 % . „Auch die Technik hilft: Wir haben im Rehabilitationszentrum Großgmain der PVA eine Reha-App für Menschen nach einem Herzinfarkt entwickelt, die Patienten daran erinnert, ihre Medikamente einzunehmen, das Körpergewicht festzustellen und den Blutdruck zu messen, sich an die Bewegungsvorgaben zu halten etc. Ein System mit den Ampelfarben Grün, Gelb, Rot signalisiert den ihnen, wo sie stehen und wo sie besser werden müssen. Wir testen dieses System gegenwärtig im Rahmen einer Studie mit 300 Teilnehmern von drei Standorten und werden die Ergebnisse bald vorstellen“, so Altenberger. Präventive Maßnahmen – sei es Primär- oder Sekundärprävention – bieten ein großes Potenzial zur Reduktion kardiovaskulärer Erkrankungen und Mortalität. In Österreich engagieren sich besonders die Sozialversicherungen im Bereich der Primärund der Sekundärprävention. Auch Präventionsprojekte an Schulen und in den Gemeinden werden finanziert.</p> <p><strong>Maßnahmen gut abstimmen und konzentrieren<br /></strong>Für eine effiziente, zielgruppenorientierte und kostengünstige Strategie ist ein konzentriertes und koordiniertes Vorgehen wichtig. Eine klare Definition, welche Ziele vorrangig erreicht werden sollen, und eine gut abgestimmte Koordination von Info- und Aufklärungsmaßnahmen ist wichtig. Dazu gehören ein breiter Konsens unter Einbeziehung der entsprechenden kardiologischen Fachdisziplinen, die zentrale Koordinierung durch eine ausgewiesen erfahrene und kompetente Stelle und jeweils lokale Umsetzung. „Ein besonderer Stellenwert wird dem Bereich „digital health care“ im Sinne von durchdachten, zielgruppenorientierten und gut aufgesetzten telemedizinischen Anwendungen zukommen, dies zeigt sich bereits in der Sekundärprävention am Beispiel unserer Reha-App und der telemedizinischen Komponente des Projekts HerzMobil Tirol“, schließt Altenberger.</p> <h2>Kardiologischen Nachwuchs sichern</h2> <p>„In Österreich gibt es derzeit 743 Kardiologen. In 10 Jahren werden jedoch beinahe 38 % aller Kardiologen das Pensionseintrittsalter erreicht haben. Die Ärztekammer sieht den mittelfristigen jährlichen Nachbesetzungsbedarf bei mindestens 27,8 Kardiologen pro Jahr“, mahnt Steinhart. Nicht eingerechnet ist ein steigender Bedarf infolge von demografischen Veränderungen. Derzeit gibt es in Österreich 119 Kardiologen mit §2-Kassenvertrag und 268 Wahlärzte. Von der besonders versorgungsrelevanten Gruppe der §2-Kassen-Kardiologen werden 61 in den kommenden 10 Jahren das Pensionseintrittsalter erreichen werden, das ist jeder Zweite.<br /> Dafür zu sorgen, dass es ausreichend ärztlichen Nachwuchs in der Kardiologie gibt, ist nicht nur Gesundheitspolitik gefordert, sondern auch die Bildungspolitik, die Länder sowie die Krankenhäuser und ihre Betreiber, die z. B. sicherstellen müssen, dass es genügend Ausbildungsstellen für Kardiologen gibt. Was den Bereich der niedergelassenen Kassenkardiologen betrifft, müssen die beruflichen Rahmenbedingungen attraktiviert werden. Der Trend zum Wahlarzt zeigt, dass diese Attraktivität nicht gegeben ist. Außerdem müssen der kassenärztliche Leistungs- und Honorarkatalog modernen Versorgungserfordernissen Rechnung tragen. Will man die Krankenhäuser entlasten, muss man den niedergelassenen kardiologischen Bereich ausbauen. Wichtig ist es, die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätigkeit in Österreich so attraktiv zu gestalten, dass Ärzte nicht abwandern. Dabei geht es nicht nur um entsprechende Honorare, sondern auch um flexible Verträge und Arbeitsbedingungen.</p> <p><strong>Neuer Leistungskatalog als Basis</strong> <br />Was die Sozialversicherungen und die Gesundheitspolitik betrifft, so besteht mit der Fusion der Gebietskrankenkassen im Rahmen der „Kassenreform“ zu einer Österreichischen Gesundheitskasse und der Bildung einer neuen Bundesregierung eine Umbruchsituation. Dies eröffnet Chancen z. B. zur Modernisierung und Vereinheitlichung des kassenärztlichen Leistungskataloges, der sich über Jahrzehnte auf regionalen Ebenen recht uneinheitlich entwickelt hat. „Unser Ziel ist ein einheitlicher Leistungskatalog für ganz Österreich, damit allen Menschen das Gleiche angeboten werden kann und damit erbrachte Kassenleistungen nicht mehr vom Zufall der Wohnadresse abhängen. Die Bundeskurie Niedergelassene Ärzte arbeitet seit zwei Jahren gemeinsam mit den Bundesfachgruppen und weiteren Fachleuten an diesem Leistungskatalog. Dieser ist, sobald er fertiggestellt ist, der Beitrag der Ärztekammer zur ‚Kassenreform‘ und eine Ausgangsund Verhandlungsbasis für einen völlig neuen und zeitgemäßen Honorarkatalog“, so Steinhart.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Pressegespräch der Österreichischen Kardiologischen
Gesellschaft, 28. November 2019, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Statistik Austria <strong>2</strong> Dagenais GR et al.: Lancet 2019 Sep 3. pii: S0140-6736(19)32007-0 <strong>3</strong> Statistik Austria <strong>4</strong> 1. Österreichischer Patientenbericht zu Herzinsuffizienz, 2018 <strong>5</strong> Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger <strong>6</strong> Kim et al.: ESC Kongress 2019 <strong>7</strong> Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin</p>
</div>
</p>