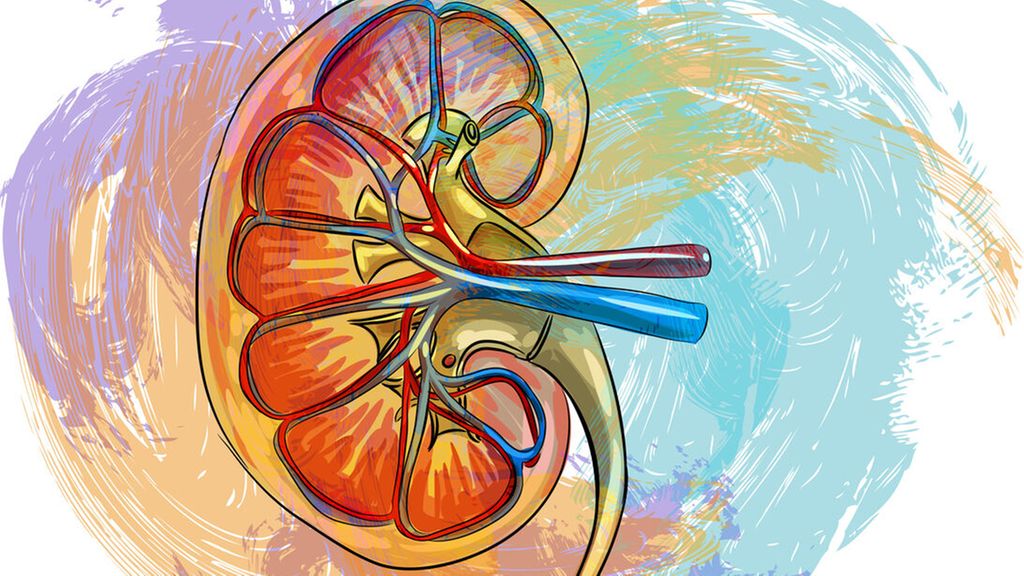.jpg)
Finerenon bereits bei leichter Niereninsuffizienz wirksam
Bericht: Reno Barth
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Der nicht-steroidale Aldosteronantagonist Finerenon reduziert bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerltankung das kardiovaskuläre Risiko. Das wurde in der Studie FIGARO-DKD nun auch für eine Population mit lediglich leicht eingeschränkter Nierenfunktion und/oder Albuminurie gezeigt.
Bei Personen mit Typ-2-Diabetes besteht generell ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Noch weiter erhöht ist dieses Risiko, wenn zusätzlich zum Diabetes eine chronische Nierenerkrakung (DKD) besteht. Dass sich dieses Risiko mit dem nicht-steroidalen Aldosteronantagonisten Finerenon in einer Population von Diabetes-Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung reduzieren lässt, wurde in der Phase-III-Studie FIDELIO-DKD demonstriert.1 Auf Basis von FIDELIO-DKD wurde in den USA, Europa und vielen anderen Ländern die Zulassung von Finerenon beantragt und von der amerikanischen FDA mittlerweile auch erteilt.
Von einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko betroffen sind, so Prof. Dr. Bertram Pitt von der University of Michigan in Ann Arbor, USA, nicht nur schwer nierenkranke Patienten, sondern auch solche mit einer leichten bis moderaten DKD. Dies führt dazu, dass es bei der Mehrheit der von Diabetes und DKD Betroffenen gar nicht zu einer Progression der Nierenerkrankung kommt, weil diese zuvor einen kardiovaskulären Tod sterben.
Wirksamkeit und Sicherheit von Finerenon wurden nun in der Studie FIGARO-DKD in einer Population von Patienten mit Typ-2-Diabetes und leichter bis moderater Nierenerkrankung untersucht. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Hot-Line-Session des virtuellen ESC-Kongresses 2021 präsentiert und simultan im New England Journal of Medicine publiziert.2
In die Studie wurden insgesamt 7437 Patienten in 48 Ländern eingeschlossen und im Verhältnis 1:1 randomisiert mit oralem Finerenon (10 oder 20mg) oder Placebo einmal täglich behandelt. Ausschlussgründe waren unter anderem eine symptomatische Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Auswurffraktion, da diesen Patienten eine Therapie mit einem Mineralkortikoidrezeptor-Antagonisten nicht vorenthalten darf. Darüber hinaus mussten die Patienten in der Screening-Phase einen Kaliumspiegel von maximal 4,8mmol/l aufweisen, da unter Therape mit Finerenon mit einem Kalium-Anstieg um 0,2mmol/l zu rechnen ist. Die Patienten standen unter optimierter RAS Blockade, Diabetes und Blutdruck waren gut eingestellt. Primärer Endpunkt war ein Komposit aus der Zeit bis zum kardiovaskulären Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt, nicht-tödlichem Schlaganfall oder Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz. Pitt betont, dass mehr als 60% der Patienten eine normale eGFR aufwiesen und lediglich wegen Mikro- oder Makroalbuminurie eingeschlossen wurden. Damit inkludiert FIGARO-DKD eine Patientengruppe, die ungeachtet ihres hohen Risikos von der Kardiologie bisweilen weniger Beachtung findet.
Kardiovaskulärer Endpunkt um 13% gesenkt
Der primäre Endpunkt wurde erreicht. Über eine mediane Beobachtungszeit von 2,3 Jahren trat der kombinierte Endpunkt bei 458 (12,4%) der Patienten in der Verum und 519 (14,2%) der Patienten in der Placebo-Gruppe ein. Daraus ergibt sich eine Reduktion des relativen Risikos für Finerenon versus Placebo von 13% für Finerenon versus Placebo (HR 0,87; 95% CI 0,76–0,98; p=0,03). Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz waren um 29% reduziert und damit maßgeblich für das Erreichen des primären Endpunkts.
Auch im Hinblick auf den sekundären renalen Endpunkt, einem Komposit aus Nierenversagen, Abfallen der geschätzen glomerulären Filtrationsrate (eGFR) um 40% sowie renalem Tod erwies sich Finerenon dem Trend nach als wirksam. Von einem renalen Ereignis im Sinne dieses Endpunkts betroffen waren 350 (9,5%) der Finerenon- und 395 (10,8%) der Placebo-Patienten. Für diese Risikoreduktion wurde Signifikanz jedoch knapp verfehlt (HR 0,87; 95% CI: 0,76–1,01; p=0,07). Wurde eine noch deutlichere Reduktion der eGFR um 57% verlangt, so erhöhte sich der Effekt von Finerenon auf 23% und wurde signifikant (HR 0,77; 95% CI: 0,60–0,99). Bei der Stratifizierung nach eGFR sowie nach dem Albumin-Kreatinin Verhältnis im Harn (UACR) ergab sich ein konsistenter Vorteil von Finerenon über alle Subgruppen hinweg.
Die Nebenwirkungsraten waren in den beiden Studienarmen vergleichbar. Hyperkaliämie war unter Finerenon häufiger als unter Placebo, machte jedoch nur bei 1,2% der Verum-Patienten einen Therapieabbruch erforderlich.
Quelle:
ESC-Kongress 2021, The Digital Experience, 27.-30. 8.2021
Literatur:
1 Bakris GL et al.: Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020; 383: 2219-29 2 Pitt B et al.: Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes. N Engl J Med: 10.1056/NEJMoa2110956
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
Neue Wege in der Diagnostik des Vorhofflimmerns
Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung unserer Zeit. Die Folgen reichen von eingeschränkter Lebensqualität und Belastbarkeit bis zu schwerwiegenden Komplikationen wie ...


