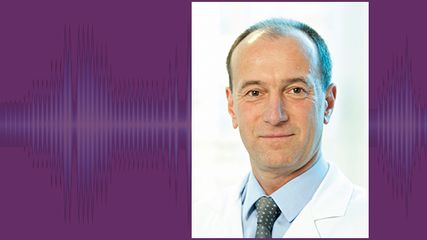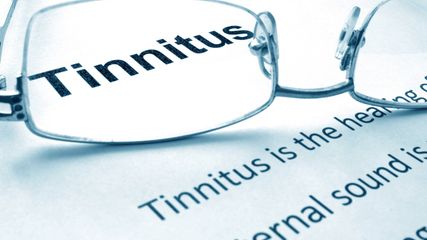„Welche Qualität macht den Unterschied?“
Unser Gesprächspartner:
Prof. Dr. Andreas Dietz
Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-, Ohrenheilkunde
Medizinisch-Wissenschaftlicher Leiter des Departments Kopf- und Zahnmedizin
Universitätsklinikum Leipzig
E-Mail: andreas.dietz@medizin.uni-leipzig.de
Das Interview führte
Dr. Katrin Spiesberger, MSc.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Anlässlich der wegen der Coronavirus-Pandemie zusammengelegten 91. und 92. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. (DGHNO-KHC), die vom 12. bis 16. Mai 2021 in virtueller Form stattfand, sprach JATROS mit dem renommierten HNO-Experten, Past-Präsidenten der DGHNO-KHC und diesjährigen Kongresspräsidenten Prof. Dr. Andreas Dietz, Leipzig.
Nachdem der große, jährlich abgehaltene Kongress der DGHNO-KHC letztes Jahr abgesagt werden musste, wurde das Programm des diesjährigen Kongresses um das Programm des letztjährigen erweitert. Einer der Kongresspräsidenten, Prof. Dr. Andreas Dietz, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde des Universitätsklinikums Leipzig, hielt dabei einen Vortrag im Rahmen des Rundtischgespräches zur Bedeutung der AWMF-Leitlinien in der praktischen HNO-Heilkunde. Wir durften mit ihm über aktuelle Themen, die die DGHNO-KHC derzeit beschäftigen, aber auch über diese wissenschaftlich validierten, von den Arbeitsgemeinschaften der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) herausgegebenen Leitlinien, die in regelmäßigen Abständen adaptiert und dabei auf den neuesten Stand gebracht werden, sprechen.
Sehr geehrter Herr Professor Dietz, vielleicht können Sie zu Beginn unseren Lesern gleich etwas zum diesjährigen Kongress der DGHNO-KHC erzählen?
A. Dietz: Letztes Jahr mussten wir den Kongress ja ersatzlos absagen, da die Zeit für die Umstellung des doch recht umfangreichen Programms auf ein virtuelles Format einfach zu knapp war. Aus der Überlegung heraus, dass uns das Coronavirus so schnell nicht verlassen wird, haben wir heuer einen komplett virtuellen Kongress auf die Beine gestellt und dabei das Programm des letzten Jahres in den diesjährigen Kongress integriert. Deshalb gibt es dieses Jahr – einmalig in der Geschichte der DGHNO-KHC – zwei Kongresspräsidenten. Neben mir ist das Prof. Dr. Stefan Plontke aus Halle an der Saale.
Die großen Themen der 91. und 92.Jahresversammlung sind zum einen das 100-jährige Bestehen unserer Gesellschaft und zum anderen der Aspekt Qualität; die Frage: Welche Qualität macht den Unterschied? Zu diesem Thema sind letztes Jahr Referatsbände entstanden, die einerseits Referate zu Qualitätsbegriffen aus verschiedenen HNO-Perspektiven abbilden, andererseits hat eine freie Journalistin der FAZ die Aspekte Qualität in den Medien, Werbequalität, Darstellung der HNO-Ärzte im Internet etc. beleuchtet. Dieses Jahr hat Herr Plontke die seltenen Erkrankungen in den Fokus gestellt, sodass der Mix aus den beiden Kongressen sicher interessant ist.
Ich selbst stehe eher für die onkologischen Fragestellungen, vertrete die Laryngologie mit Themen, die in die Bereiche Kehlkopf und oberer Aerodigestivtrakt gehen, Herr Plontke ist Spezialist für die Gebiete Innenohr und Mittelohr, und auch damit ergibt sich eine wunderbare Komplementarität in unseren Programmen.
Sie haben als großes Thema der 91. Jahresversammlung die Qualität angesprochen. Wo liegt hier inhaltlich zurzeit Ihr Fokus?
A. Dietz: Ein großes Thema im Bereich der Qualitätssicherung ist die Cochlea-Implantations(CI)-Versorgung. Dazu ist in Zusammenarbeit mit der deutschen Gesellschaft für Phoniatrie ein Weißbuch, also eine Standardisierung, wie wir die Prozesse und die Leistung in der Cochlea-Implantations-Versorgung in Deutschland abbilden wollen, entstanden. Die dazugehörige Leitlinie wurde novelliert, zudem haben wir ein Register eingerichtet, das heuer an den Start geht. Darin können alle CI-Leistungserbringer ihre CI dokumentieren, im zentralen Register erfassen und somit Längsschnittauswertungenermöglichen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung: Gewisse Standards müssen demnach erfüllt werden, wenn man diese Leistung anbietet. Ziel ist – wenn das Register läuft –, dass wir ein Zertifikat an die Zentren vergeben, die Chochlea-Implantationen nach den Standards der Deutschen HNO-Gesellschaft durchführen. Dies ist nun die zweite Qualitätsoffensive nach den Kopf-Hals-Tumor-Zentren, von denen es mittlerweile 60 in Deutschland gibt, die aufgrund gewisser Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft auf den Weg gebracht wurden und sich in den letzten zehn Jahren als sehr stabiler Motor etabliert haben.
Das Thema Qualität bringt uns zu den AWMF-Leitlinien. Worüber habenSie diesbezüglich bei dem Rundtischgespräch im Rahmen des Kongresses referiert?
A. Dietz: Als Leitlinienbeauftragter in meiner Fachgesellschaft durfte ich dazu referieren: Wir haben in Deutschland das Leitliniensystem der Arbeitsgemeinschaften der medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), das von S1 bis S3 geht. Angefangen hat das Ganze vor 15 Jahren mit der Erstellung der ersten S1-Leitlinien. Experten haben dabei versucht, einen Standard auf Basis eines Konsenses zu bilden. Dann gibt es die S2-Struktur und dabei überwiegend die S2k-Leitlinien, wo die Evidenz und Literatur miteinbezogen wird. Die S3-Leitlinien wiederum sind so anspruchsvoll, dass wir hier an Grenzen kommen. In der deutschen onkologischen HNO-Heilkunde gibt es zurzeit drei S3-Leitlinien, zwei davon sind fertig, nämlich die zum Mundhöhlenkrebs, die bereits einmal novelliert wurde, und zum Kehlkopfkrebs, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Dieses Jahr wird unter meiner Leitung eine Pharynx-S3-Leitlinie kommen, in deren Rahmen die Themen Oropharynx und Hypopharynx zusammen betrachtet werden.
Im Unterschied zu den S2k-Leitlinien werden für die Erstellung von S3-Leitlinien Fördergelder beantragt, die standardisierte Reviews zu den Schlüsselfragen finanzieren. Solche werden benötigt, um den Grad der Evidenz zu gewissen Fragen deutlich herauszuarbeiten, sie sind anspruchsvoll und beschäftigen große Gremien. S3-Leitlinien umfassen in der Langversion dann zwischen 140 und 180 Seiten und sind richtungsweisend. Wenn ein behandelnder Arzt die S3-Leitlinien verlässt und es geht in die Hose, dann hat er ein Problem. Denn juristisch kommt es dann fast zu einer Beweisumkehr nach dem Motto: Warum sind Sie von der Leitlinie abgewichen? Obwohl es Gründe, also gewisse Ausnahmen, gibt, sollte man sich im Vorfeld genau überlegen, wenn man den Pfad einer S3-Empfehlung verlässt. Insofern ist das, was wir niederschreiben, ein Stück weit Gesetz zur Behandlung der Tumoren.
Wie stehen Sie persönlich zu solchen „Handlungsvorgaben“ für Ärzte?
A. Dietz: Ich gehöre zu denjenigen, die dies gut finden! Denn es gibt nichts Schlimmeres als den freischaffenden Künstler, der ab und zu auch mal einen Tumor an der Straßenecke behandelt, weil er das irgendwann mal gelernt hat und nun sagt „Ich bin der Arzt, habe die Behandlungsfreiheit und kann machen was ich will“. Dafür bezahlen viele Patienten mit ihrem Leben und daher gibt es einen großen Konsens in der Fachgesellschaft: Man ist dankbar für diese Leitlinien, die einen ja auch ein Stück weit schützen.
Und für die Patienten ist es natürlich großartig, denn sie können alles offen im Netz nachlesen. Dadurch hört auch diese schwierige Debatte von der einen oder anderen Seite auf, die entsteht, wenn ein Patient von irgendeinem Arzt eine gottgleiche Einzelmeinung erzählt bekommt. Die Leitlinien helfen dabei, eine gewisse Objektivität reinzubringen. Trotz allem bin ich ein großer Freund von Zweitmeinungen. Denn das eine ist, was inhaltlich angeboten wird, also die objektive Behandlungsqualität, das andere ist, wie der Arzt mit seinem Patienten umgeht, wie bindet er ihn, wie gibt er ihm die Kraft und das Vertrauen in sein Handeln, um gesund zu werden. Da kann einer fachlich so gut sein, wie er will, wenn er den Patienten nicht abholt, ist es schwierig, und dabei können auch solche Leitlinien nicht helfen.
Sie haben die zertifizierten Zentren erwähnt, die nach bestimmten Kriterien behandeln müssen. Wie funktioniert diese Zertifizierung, wird das auch außerhalb Deutschlands so gehandhabt?
A. Dietz: Um als Behandlungszentrum zertifiziert werden zu können, muss im Vorfeld ein Gremium aus einer bestehenden S3-Leitlinie zehn Qualitätsindikatoren definieren, die unabdingbar sind, um eine leitliniengerechte Behandlung zu ermöglichen. Anhand dieser Indikatoren überprüfen und beurteilen Auditoren die Behandlungsqualität an den Zentren und entscheiden, ob sie ein Zertifikat bekommen bzw. behalten dürfen oder nicht.
In den Niederlanden hat sich dieses System z.B. schon soweit durchgesetzt, dass nur mehr die acht zertifizierten onkologischen Zentren Krebspatienten behandeln dürfen bzw. die Krankenkasse nur Behandlungskosten übernimmt, die in diesen Zentren entstanden sind. Das erklärt vielleicht die europaweit besten Ergebnisse in der onkologischen Behandlung. Österreich, das meines Wissens nach auch ein nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes Zentrum unter der Leitung von Prof. Burian aus Linz hat, und Deutschland stehen hier auch nicht schlecht da, die Niederländer führen jedoch.
Vor allem im Hinblick auf die neuen Immun-Onkologika, die unglaublich teuren Checkpoint-Inhibitoren, deren Einsatz die gesundheitsökonomischen Ressourcen massiv beansprucht, macht es natürlich Sinn, dass die Indikationsstellung einer solchen Therapie in einem spezialisierten Zentrum erfolgt. Außerdem werden an solchen Zentren auch mehr Patientenstudien durchgeführt, die im HNO-Bereich eher unpopulär sind. Da Zahlen belegen, dass Zentren, die Patientenstudien durchführen, insgesamt ein besseres Outcome vorweisen können, muss man als zertifiziertes Zentrum mindestens 10% Patientenstudien einbringen.
Wie sieht die Zusammenarbeit der deutschen Gesellschaften mit den österreichischen aus? Gibt es Kooperationen, Überschneidungen?
A. Dietz: Ja! Wir pflegen engste freundschaftliche Beziehungen zu den österreichischen Kollegen, es gibt sogar zwei korrespondierende Mitglieder der Deutschen HNO-Gesellschaft, die wir dieses Jahr geehrt haben, das sind Prof. Dietmar Thurnher, Leiter der klinischen Abteilung für allgemeine HNO in Graz, und Prim. Wolfgang Elsäßer, Leiter der HNO-Abteilung am LKH Feldkirch. Ich bin zudem auch Ehrenmitglied der Österreichischen HNO-Gesellschaft, worauf ich sehr stolz bin, denn es gibt viele exzellente Kollegen in Österreich.
Aber vor allem auch im Fachbereich der Kopf-Hals-Tumoren gibt es eine sehr gute Vernetzung. In diesem Bereich haben die österreichischen Kollegen z.B. eine eigene Gesellschaft, die Österreichische Gesellschaft für Kopf- und Halstumoren, kurz ATHNS, gegründet. Ähnlich wie die IAG-KHT, die interdisziplinäre Arbeitsgruppe bei Kopf-Hals-Tumoren, die unter dem Dach der Deutschen Krebsgesellschaft läuft und der ich vorstehe, ist auch die ATHNS interdisziplinär ausgelegt und hat mit Prof. Füreder aus Wien, Prof. Thurnher aus Graz und natürlich Prof. Burian aus Linz führende Experten mit an Bord. Diese Gruppe ist auch international sichtbar, hat z.B. einen virtuellen Fortbildungskongress mit einer sehr hohen Einwahlrate organisiert. Sie blicken immer über den Tellerrand und haben hochkarätige Gäste dabei.
Im Vergleich zu den deutschen Kongressen sind die österreichischen natürlich kleiner, was auch der geringeren Einwohnerzahl geschuldet ist. Nichtsdestotrotz gehen die Deutschen sehr gern auf die österreichischen HNO-Kongresse, weil die einfach persönlicher sind. Was mir persönlich gefällt: Die Österreicher sind sehr pragmatisch und auch die Diskussionskultur gestaltet sich etwas anders. Man kann sich auch widersprechen oder diskutieren, ohne dass dies das freundschaftliche Miteinander beeinträchtigen würde.
In Ihrem Vortrag kam ja auch die Covid-Taskforce vor. Können Sie uns abschließend dazu noch etwas erzählen?
A. Dietz: Die Covid-Taskforce ist eine Vereinigung, die sich im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften der medizinischen Fachgesellschaft gegründet hat. Ich selbst bin hier federführend; zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und weiteren 15 Fachgesellschaften haben wir eine der ersten S1-AWMF-Leitlinien zu Covid-19 herausgebracht.
Es ging dabei darum, dass man den HNO-Kliniken den Saft abgedreht hat, alles Planbare wurde nicht mehr erbracht, um Platz zu schaffen für die Covid-19-Intensivpatienten. Vielen HNO-Ärzten in den Kliniken wurde damit die Arbeitsgrundlage entzogen. Wir haben daraufhin versucht, zumindest das elektive Geschäft wieder hochzufahren, und vor diesem Hintergrund eine Leitlinie dazu gemacht. Diese führte dazu, dass das Testen – die Essenz der Leitlinie – von Gesundheitsminister Spahn in die neueste Verordnung vom August aufgenommen wurde. Denn bis dahin wurde das Testen von asymptomatischen Patienten nicht finanziert. Mittlerweile ist das ja gegessen, jeder lässt sich vor dem Friseurbesuch etc. testen, und so machen wir das bis heute. Mit den Impfungen sollte sich das Testen irgendwann erübrigen, ich glaube jedoch, dass wir noch lange testen werden. Bis zur Herdenimmunität ist es ein weiter Weg, es gibt immer noch genug Impfgegner, auf die wir achten müssen – das Thema wird noch lange präsent sein.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann
Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...
„Ein wichtiges Projekt ist die bedingungslose Unterstützung des HPV-Impfprogrammes“
Wir sprachen mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Burian, Abteilungsleitung HNO, Kopf- und Halschirurgie im Ordensklinikum Linz, über seine Ziele als Präsident der HNO-Gesellschaft, aktuelle ...
Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Vorgehen bei chronischem Tinnitus
Für Tinnitusbetroffene, die sich durch das Ohrgeräusch psychisch belastet und in ihrer Lebensqualität eingeschränkt fühlen, hat sich die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) als wirksamer ...