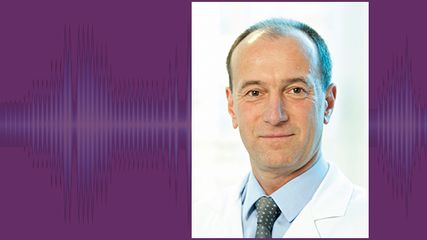Osia System: erste Erfahrungen mit einem neuen Knochenleitungsimplantat
Autoren:
OA Dr. Wendelin Wolfram
Prim. Dr. Thomas Keintzel
Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Klinikum Wels-Grieskirchen
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Für die Versorgung von kombinierten Schwerhörigkeiten existieren verschiedene implantierbare Hörsysteme wie die aktiven Mittelohrimplantate (z.B. Vibrant Soundbridge) und die passiven und aktiven Knochenleitungshörsysteme. Wir berichten über die ersten sehr positiven Erfahrungen mit dem Osia System und den Knochenleitungsimplantaten OSI200 bzw. OSI300, über die Indikationsbereiche und darüber, wie die Implantation gelingt.
Keypoints
-
Das OSI300 Implantat ist eine Erweiterung der Palette der bekannten knochenverankerten Hörimplantate und kommt vor allem bei Patienten mit kombinierter Schwerhörigkeit und zunehmender Innenohrschwäche zum Einsatz.
-
Insbesondere Cholesteatompatienten mit Radikalhöhle haben nun eine einfache Möglichkeit für eine Versorgung über die Verankerung des Implantates im Schläfenbein, ebenso Patienten mit einem sehr kleinen Mastoid.
-
In den letzten zwei Jahre haben wir OSI200 bzw. 300 mehrfach implantiert und die Daten von 11 Patienten ausgewertet.
-
Es kam zu einer deutlichen Verbesserung des Einsilberverstehens im Freifeld mit dem OSIA Implantat im Vergleich mit der konventionellen Hörgeräteversorgung.
Überblick
Aktive und passive Knochenleitungsimplantate sind eine optimale Therapie für Patienten mit einer Schallleitungsschwerhörigkeit oder kombinierten Schwerhörigkeit, die mit konventionellen chirurgischen Methoden nicht ausreichend hörversorgt werden können. Darunter fallen Patienten mit Gehörgangsatresien oder Stenosen, Fehlbildungen des äußeren Ohres und Gehörgangs oder Sklerosierungen des Mittelohrs, aber auch Patienten nach Tympanoplastiken ohne zufriedenstellende Verbesserung der Schallleitungskomponente. Passive Knochenleitungsimplantate sind Patienten vorbehalten, die eine physiologische Innenohrleistung haben und bei denen lediglich die Schallübertragung nicht ausreichend möglich ist. Hingegen stellen bei einer kombinierten Schwerhörigkeit mit verminderter Innenohrleistung lediglich aktive Implantate eine ausreichende Versorgung sicher.
Derzeit sind als aktive transkutane Knochenleitungsimplantate die BoneBridge (Fa. MedEl) der Firma MedEl und das Osia System mit dem OSI200 bzw. OSI300 Implantat (Fa. Cochlear) verfügbar. Während die Bonebridge (BB) bereits seit Jahren implantiert wird und sich bis 45db Innenohrschwelle bewährt hat, ist das OSI Implantat seit 2022 auf dem Markt und kann durch den piezoelektrischen Aktuator bis zu einem durchschnittlichen Innenohrhörverlust bis 55db HL („hearing level“) implantiert werden. Zur Eignung für eines der beiden Implantate ist auch der vorhandene Knochen des Schläfenbeins bzw. des Mastoids ausschlaggebend. Bei beiden Versorgungsmodi muss der Aktuator unter der Haut platziert werden und direkten Knochenkontakt haben. Die BoneBridge braucht dafür ein relativ großes Mastoid, in das sie 4,5mm versenkt wird, oder sie muss direkt am Sinussigmoideus platziert werden. Für das OSI Implantat hingegen muss eine Titanschraube 3,75mm in den Knochen des Schläfenbeins implantiert werden, an die der piezoelektrische Aktuator angeschraubt wird. Der Unterschied zwischen dem OSI200 und dem OSI300 Implantat ist, dass die mögliche Feldstärke für MRT-Untersuchungen für das OSI200 1,5Tesla beträgt und für das neuere OSI300 3Tesla. Die BoneBridge ist bis 1,5Tesla MR-tauglich.
Kontraindikation für die Versorgung mit den OSI Implantaten ist eine ungenügende Knochendicke des Schläfenbeins, da die Schraube vollständig im Knochen versenkt sein muss. Ebenso ist eine rasch progredienteInnenohrschwerhörigkeit als Gegenanzeige zu sehen, da hier der Patient den Benefit bei Überschreiten der 55-db-HL-Schwelle verlieren würde. Hauterkrankungen, wie chronische Ekzeme der Kopfhaut, die das Tragen des Audioprozessors über dem Implantat verhindern würden, sind als relative Kontraindikationen zu sehen. Für Patienten, die eine regelmäßige MRT des Kopfes benötigen, muss geklärt werden, ob hierbei Artefakte auf der implantierten Seit des Kopfes ein Problem darstellen. Dies gilt für alle Knochenleitungsimplantate.
Diagnostik
Es muss vor der Implantation die audiologische Abklärung erfolgen, ob eine kombinierte oder konduktive Schwerhörigkeit vorliegt, die wie oben angegeben versorgbar ist. Präoperativ muss eine CT des Felsenbeins durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Tiefe des Knochenbetts von mindestens 3,75mm für die OSI-Schraube vorhanden ist. Für die Planung der Position in einer möglichst planen Ebene ist das CT ebenfalls hilfreich.
Operation
Der Eingriff erfolgt in Allgemeinanästhesie, ein Operationsmikroskop sollte vorhanden sein, wird aber zumeist nicht benötigt. Die Platzierung erfolgt retroaurikulär und erfordert das Bilden eines Muskel-/Hautlappens, unter welchem das Implantat eingebracht werden kann. Hierfür werden verschiedene Schnittführungen empfohlen (Abb.1), an unserer Abteilung hat sich der horizontale Hautschnitt unterhalb der gewünschten Position bewährt. Die möglichst plane Positionierung des OSI Implantats ist essenziell, um einen hohen Tragekomfort zu erreichen und die Gefahr einer Extrusion des Implantates möglichst gering zu halten. Dieses Risiko lässt sich durch die möglichst weit posteriore Platzierung und den horizontalen Hautschnitt zum Bilden der Implantattasche minimieren, das relativ große Implantat wird von den Patienten nach wenigen Wochen postoperativ als nicht störend empfunden. Nach der Fixierung des Implantates wird der primäre Wundverschluss durchgeführt und am Folgetag wird der Patient entlassen.
Abb. 1: Schnittführung für das OSI300 (Quelle: Deep NL et al.: The Laryngoscope 2022; 132(9): 1850-4)
Drei Wochen postoperativ erfolgen die Erstanpassung und Einstellung des Audioprozessors, ab dann werden die Patienten bedarfsweise zur Nachjustierung und eventuellen Problemlösung bestellt.
Audiologische Ergebnisse
Im Verlauf der letzten zwei Jahre haben wir bereits bei über 16 Patienten die OSI200 bzw. OSI300 Implantate gesetzt und zu 11 davon die Daten gesammelt und ausgewertet (Tab.1). Insgesamt ergibt sich ein audiologisch sehr zufriedenstellendes Bild, das auch im klinischen Kontakt mit den Patienten bestätigt werden kann. Durch die direkte Übertragung über die Knochenleitung kam es zu einer deutlichen Verbesserung des Einsilberverstehens im Freifeld durch die Versorgung mit dem Osia System im Vergleich mit einer konventionellen Hörgeräteversorgung (Abb. 2).
Literatur:
bei den Verfassern
Das könnte Sie auch interessieren:
Österreichs HNO-Abteilungen: Teil 2
Auch in dieser Ausgabe möchten wir – als offizielles Medium der Österreichischen HNO-Gesellschaft – den heimischen HNO-Abteilungen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen sowie ...
„Ein wichtiges Projekt ist die bedingungslose Unterstützung des HPV-Impfprogrammes“
Wir sprachen mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Burian, Abteilungsleitung HNO, Kopf- und Halschirurgie im Ordensklinikum Linz, über seine Ziele als Präsident der HNO-Gesellschaft, aktuelle ...
Tonsillopharyngitis: Entscheidungsfindung und Patientenorientierung
Akute Halsschmerzen gehören zu den häufigsten Beratungsanlässen in der allgemeinärztlichen und HNO-ärztlichen Praxis. Die aktuelle S3-Leitlinie „Therapie der akuten Tonsillo-Pharyngitis ...