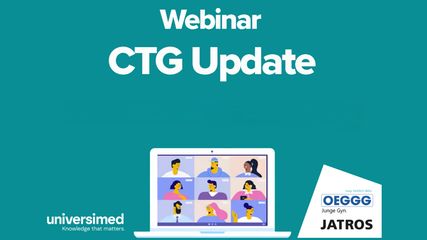©
Getty Images/iStockphoto
Radikalität von Operationen bei Ovarial- und Zervixkarzinomen
Jatros
30
Min. Lesezeit
05.10.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Im Rahmen der Hauptsitzung Onkologie am OEGGG-Kongress wurden bisherige Erkenntnisse und der Status quo bei Operationsverfahren und Therapien von Beckenmalignomen präsentiert. Als wesentliches Highlight galten definitiv die Ergebnisse der LION-Studie zur systematischen Lymphadenektomie (LNE) beim Ovarialkarzinom (OC), die sich als „practice changing“ erwiesen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>„Selten ist es in unserem Fach der Fall, dass sich wirklich bahnbrechende Veränderungen ergeben. Heute – erst zwei Wochen nach dem ASCO-Kongress – werden erstmals in Europa Ergebnisse von zwei Studien präsentiert, die neue Aspekte in der gynäkologischen Onkologie eröffnen“, so die einleitenden Worte von Univ.-Prof. Dr. Christian Marth, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Medizinische Universität (MU) Innsbruck, der gemeinsam mit Prof. Dr. Sven Mahner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universität München, den Vorsitz der Onkologie- Session bei der OEGGG-Tagung 2017 innehatte.</p> <h2>LION – Lymphadenektomie bei OC</h2> <p>Der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Durchführung einer primären LNE beim OC wird bereits seit Längerem nachgegangen, bislang konnten jedoch keine aussagekräftigen Antworten gefunden werden. So wurde 2005 in einer zu dieser Thematik präsentierten Studie, die untersuchte, welche Auswirkung die Durchführung einer LNE im Vergleich zum Verzicht auf LNE bei 427 Patientinnen mit OC in den FIGO-Stadien IIB–IV hatte, zwar ein Vorteil beim progressionsfreien Überleben (PFS) durch LNE nachgewiesen, nicht aber beim Gesamtüberleben (OS).<sup>1</sup> „Diese Studie wies einige Schwachpunkte auf. U.a. waren auch Patientinnen mit intraperitonealen Tumorresten bis 1cm eingeschlossen, d.h., die Ergebnisse waren von Patientinnen getriggert, deren Krankheit grundsätzlich schon einen schlechteren Verlauf aufweist“, kommentierte Prof. Dr. Andreas du Bois, Direktor der Klinik für Gynäkologie und gynäkologische Onkologie, Kliniken Essen-Mitte, die Resultate. Aus diesem Grund wurde daraufhin eine Reanalyse der mehr als 3000 Patientinnen umfassenden Metadatenbank der AGO durchgeführt. Die Ergebnisse lieferten erstmals den Beweis, dass die systematische LNE bei Patientinnen mit makroskopischen Tumorresten ≥1cm Durchmesser im Vergleich zu LNE bei jenen ohne Tumorreste zu keinen signifikanten Effekten führt.<sup>2</sup> Diese Erkenntnisse waren gewissermaßen Hypothesen-generierend und lieferten die Rationale für die Durchführung der prospektiv randomisierten Studie LION<sup>3</sup>, in OC-Patientinnen in den FIGOStadien IIB–IV eingeschlossen werden konnten. Ausschlusskriterien waren das Vorliegen makroskopischer extra- oder intraabdomineller Tumorresiduen sowie palpable „bulky“ (keine radiologisch oder klinisch auffällige) Lymphknoten (LK).<br /> Zu den koprimären Endpunkten zählten das OS und das PFS. Erstmals war bei dieser Studie eine Zentrenqualifizierung Voraussetzung für die Teilnahme, d.h., interessierte Zentren mussten nachweisen, dass sie die LNE beherrschen – sowohl in Bezug auf das Ausmaß der Erfahrung als auch durch Bestätigung mittels des Nachweises von histologischen Befunden und Operationsberichten.<br /> Nur Patientinnen, die nach der Operation tumorfrei waren (OP; weder Tumorreste noch klinisch oder radiologisch auffällige LK), konnten eingeschlossen und zur pelvinen und paraaortalen systematischen LNE bzw. zu keiner LNE randomisiert werden. „In der Studie ging es also nur um die Frage nach der Komplettierung einer scheinbar kompletten OP“, subsumierte du Bois. In der LNE-Gruppe wurden im Median 57 LK entfernt, dabei wurden bei 56 % der Patientinnen mikroskopische Metastasen entdeckt.<br /> Das mediane PFS war zwischen den Gruppen nicht unterschiedlich (26 Monate in beiden Armen) und auch hinsichtlich des OS konnten keine Unterschiede zugunsten der LNE festgestellt werden (26 vs. 29 Monate; p=0,65).<br /> Gleichzeitig dauerte im LNE-Arm die Operation länger (+ 1 Stunde), der Blutverlust der Patientinnen war höher (+ 150ml), sie benötigten mehr Transfusionen und „fresh-frozen“ Plasma und mussten häufiger auf der Intensivstation betreut werden. Ebenso waren die Morbiditäts- und Mortalitätsraten höher.<br /> Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass bei 56 % der Patientinnen positive LK detektiert und reseziert worden waren, konnte weder ein OS- noch ein PFS-Benefit durch die Durchführung einer LNE erzielt werden. Es sollte demnach auf eine systematische LNE verzichtet werden, auch um die postoperative Morbidität und Mortalität zu reduzieren.<sup>3</sup><br /> „Diese Ergebnisse werden die klinische Praxis verändern und die Leitlinien müssen dahingehend adaptiert werden. Zudem kann daraus abgeleitet werden, dass Patientinnen, die in spezialisierten Zentren behandelt werden, eine exzellente Prognose aufweisen. Das Erreichen eines medianen OS von 67 Monaten bei fortgeschrittenem OC ist ziemlich gut!“, resümierte du Bois.</p> <h2>Stellenwert der Reoperation bei rezidiviertem OC</h2> <p>Die DESKTOP-Serie ist eine Studienreihe, die bereits seit vielen Jahren läuft und deren Ziel darin besteht, den Stellenwert einer Rezidiv-OP bei OC-Patientinnen systematisch zu analysieren. DESKTOP I war eine retrospektive Untersuchung, in der ein Score generiert wurde, der zur Selektion jener Patientinnen beitragen könnte, bei denen durch eine Rezidiv- OP eine Tumorfreiheit erzielt werden kann. Drei präoperative Variablen (Ergebnis der Erst-OP bzw. Tumorstadium bei unbekanntem Tumorrest, Allgemeinzustand, Vorliegen von Aszites) wurden identifiziert, die es ermöglichen sollten, mit einer 95 % igen Wahrscheinlichkeit bei zwei von drei Patientinnen die Realisierbarkeit einer Komplettresektion vorherzusagen.<sup>4</sup> In der Studie DESKTOP II wurde dieser Score dann erfolgreich validiert, d.h., die in DESKTOP I generierte Hypothese zur Vorhersagbarkeit wurde bestätigt. Insgesamt wurde eine Komplettresektionsrate von 76 % erzielt.<sup>5</sup> „Die Idee, diesen Score zu entwickeln, kam mir, weil ich es als unethisch erachten würde, Patientinnen mit einem Rezidiv zu operieren, die möglicherweise gar nicht davon profitieren“, erläuterte du Bois.<br /> Um dieses Konzept weiter zu untersuchen und sicherzustellen, dass nur jene operiert werden, die eine Chance auf eine Komplettresektion haben, wurde die Phase- III-Studie DESKTOP III initiiert, deren Ergebnisse ebenfalls am diesjährigen ASCO-Kongress präsentiert wurden. Auch an dieser Studie durften nur spezialisierte Zentren teilnehmen. 408 Patientinnen mit einem platinsensitiven OC-Rezidiv, die gemäß dem Score-Ergebnis infrage kamen, wurden zur Durchführung einer zytoreduktiven OP mit anschließender platinbasierter Chemotherapie (CTx) bzw. zur sofortigen CTx ohne OP randomisiert. Die Rate an makroskopisch kompletten Resektionen betrug 72,5 % , auch hiermit wurde der Score bestätigt. „Eigentlich war es unser Ziel, beim ASCO-Kongress bereits die OS-Kurven zu präsentieren. Das war deswegen nicht möglich, weil wesentlich bessere Verläufe verzeichnet wurden, als wir erwartet hatten: Die gepoolten Ergebnisse zum 2-Jahres-OS belaufen sich auf 83 % und übersteigen somit deutlich unsere initialen Schätzungen von 55 % “, berichtete du Bois. Die finale Analyse zum primären Endpunkt, dem OS, wird erst nach einer weiteren Nachbeobachtung erfolgen.<br /> Die Ergebnisse in Bezug auf das PFS fielen eindeutig zugunsten der OP-Gruppe aus: Das mediane PFS betrug im Vergleich zur Gruppe ohne OP 19,6 vs. 14,0 Monate (p<0,001). Aus den Ergebnissen geht dabei klar hervor, dass der PFS-Benefit eindeutig aus jener Patientengruppe resultiert, bei der eine komplette chirurgische Resektion erzielt worden ist: Hier lag das mediane PFS sogar bei 21 Monaten (vs. 13,7 in der Gruppe ohne komplette Zytoreduktion; p<0,0001)<sup>6</sup> (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Gyn_1704_Weblinks_gyn_1704_seite_16_abb1.jpg" alt="" width="1455" height="946" /></p> <p>Diese Ergebnisse bestätigen erneut, dass eine Rezidiv-OP nur bei Erzielen einer Tumorfreiheit zu einer Verbesserung der Outcomes führt. Unter allen Studien in diesem Setting ist DESKTOP die bisher positivste.</p> <h2>Zervixkarzinom: radikale Hysterektomie immer erforderlich?</h2> <p>Beim Zervixkarzinom geht der Trend dahin, die Radikalität nach Möglichkeit zu reduzieren. „Während es im FIGO-Stadium IA relativ gut etabliert ist, dass eine simple Hysterektomie (HE) bzw. bei Fertilitätserhalt eine Konisation ausreicht, geht es darum, jene Patientinnen zu identifizieren, die ein substanzielles Risiko für eine Lymphknotenmetastasierung haben, und dieses dann operativ abzuklären“, erklärte Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Christoph Grimm, Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie, Medizinische Universität Wien.<br /> Gegenwärtig wird in der Phase-IIIStudie SHAPE (NCT01658930) bei Patientinnen mit Zervixkarzinomen in den Stadien IA2 und IB1 die simple vs. die radikale HE untersucht. Die Rekrutierung läuft allerdings schleppend – zum Zeitpunkt von Grimms Präsentation waren erst 350 der geplanten 700 Patientinnen eingeschlossen.<br /> „Angesichts der Zunahme des Alters von Erstgebärenden spielt der Fertilitätserhalt eine immer wichtigere Rolle. Wir diagnostizieren immer mehr Zervixkarzinome bei Frauen, die die Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben“, berichtete Grimm.<br /> In der Studie CoNteSSA soll die fertilitätserhaltende OP nach Verabreichung einer neoadjuvanten CTx (NAC) bei Patientinnen ≤40 Jahren im Stadium IB1 mit einer Tumorgröße von 2–4cm untersucht werden. Leider konnte die Studie bisher aufgrund des Ausbleibens der Finanzierung noch nicht beginnen.<br /> Bislang konnte für die Gabe einer NAC bei Zervixkarzinom keine Evidenz generiert werden. Interessant könnten diesbezüglich die Ergebnisse der Phase-III-Studie EORTC 55994 (NCT00039338) zur NAC, gefolgt von einer radikalen HE (explorativer Arm) vs. Radio-CTx (Kontrollarm), sein. Die Rekrutierung wurde bereits 2014 abgeschlossen, die Ergebnisse werden aber erst für 2019 erwartet.<br /> „Die Frage, ob in den FIGO-Stadien IA bis IB immer eine radikale HE durchgeführt werden muss, kann jetzt schon klar mit Nein beantwortet werden. Die Ergebnisse der Studie SHAPE führen eventuell zu einer weiteren Reduktion der Zahl der radikalen HE bei Tumoren bis zu 2cm“, so Grimms Schlussworte.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: OEGGG-Jahrestagung, 14.–17. Juni 2017, Wien; Hauptsitzung
Onkologie – Beckenmalignome, 15. Juni
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Benedetti Panici P et al.: Systematic aortic and pelvic lymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized clinical trial. J Nat Cancer Inst 2005; 97: 560-5 <strong>2</strong> du Bois A et al.: Potential role of lymphadenectomy in advanced ovarian cancer: a combined exploratory analysis of three prospectively randomized phase III multicenter trials. J Clin Oncol 2010; 28: 1733-9 <strong>3</strong> Harter P et al.: LION: lymphadenectomy in ovarian neoplasms – a prospective randomized AGO study group led gynecologic cancer intergroup trial. ASCO 2017; Abstract #5500 <strong>4</strong> Harter P et al.: Surgery in recurrent ovarian cancer: the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie (AGO) DESKTOP OVAR trial. Ann Surg Oncol 2006; 13: 1702-10 <strong>5</strong> Harter P et al.: Prospective validation study of a predictive score for operability of recurrent ovarian cancer: the Multicenter Intergroup Study DESKTOP II. A project of the AGO Kommission OVAR, AGO Study Group, NOGGO, AGO-Austria, and MITO. Int J Gynecol Cancer 2011; 21: 289-95 <strong>6</strong> du Bois A et al.: Randomized controlled phase III study evaluating the impact of secondary cytoreductive surgery in recurrent ovarian cancer: AGO DESKTOP III/ENGOT ov20. ASCO 2017; Abstract #5501</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Webinar „CTG-Update“
Webinar „CTG-Update“ mit Dr. Elisabeth D’Costa: Aktuelle Leitlinien, praxisnahe Tipps und neue Standards kompakt zusammengefasst. Jetzt ansehen und Wissen auffrischen!
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...
Was brauchen Mädchen für eine selbstbewusste Sexualität?
Die Entwicklung der eigenen Sexualität ist zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Manchen Mädchen fällt es jedoch nicht leicht, ihre Sexualität selbstbewusst und selbstbestimmt zu ...