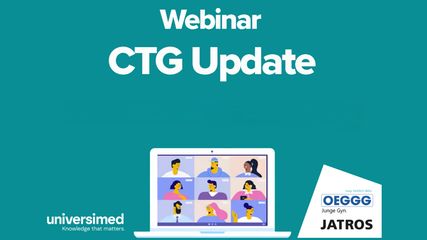©
Getty Images/iStockphoto
Individuelle Beratung und Therapie
Jatros
30
Min. Lesezeit
14.07.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Österreichische Menopausegesellschaft und die Österreichische Gesellschaft für Sterilität, Fertilität & Endokrinologie haben gemeinsam ein Konsensuspapier veröffentlicht, das den Frauenärzten Hilfestellung bei der Behandlung ihrer Patientinnen in den Wechseljahren gibt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Als die Hormonersatztherapie (HRT) vor rund 20 Jahren zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden eingeführt wurde, galt sie zunächst als „Wundermittel“. Sie versprach, Symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Veränderungen der Schleimhäute, der Haut und Haare sowie auch negative Langzeitfolgen der Wechseljahre, etwa Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Etwa fünf Jahre später kamen die Ergebnisse der WHI-Studie aus den USA und mit ihnen die Ernüchterung: Die mit einer HRT behandelten Frauen hatten im Vergleich zu unbehandelten Gleichaltrigen ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs, Herzinfarkt und Schlaganfälle. Die HRT geriet in Verruf; Millionen von Frauen sowie ihre Ärzte waren verunsichert und setzten die Therapie ab.<br /> <br /> Heute, zehn Jahre danach, sieht die Erkenntnislage wieder ganz anders aus.<sup>1</sup> Deshalb haben die Österreichische Menopausegesellschaft und die Österreichische Gesellschaft für Sterilität, Fertilität & Endokrinologie ein gemeinsames Konsensuspapier zur menopausalen Hormontherapie (MHT), wie sie heute genannt wird, veröffentlicht.<sup>2</sup> In einer Pressekonferenz zu diesem Anlass stellte Prof. Hans-Christian Egarter, Wien, die aktuellen Erkenntnisse zur MHT vor.</p> <h2>Grundlagen der Hormonersatztherapie</h2> <p>Laut Egarter leidet etwa ein Drittel der Frauen in den Wechseljahren unter massiven Beschwerden und ein weiteres Drittel unter moderaten Symptomen. Diese können bis zu 15 Jahre andauern. Am häufigsten werden Hitzewallungen und Schlafstörungen berichtet, die die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen können. Die Einnahme von Östrogen kann die Beschwerden lindern oder ganz beheben. Daher war die HRT bis zur Veröffentlichung der WHI-Ergebnisse die Standardtherapie in den Wechseljahren.<br /> <br /> Egarter erklärte, dass die WHI-Studie verschiedene Schwächen hatte, die ihre Resultate beeinflussten. So hatten die Frauen zum Beispiel eine Kombination aus Östrogen und synthetischem Progesteron erhalten, die mit der beschriebenen Risikosteigerung einherging. Die Einnahme von reinem (konjugiertem) Östrogen oder Kombinationen aus Östrogen und natürlichem Progesteron beziehungsweise Dydrogesteron erhöht dagegen weder das Brustkrebs- noch das kardiovaskuläre Risiko.<br /> <br /> Ein weiterer Kritikpunkt an der WHI war das Alter der teilnehmenden Frauen. Egarter betonte, dass rund 70 % bei Beginn der HRT bereits älter als 60 Jahre waren und viele davon wegen Vorerkrankungen gar keine Hormontherapie hätten erhalten dürfen. Bei einem frühen Therapiebeginn (innerhalb von zehn Jahren nach Einsetzen der Menopause) unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils der Frau sei das Risiko des Eintretens unerwünschter Wirkungen jedoch gering.</p> <h2>Empfehlungen der aktuellen Leitlinien</h2> <p>Die aktuellen Leitlinien zur menopausalen Hormontherapie berücksichtigen die neuen Erkenntnisse und empfehlen,</p> <ul> <li>die Therapie stets an den körperlichen und psychischen Symptomen der Frau auszurichten.</li> <li>mit der niedrigstmöglichen Dosis zu beginnen und diese an die Beschwerden anzupassen.</li> <li>wegen ihres guten Sicherheitsprofils Dydrogesteron oder mikronisiertes Progesteron einzusetzen.</li> <li>innerhalb von zehn Jahren nach Beginn der Menopause und besonders vor dem 60. Lebensjahr mit der Therapie zu beginnen („window of opportunity“).</li> <li>bei Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, keinesfalls eine HRT anzuwenden, da die derzeitige Datenlage dagegenspricht.</li> </ul> <p>In seinem Resümee betonte Egarter, dass die MHT noch immer die wirksamste Behandlung von Wechseljahr­beschwerden ist. Wenn die Therapie an die Bedürfnisse und das individuelle Risikoprofil der Patientin angepasst werde, dann überwiege der Nutzen der MHT ihre Risiken. Wichtig sei der frühe Einsatz der Therapie („window of opportunity“).</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Hodis HN et al: Vascular effects of early versus late postmenopausal treatment with estradiol. N Engl J Med 2016; 374: 1221-31<br /><strong>2</strong> Egarter C et al: Österreichisches Konsensuspapier Hormonersatztherapie. Consensus Update April 2016; Medahead</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Webinar „CTG-Update“
Webinar „CTG-Update“ mit Dr. Elisabeth D’Costa: Aktuelle Leitlinien, praxisnahe Tipps und neue Standards kompakt zusammengefasst. Jetzt ansehen und Wissen auffrischen!
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...
Was brauchen Mädchen für eine selbstbewusste Sexualität?
Die Entwicklung der eigenen Sexualität ist zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Manchen Mädchen fällt es jedoch nicht leicht, ihre Sexualität selbstbewusst und selbstbestimmt zu ...