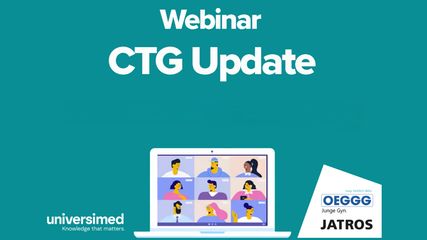©
Getty Images/iStockphoto
Die gynäkologische Praxis im Fokus
Jatros
30
Min. Lesezeit
05.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Vom 30. Mai bis 2. Juni hatten die österreichischen Gynäkologinnen und Gynäkologen Gelegenheit, sich beim Jahreskongress der OEGGG in Salzburg über aktuelle Entwicklungen in ihrem Fachgebiet zu informieren, ihr Wissen zu vertiefen und sich auszutauschen. Das Themenspektrum war weit gefasst und zielte mit praxisrelevanten Vorträgen und Seminaren vor allem auf die Niedergelassenen und die täglichen Anforderungen an sie.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Update HPV-Screening</h2> <p>Eine der Hauptsitzungen befasste sich mit aktuellen Entwicklungen beim humanen Papillomavirus (HPV). Prof. Andreas Widschwendter, Innsbruck, gab ein Update zum HPV-Test beim Zervixkarzinom- Screening. Die beste Evidenz für ein HPVbasiertes Screening lieferte eine Auswertung von vier europäischen Studien mit insgesamt mehr als 170 000 Frauen und einem durchschnittlichen Follow-up von 6,5 Jahren. Verglichen wurden das HPVbasierte und das zytologische Screening. Es zeigte sich, dass das HPV-basierte Screening einen bis zu 70 % höheren Schutz vor dem Entstehen eines Zervixkarzinoms bietet als die Zytologie (Abb. 1).<sup>1</sup><br /> Interessant sei auch die HPV-Typisierung, so Widschwendter. Frauen mit einer HPV-16-Infektion haben ein Risiko von 25 bis 30 % , im Verlauf von zwölf Jahren eine CIN 3 oder ein Karzinom zu entwickeln, wobei eine persistierende Infektion die Wahrscheinlichkeit auf rund 50 % steigert. Deutlich erhöht, wenn auch etwas niedriger, ist das Risiko bei Infektionen mit HPV 18, 31 und 33.<sup>2</sup> Als Limitation des HPVTests nannte Widschwendter das Alter. Bis zum 30. Lebensjahr sei die HPV-Prävalenz sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit HPVbedingter Läsionen dagegen eher gering. Ein generelles Screening junger Frauen würde daher viele Untersuchungen nach sich ziehen, ohne das Outcome zu verbessern, betonte er.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Gyn_1803_Weblinks_jatros_gyn_1803_s6_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="748" /></p> <h2>Aktuelles zur HPV-Impfung</h2> <p>Einen Rückblick auf zwölf Jahre HPVImpfung in Österreich und eine Zusammenfassung aktueller Daten bot Prof. Elmar Joura, Wien. So zeigten beispielsweise populationsbasierte Auswertungen aus den USA, dass die HPV-Impfung auch eine gewisse Kreuzprotektion gegen nicht im Impfstoff enthaltene HPV-Typen bietet.<sup>3</sup> Hinsichtlich der HPV-assoziierten Tumoren deutet sich eine Verschiebung an: Zwar ist das Zervixkarzinom noch immer die häufigste durch HPV ausgelöste Krebsart, aber die oropharyngealen Tumoren nehmen stetig zu. Für Gynäkologen ist wichtig, dass auch vermehrt HPV-assoziierte Vulva- und Analkarzinome diagnostiziert werden.<sup>4</sup><br /> Joura wies darauf hin, dass in Ländern mit einem HPV-Impfprogramm und hohen Durchimpfungsraten die Prävalenz der Impfstämme insgesamt – auch bei nicht geimpften Personen – deutlich abnimmt, was auf eine Herdenimmunität hinweist (Abb. 2).<sup>5</sup> Gleichzeitig werden in den entsprechenden Altersgruppen auch weniger hochgradige Zervixdysplasien beobachtet.<sup>6</sup> Doch selbst in Ländern mit einer geringeren Durchimpfungsrate, zu denen auch Österreich gehört, sinkt die HPV-Prävalenz.<sup>7</sup> Seit Einführung des Neunfachimpfstoffes haben sich diese Effekte laut Joura nochmals verstärkt. Doch gleich, welcher Impfstoff eingesetzt wird: „Das Entscheidende ist die Durchimpfungsrate“, betonte Joura. Hier komme den niedergelassenen Gynäkologen eine besondere Rolle bei der Beratung und Impfung zu.<sup>8</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Gyn_1803_Weblinks_jatros_gyn_1803_s7_abb2.jpg" alt="" width="1417" height="740" /></p> <h2>Immunologie in der Schwangerschaft</h2> <p>Priv.-Doz. Dr. Monika Martina Wölfler, Graz, widmete sich den immunologischen Veränderungen während der Schwangerschaft. Die Plazenta modifiziert die Immunantwort der Mutter und schützt den Fetus vor systemischen Infektionen.<sup>9</sup> Darüber hinaus wirken sich die immunologischen Veränderungen auf bestehende Autoimmunkrankheiten aus, die entweder verschlimmert oder aber gebessert werden.<sup>10, 11</sup><br /> Im Rahmen der präkonzeptionellen Beratung sollte immer auch der Immunstatus erhoben werden. Der aktuelle Impfplan Österreich empfiehlt bei Kinderwunsch die folgenden Impfungen: Masern-Mumps- Röteln (MMR; Mindestabstand 1 Monat zu Konzeption), Varizellen (Mindestabstand 1 Monat zu Konzeption), Diphtherie- Tetanus-Pertussis(-Polio) und Influenza. In Endemiegebieten ist zudem eine Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ratsam.<sup>12</sup> Ist eine MMRImpfung vor der Schwangerschaft nicht möglich, kann sie nach der Geburt im Wochenbett nachgeholt werden. Bei Rhesus- negativen Müttern hat jedoch die Rhesusprophylaxe Vorrang. Die MMR-Immunisierung sollte in diesen Fällen frühestens nach drei Monaten erfolgen.<sup>12</sup><br /> Zusätzliche Empfehlungen gelten bei Frauen mit bestimmten Risikofaktoren wie chronischen Leberkrankheiten, Dialyse, geschwächten Immunsystem, Diabetes etc. Sie sollten gegen Hepatitis A und B, Pneumo- sowie Meningokokken geimpft werden.<sup>12</sup></p> <h2>Immer aktuell: die Hormonersatztherapie</h2> <p>Die Diskussionen um die Hormonersatztherapie (HRT) in der Menopause reißen nicht ab. Prof. Christian Egarter aus Wien befasste sich mit den kardiovaskulären Effekten der HRT. Während in Beobachtungsstudien ein reduziertes kardiovaskuläres Risiko unter HRT festgestellt worden war, zeigte die WHI-Studie 2002 ein deutlich erhöhtes Risiko bei Frauen, die eine Kombination aus Östrogen und Progestagenen erhielten. Inzwischen ist bekannt, dass es entscheidend ist, wann man mit der HRT beginnt. So profitieren jüngere postmenopausale Frauen durchaus von der Behandlung, während sie bei älteren Frauen, bei denen sich bereits Ablagerungen in den Blutgefäßen gebildet haben, keinen Nutzen mehr hat. Das Zeitfenster beträgt zehn Jahre.<sup>13</sup> Ein zweiter wichtiger Faktor ist das Progestagen, das mit dem Östrogen kombiniert wird, da dies die protektiven Effekte des Östrogens entweder verstärken, neutralisieren oder auch umkehren kann. Dies beruht auf den Partialwirkungen der Progestagene, vor allem der androgenen, antiandrogenen und glukokortikoiden Wirkungen.<sup>14</sup> Geeignet sind zum Beispiel mikronisiertes Progesteron oder Dydrogesteron. Egarters Fazit lautete, dass die HRT die effizienteste Therapie klimakterischer Beschwerden ist und ihre Vorteile die möglichen Risiken überwiegen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Behandlung innerhalb von zehn Jahren nach dem Einsetzen der Menopause beginne bzw. die Frau jünger als 60 Jahre sei, betonte er. Grundsätzlich sollte das individuelle Risikoprofil der Patientin bei der Wahl des Präparates berücksichtigt werden, schloss er.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe, 30. 5. bis 2. 6. 2018, Salzburg
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Ronco G et al.: Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four european randomised controlled trials. Lancet 2014; 383: 524-32 <strong>2</strong> Katki HA et al.: Cervical cancer risk for women undergoing concurrent testing for human papillomavirus and cervical cytology: a population-based study in routine clinical practice. Lancet Oncol 2011; 12: 663-72 <strong>3</strong> Mesher D et al.: Population-level effects of human papillomavirus vaccination programs on infections with nonvaccine genotypes. Emerg Infect Dis 2016; 22: 1732-40 <strong>4</strong> Hartwig S et al.: Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Research 2015; 1: 90- 100 <strong>5</strong> Kavanagh K et al.: Changes in the prevalence of human papillomavirus following a national bivalent human papillomavirus vaccination programme in Scotland: a 7-year cross-sectional study. Lancet Infect Dis 2017; 17: 1293-1302 <strong>6</strong> Brotherton JM et al.: HPV vaccine impact in Australian women: ready for an HPV-based screening program. Med J Aust 2016; 204: 184-184e1 <strong>7</strong> Markowitz LE et al.: Reduction in human papillomavirus (HPV) prevalence among young women following HPV vaccine introduction in the United States, National Health and Nutrition Examination Surveys, 2003-2010. J Infect Dis 2013; 208: 385-93 <strong>8</strong> Rosenthal SL et al.: Predictors of HPV vaccine uptake among women aged 19-26: importance of a physician's recommendation. Vaccine 2011; 29: 890-5 <strong>9</strong> Racicot K et al.: Understanding the complexity of the immune system during pregnancy. Am J Reprod Immunol 2014; 72: 107-16 <strong>10</strong> Voskuhl R, Momtazee C: Pregnancy: effect on multiple sclerosis, treatment considerations, and breastfeeding. Neurotherapeutics 2017; 14: 974-84 <strong>11</strong> Østensen M et al.: State of the art: reproduction and pregnancy in rheumatic diseases. Autoimmun Rev 2015; 14: 376-86 <strong>12</strong> Impfplan Österreich 2018, Version 1, Stand 05.01.2018 <strong>13</strong> Reslan OM, Khalil RA: Vascular effects of estrogenic menopausal hormone therapy. Rev Recent Clin Trials 2012; 7: 47- 70 <strong>14</strong> Shufelt CL, Bairey Merz CN: Contraceptive hormone use and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 221-31</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Webinar „CTG-Update“
Webinar „CTG-Update“ mit Dr. Elisabeth D’Costa: Aktuelle Leitlinien, praxisnahe Tipps und neue Standards kompakt zusammengefasst. Jetzt ansehen und Wissen auffrischen!
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...
Was brauchen Mädchen für eine selbstbewusste Sexualität?
Die Entwicklung der eigenen Sexualität ist zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Manchen Mädchen fällt es jedoch nicht leicht, ihre Sexualität selbstbewusst und selbstbestimmt zu ...