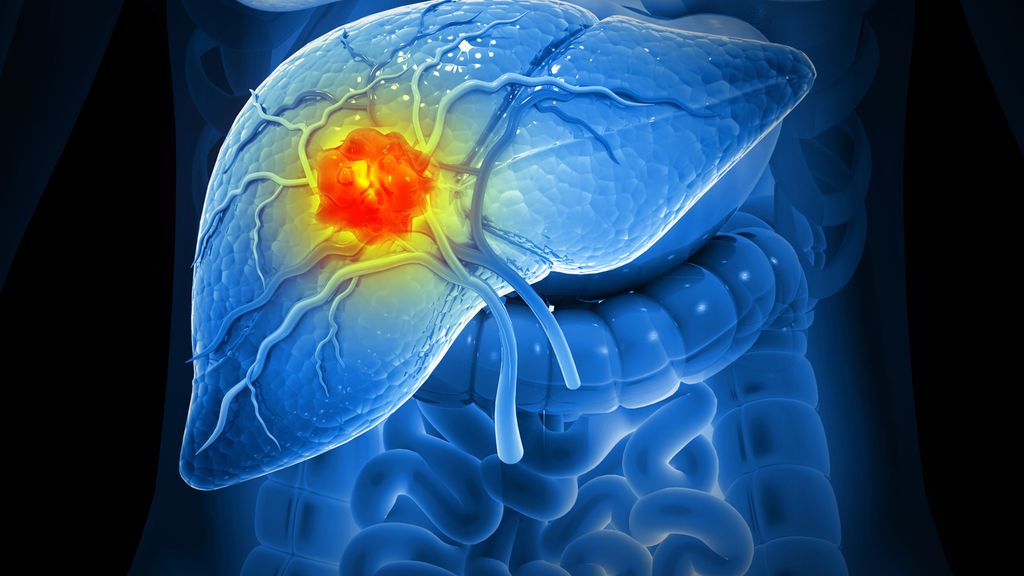
EASL-Update: Leberzirrhose und hepatozelluläres Karzinom
Bericht:
Regina Scharf, MPH
Redaktorin
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die EASL schlägt bei Patienten mit Leberzirrhose neu eine risikobasierte Überwachung auf ein hepatozelluläres Karzinom vor und die BAVENO-VI/VII-Kriterien eignen sich bei Patienten, die zusätzlich an einem HCC leiden, nicht, um Ösophagusvarizen und einen klinisch signifikanten Pfortaderhochdruck auszuschliessen.
Eine wichtige Neuigkeit am Jahreskongress der European Association for the Study of the Liver (EASL) war das «in eigener Sache» veröffentlichte «Policy Statement» zur Überwachung von Patienten mit Leberzirrhose und einem erhöhten Risiko für ein hepatozelluläres Karzinom (HCC).1 Bisherige Guidelines stufen das Risiko für ein HCC bei allen Patienten mit Leberzirrhose als mittelmässig ein und empfehlen alle 6 Monate eine Kontrolle mittels Ultraschall. In Europa sterben jährlich ca. 80000 Menschen an einem HCC – die durch HCC verursachten Kosten sind enorm. «Viele dieser Patienten werden von den Screeningprogrammen nicht erfasst, weil ihre Leberzirrhose undiagnostiziert ist», sagte PD Dr. med. Dr. phil. nat. David Semela vom Kantonsspital St. Gallen an der Online-Veranstaltung HEP-CUP mit dem Update zum EASL-Kongress. Auf der anderen Seite istnicht bei allen Patienten mit Leberzirrhose eine engmaschige Überwachung notwendig. In dem von der EASL veröffentlichten «Policy Statement» wird neu eine risikobasierte Überwachung vorgeschlagen. Gemäss dieser liesse sich bei etwa 20% der Patienten mit Leberzirrhose aufgrund eines niedrigen HCC-Risikos auf ein Screening verzichten. Im Gegenzug könne den ca. 10% Patienten mit Leberzirrhose und einem hohen HCC-Risiko ein intensiviertes Screening mittels MRI angeboten werden. Für die übrigen ca. 70% der Patienten mit Leberzirrhose und einem mittleren HCC-Risiko bleibt die Empfehlung einer Ultraschallkontrolle bestehen. Die Vorteile einer risikobasierten Überwachungsstrategie sieht die EASL in der Abnahme der Zahl von HCC-bedingten Todesfällen aufgrund von häufigeren Früherkennungen und kurativen Therapien bei gleichzeitiger Kostenreduktion.
Die Genauigkeit bildgebender Verfahren zur HCC-Früherkennung gilt als suboptimal. Man hofft deshalb für das zukünftige Screening auf blutbasierte Tests. Als vielversprechend hat sich die Analyse von zellfreier DNA aus den Tumorzellen gezeigt, die in die Blutbahn gelangt.2 Basierend auf einer multidimensionalen genomischen Analyse zellfreier DNA von Patienten mit Leberzirrhose mit oder ohne HCC haben Wissenschaftler nun ein «Multiomics-Modell» für die HCC-Früherkennung entwickelt, das eine Sensitivität von 93% und eine Spezifität von 94% aufwies.3 Der Test zeigte über alle HCC-Tumorstadien und -Ätiologien eine gute Performance und muss nun in grösseren Studien validiert werden.
Anwendung von BAVENO-VI/VII-Kriterien bei Leberzirrhose und HCC
Eine weitere Studie hatte untersucht, inwiefern die BAVENO-Kriterien geeignet sind, um bei Patienten mit Leberzirrhose und HCC grosse Ösophagusvarizen und eine klinisch signifikante portale Hypertension (CSPH) auszuschliessen. Gemäss den BAVENO-VI-Kriterien ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen von Hochrisikovarizen bei einer Lebersteifigkeitsmessung (LSM) <20kPa und einer Thrombozytenzahl (PLT) >150G/l sehr gering, sodass gemäss Guidelines bei der Erstdiagnose einer Leberzirrhose auf eine Screening-Gastroskopie verzichtet werden kann. Ob das auch bei Vorliegen eines HCC gilt, untersuchte eine retrospektive Studie bei 150 Patienten mit einer Leberzirrhose (Stadium Child-Pugh A) und unterschiedlichen Tumorstadien (BCLC 0/A–C). Bei allen Patientinnen und Patienten wurde eine Endoskopie oder eine Messung des HVPG («hepatic venous pressure gradient») durchgeführt und die Thrombozytenzahl bestimmt. Wie die Anwendung der BAVENO-VI-Kriterien zeigte, wäre bei ca. 20% der Patienten das Vorhandensein von Ösophagusvarizen unentdeckt geblieben. Dabei handelt es sich in etwa 8% der Fälle um grosse Ösophagusvarizen. Von den Patienten ausserhalb der BAVENO-Kriterien, bei denen man Ösophagusvarizen und eine CSPH vorausgesagt hätte, erwies sich die Vorhersage bei der Hälfte der Betroffenen als falsch. Die zusätzliche Stratifizierung der Patienten mit positiven BAVENO-VI-Kriterien nach dem Tumorstadium führte dazu, dass bei ca. 17% mit einem BCLC-0/A und bei 40% mit einem BCLC-C vorhandene Ösophagusvarizen verpasst worden wäre. Eine weitere Analyse, bei der die BAVENO-VII-Kriterien zum Ausschluss einer CSPH (LSM ≤15kPa, PLT ≥150G/l) angewendet wurden, zeigte, dass diese ebenfalls zu vielen falsch positiven oder falsch negativen Diagnosen führte. «Patienten mit Leberzirrhose und HCC sollten definitiv gastroskopiert werden», sagte David Semela. Dies sei auch wichtig, weil man bei diesen Patienten wahrscheinlich in Richtung einer Systemtherapie mit Bevacizumab oder Tyrosinkinase-Inhibitoren ginge, die vermehrt mit dem Auftreten von Blutungen assoziiert sei.
Quelle:
HEP-CUP (online), 28. Juni 2023
Literatur:
1 EASL Policy Statement: www.easl.eu 2 Salviano-Silva A et al.: J Lab Med 2022; 46: 265-72 3 Yang JD et al.: J Hepatol 2023; 78: S489 4 Pallaire M et al.: Aliment Pharmacol Ther 2023; 58: 346-56
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues aus der Gastroenterologie
Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...
Zöliakie: Stand der Entwicklungpharmakologischer Therapieoptionen
Viele Patienten mit Zöliakie haben trotz glutenfreier Diät weiterhin Beschwerden. Zurzeit befinden sich einige innovative therapeutische Ansätze in Entwicklung: u.a. ein Inhibitor der ...
Transition bei CED: Fallbeispiel für einen strukturierten Übergang
Die Transition bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stellt eine wichtige Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen dar und birgt einige Herausforderungen. Am ...


