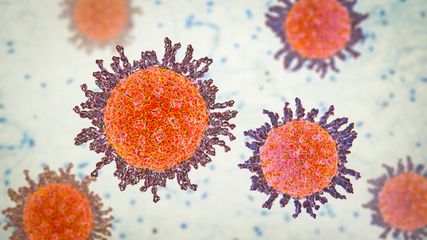©
Getty Images
Mangelnde Anwendbarkeit bei Multimorbidität
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
01.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Leitlinien basieren auf einem systematisch erarbeiteten Protokoll und sie sollen dem Arzt und dem Patienten helfen, in bestimmten medizinischen Umständen die richtige Entscheidung zu treffen: So definierte das Institute of Medicine (heute: National Academy of Medicine) 1990 die «Clinical Practice Guidelines» (CPG). Hauptzweck der Leitlinien sei letztlich aber die Beurteilung und Verbesserung der medizinischen Qualität, wie Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Klinikdirektor und Chefarzt, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, an der 1. Frühjahrsversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin ausführte.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Wird heute in Praxis oder Spital die medizinische Qualität gemessen, wird geprüft, ob die Prozesse Guideline-konform sind», so Aujesky. Dabei wird die Behandlungsqualität als günstiges Verhältnis von Outcome/Kosten definiert. Leitlinien gibt es zuhauf – die grösste CPG-Datenbank, die vom National Guideline Clearinghouse geführt wird, listet allein für die innere Medizin 1198 Leitlinien mit Publikationsdatum 2010 bis 2016 auf (<a href="https://www.guideline.gov" target="_blank">www.guideline.gov</a>). Diese grosse Anzahl an Leitlinien weist auch bereits auf eines der Hauptprobleme hin, die sich mit der Anwendbarkeit von CPG im praktischen Alltag des Allgemeininternisten ergeben: Leitlinien befassen sich in der Regel mit einzelnen Krankheitsbildern und nicht mit realen Patienten. Multimorbidität, die gerade bei älteren Patienten die Norm ist, wird nur sehr selten berücksichtigt.<sup>1</sup> Zudem beruhen Leitlinien auf Evidenz, die aus Studien mit hochselektionierten Populationen stammt. «80 % der randomisierten, kontrollierten Studien, die in renommierten Journals publiziert werden, schliessen Patienten mit Komorbiditäten aus», sagte Aujesky.<sup>2</sup> Ein weiteres Problem sind die kaum vorhandenen Informationen über den absoluten Benefit in Leitlinien. Wenn durch eine Intervention die Häufigkeit eines Ereignisses von 2 % auf 1 % vermindert wird, entspricht dies einer relativen Risikoreduktion (RRR) von 50 % , die absolute Risikoreduktion (ARR) beträgt aber nur 1 % , was wesentlich weniger beeindruckend ist. Oder wenn in der Behandlungsgruppe 4 von 1000 Probanden sterben und in der Kontrollgruppe 6 von 1000, beträgt die RRR 33 % , die ARR aber nur 0,2 % . In diesem Zusammenhang interessiert auch der Zeitraum, der benötigt wird, um die positive Wirkung zu erzielen. «Es macht einen grossen Unterschied, ob dafür 10 Tage oder 10 Jahre benötigt werden. Aber auch dazu gibt es in Leitlinien nur sehr wenige Informationen», so Aujesky. Auch die schwierige Frage, wann eine Behandlung gestoppt werden soll, wird in Guidelines nur sehr selten thematisiert.</p> <h2>Leitlinien können Behandlungs-qualität sogar verschlechtern</h2> <p>Zu welch grotesken Situationen die strikte Anwendung von Leitlinien im praktischen Alltag führen kann, zeigen zwei publizierte Beispiele von hypothetischen multimorbiden Patienten. <br /> 1) Stellt man sich eine 79-jährige Patientin mit den fünf chronischen Erkrankungen Diabetes, Hypertonie, COPD, Osteoporose und Arthrose vor, müsste man dieser Frau unter Berücksichtigung aller relevanten Leitlinien 12 verschiedene Medikamente (19 Dosen pro Tag) und 14 nicht pharmakologische Massnahmen empfehlen.<sup>3</sup> «Hier wird Polypharmazie mit all ihren Interaktionen gefördert. Und man muss sich fragen, ob das strikte Befolgen der CPG die Behandlungsqualität wirklich verbessert», stellte Aujesky fest.<br /> 2) 45- bis 64-jähriger Mann, koronare Herzkrankheit, Arthrose, Diabetes, Hypertonie, COPD und Depression: Hat der Patient drei dieser Krankheiten, resultieren aus den Leitlinien ein bis sechs Arztbesuche und 50–71 Stunden Therapien pro Monat. Hat er alle sechs Erkrankungen, müsste er bei leitlinienkonformer Behandlung zweimal pro Woche zum Arzt gehen und 81 Stunden pro Monat in Therapien investieren.<sup>4</sup> Ist ein solcher Aufwand noch zu bewältigen? Und wie sieht es mit der Adhärenz aus? «Die Adhärenz wird bestimmt abnehmen – aber ich glaube, das wäre sogar zum Wohl des Patienten», meinte Aujesky.</p> <div id="rot"> <p>«Leitlinien behandeln in der Regel einzelne Krankheitsbilder, wir behandeln aber reale Patienten, die meistens mehrere Erkrankungen haben.» - D. Aujesky, Bern</p> </div> <h2>Bestrebungen zur Integration von Multimorbidität in CPG</h2> <p>Die Probleme in Bezug auf die Anwendbarkeit der Leitlinien in der allgemeinen inneren Medizin wurden in den letzten Jahren erkannt, und es werden Anstrengungen unternommen, die Multimorbidität besser zu integrieren. So erarbeitet beispielsweise das U.S. Department of Health & Human Services seit 2010 ein strategisches Programm zur Förderung der Forschung an multimorbiden Patienten und der Integration von Multimorbidität in CPG. Ein wesentlicher Punkt ist, dass dabei nicht nur Fachspezialisten, sondern auch Grundversorger miteinbezogen werden.<sup>5</sup> Weitere Beispiele sind die amerikanischen Guidelines zur Behandlung der Herzinsuffizienz<sup>6</sup> oder des Typ-2-Diabetes<sup>7</sup> sowie die europäischen Hypertonie-Leitlinien<sup>8</sup>, die spezielle Empfehlungen für multimorbide Patienten enthalten. Andere Guidelines, wie zum Beispiel die GOLD-Empfehlungen zur Behandlung der COPD<sup>9</sup> oder die ACCP-Leitlinie zur venösen Thromboembolie<sup>10</sup>, behandeln das Thema Multimorbidität noch sehr stiefmütterlich. «Die positiven Beispiele zeigen jedoch, dass sich auf dem Gebiet der Integration von Multimorbidität in Leitlinien etwas tut», schloss Aujesky zuversichtlich.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Hughes LD et al: Guidelines for people, not for diseases: the challenges of applying UK clinical guidelines to people with multimorbidity. Age Ageing 2013; 42: 62-9<br /> <strong>2</strong> Van Spall HG et al: Eligibility criteria of randomized controlled trials published in high-impact general medical journals: a systematic sampling review. JAMA 2007; 297: 1233-40 <br /><strong>3</strong> Boyd CM et al: Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with multiple comorbid diseases: implications for pay for performance. JAMA 2005; 294: 716-24<br /><strong>4</strong> Buffel du Vaure C et al: Potential workload in applying clinical practice guidelines for patients with chronic conditions and multimorbidity: a systematic analysis. BMJ Open 2016;6: e010119<br /><strong>5</strong> Goodman RA et al: IOM and DHHS meeting on making clinical practice guidelines appropriate for patients with multiple chronic conditions. Ann Fam Med 2014; 12: 256-9<br /><strong>6</strong> Yancy CW et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation 2013; 128: e240-327<br /><strong>7</strong> American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes - 2016. Diabetes Care 2016; 39(Suppl 1): S1-112<br /><strong>8</strong> Mancia G et al: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31: 1281-357<br /><strong>9</strong> GOLD: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2016. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dis-ease, Inc. 2016<br /><strong>10</strong> Kearon C et al: Antithrombotic therapy for VTE disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest 2016; 149: 315-52</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Planetary Health als hausärztliche Aufgabe: Gesundheit im Zeitalter der ökologischen Krise
Hausärzt:innen sind geradezu prädestiniert, um den Gedanken der Planetary Health umzusetzen, denn sie verfügen über das Vertrauen, die Reichweite und die Handlungsspielräume, um ...
Herpesvirusinfektionen – ein Überblick
Herpesviren sind weitverbreitet: Mehr als 100 Typen sind bekannt, wovon allerdings nur acht für Menschen infektiös sind. In einem Vortrag im Rahmen des WebUp Allgemeine Innere Medizin ...
«Die Feinde meines Feindes sind meine Freunde»
Wer hätte gedacht, dass wir Viren als unsere Freunde bezeichnen, aber genau das ist bei den Bakteriophagen der Fall. Selbst die heilende Wirkung des Ganges wird mit Bakteriophagen in ...